Schiffbau in Europa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Naval Engineer
THE NAVAL ENGINEER SPRING/SUMMER 2019, VOL 06, EDITION NO.2 All correspondence and contributions should be forwarded to the Editor: Welcome to the new edition of TNE! Following the successful relaunch Clare Niker last year as part of our Year of Engineering campaign, the Board has been extremely pleased to hear your feedback, which has been almost entirely Email: positive. Please keep it coming, good or bad, TNE is your journal and we [email protected] want to hear from you, especially on how to make it even better. By Mail: ‘..it’s great to see it back, and I think you’ve put together a great spread of articles’ The Editor, The Naval Engineer, Future Support and Engineering Division, ‘Particularly love the ‘Recognition’ section’ Navy Command HQ, MP4.4, Leach Building, Whale Island, ‘I must offer my congratulations on reviving this important journal with an impressive Portsmouth, Hampshire PO2 8BY mix of content and its presentation’ Contributions: ‘..what a fantastic publication that is bang up to date and packed full of really Contributions for the next edition are exciting articles’ being sought, and should be submitted Distribution of our revamped TNE has gone far and wide. It is hosted on by: the MOD Intranet, as well as the RN and UKNEST webpages. Statistics taken 31 July 2019 from the external RN web page show that there were almost 500 visits to the TNE page and people spent over a minute longer on the page than Contributions should be submitted average. This is in addition to all the units and sites that received almost electronically via the form found on 2000 hard copies, those that have requested electronic soft copies, plus The Naval Engineer intranet homepage, around 700 visitors to the internal site. -

Trident, Jobs – and the UK Economy
Trident, jobs – and the UK economy CND www.cnduk.org A Briefing by the Campaign for Nuclear Disarmament TRIDENT, JOBS AND THE UK ECONOMY Trident, jobs – and the UK economy Executive summary decision to initiate design work on the replacement for Britain’s Trident submarine- based nuclear weapons system is due to be taken by the end of this year – 2010. This report examines the employment consequences of this decision. It considers the latest figures on the cost of Trident replacement as well as the running costs of the existing and replacement systems. It does so in the context of the Strategic Defence and Security Review, Adue to be published in October 2010, that has been tasked to propose cuts in existing defence budgets of up to 20 per cent and, contrary to previous government assumptions, to include within that reduced budget full provision for the cost of Trident replacement. It concludes: • Trident replacement, particularly given its dependence for the provision of missiles and missile launch technology on US-based contractors, will cost more jobs than it will generate • The cost of replacement, in the context of the existing crisis of the defence budget, will mean that a number of defence programmes scheduled for British industry over the coming decade will either be cancelled or significantly reduced • The most vulnerable programmes, both from the impact of Trident costs and the overall budget reduction, are in the areas of surface ships, jet fighters, helicopters and armoured vehicles as well as the servicing of airbases and -

British Shipbuilding 1500-2010 : a History Pdf, Epub, Ebook
BRITISH SHIPBUILDING 1500-2010 : A HISTORY PDF, EPUB, EBOOK Anthony Slavin | 352 pages | 30 Nov 2013 | Crucible Books | 9781905472161 | English | Lancaster, United Kingdom British Shipbuilding 1500-2010 : A History PDF Book It languished until a new wave of colonists arrived in the late 17th century and set up commercial agriculture based on tobacco. Starting at 1. These had non-overlapping planks on a frame. Barry G. Winteringham unknown zz.. New fears for Govan shipyard's future. Dockyard, Pembroke H. A if you would like to buy more than one product and get a reduction on shipping please follow the steps Delivered anywhere in UK. Portsmouth unknown zz.. Cardiff unknown zz.. Ailsa Shipbuilding Company. New Ferry unknown zz.. Details: shipping, lloyds, register, north, east, tyne, books, listing, late, fathers. Scarborough unknown zz.. The finds include palstave axe heads, an adze , a cauldron handle and a gold bracelet. As the century reaches its end, Britain is reduced to a merchant fleet that stands at number thirty-eight in the world listings. Download Statistics. During the early part of the 17th century, English shipbuilders developed sturdy, well masted and defensible ships, that because of the way they were rigged, required a significant crew to man. I would prefer for the shipbuilding to be collected, But could arrange for it to be delivered if discussed before auction ends. English Choose a language for shopping. Windsor unknown zz.. Executors, Sudbrook Walker T. Best wishes. A further 6 ship repair companies and a further shipyard were also acquired by the corporation, with British Shipbuilders initially comprising 32 shipyards, 6 marine engine works and 6 general engineering plants. -

BAE Systems Plc
BAE Systems plc Aetna Inc BAE Systems plc Company Profile Part of Research Bank’s Company Profiling Series August 2009 Research Bank © 2009 Research Bank 118 Cornwall Road All rights reserved. Harrogate Fortune Global 500 is a registered trademark of Time Warner Inc. North Yorkshire All information contained in this publication is copyrighted in the name HG1 2NG of Research Bank, and as such no part of this publication may be United Kingdom reproduced, repackaged, redistributed, resold in whole or in any part, or used in any form or by any means graphic, electronic or mechanical, Tel: +44 (0) 791 3653991 including photocopying, recording, taping, or by information storage or [email protected] retrieval, or by any other means, without the express written consent www.researchbank.co.uk of the publisher. DISCLAIMER All information contained in this publication has been researched and compiled from sources believed to be accurate and reliable at the time of publishing. However, in view of the natural scope for human and/or mechanical error, either at source or during production, Research Bank accepts no liability whatsoever for any loss or damage resulting from errors, inaccuracies or omissions affecting any part of the publication. All information is provided without warranty, and Research Bank makes no representation of warranty of any kind as to the accuracy or completeness of any information hereto contained. © Research Bank 2009 BAE Systems plc BAE Systems plc BAE Systems plc Fortune Global 500 Ranking & Revenues (millions) -

Major Projects Report 2015 and the Equipment Plan 2015 to 2025
Report by the Comptroller and Auditor General Ministry of Defence Major Projects Report 2015 and the Equipment Plan 2015 to 2025 Appendices and project summary sheets HC 488-II SESSION 2015-16 22 OCTOBER 2015 Our vision is to help the nation spend wisely. Our public audit perspective helps Parliament hold government to account and improve public services. The National Audit Office scrutinises public spending for Parliament and is independent of government. The Comptroller and Auditor General (C&AG), Sir Amyas Morse KCB, is an Officer of the House of Commons and leads the NAO, which employs some 810 people. The C&AG certifies the accounts of all government departments and many other public sector bodies. He has statutory authority to examine and report to Parliament on whether departments and the bodies they fund have used their resources efficiently, effectively, and with economy. Our studies evaluate the value for money of public spending, nationally and locally. Our recommendations and reports on good practice help government improve public services, and our work led to audited savings of £1.15 billion in 2014. Ministry of Defence Major Projects Report 2015 and the Equipment Plan 2015 to 2025 Appendices and project summary sheets Report by the Comptroller and Auditor General Ordered by the House of Commons to be printed on 22 October 2015 This report has been prepared under Section 6 of the National Audit Act 1983 for presentation to the House of Commons in accordance with Section 9 of the Act Sir Amyas Morse KCB Comptroller and Auditor General National Audit Office 20 October 2015 This volume has been published alongside a first volume comprising of – Ministry of Defence: Major Projects Report 2015 and the Equipment Plan 2015 to 2024 HC 488-I HC 488-II | £10.00 © National Audit Office 2015 The material featured in this document is subject to National Audit Office (NAO) copyright. -

THE IMPACT of BAE SYSTEMS on the UK ECONOMY Eurofighter Typoon Undergoing Anechoic Chamber Testing
THE IMPACT OF BAE SYSTEMS ON THE UK ECONOMY Eurofighter Typoon undergoing anechoic chamber testing. The impact of BAE Systems on the UK economy CONTENTS: Foreword 2 Executive summary 4 Introducing economic impact analysis 7 1. Core GDP contribution 9 1.1 Total contribution 9 1.2 Labour productivity 9 1.3 Supply chain contribution 10 1.4 Consumer spend contribution 13 Supply chain 14 2. Employment contribution 18 2.1 Total employment 18 2.2 Skills base 18 Apprenticeships 20 Graduates 22 2.3 Supply chain and consumer spend contribution 24 3. Tax contribution 27 4. Wider economic impacts 28 4.1 Exports 28 4.2 Capital and R&D investment 29 University partnerships 31 R&D investment driving innovation 32 5. Regional contribution 34 5.1 Glasgow 35 5.2 South Cumbria 37 5.3 North West 40 5.4 South 42 6. Technical appendix 45 7. Further information 48 1 The impact of BAE Systems on the UK economy FOREWORD The UK is home to one of Our employees are incredibly the most advanced defence proud to engineer the industries in the world. It has equipment and services to a rich heritage in the design, protect and serve those who production, modification protect and serve us. The and maintenance of military UK’s role in an increasingly combat aircraft and training fragmented world is platforms; complex naval underpinned by its defence vessels, the radar and combat capabilities – and the industrial systems they carry and nuclear base that provides those powered submarines. In this capabilities. In an evolving sector, BAE Systems leads the geopolitical environment, with field and is one of the world’s ongoing pressure on defence largest defence, aerospace and budgets, we are continuously security companies. -
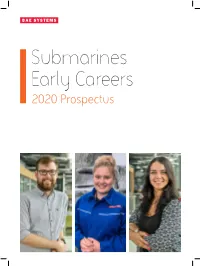
BAE Systems Submarines Prospectus
Submarines Early Careers 2020 Prospectus 2 Submarines Academy for Skills and Knowledge - Prospectus Submarines Academy for Skills and Knowledge - Prospectus 3 Contents 1 Managing Director’s Welcome 2 Principal’s Welcome 4 Five decades of nuclear-powered submarine building 7 Submarines sites in the UK 8 Submarines Academy for Skills and Knowledge 9 Diversity and Inclusion 10 Celebrating success 11 Community Outreach 12 Careers advice and guidance 14 Intermediate and Advanced Apprenticeships 18 Higher/Degree Apprenticeships 22 Graduate Accelerate Programme 26 Gaining experience of the workplace 4 Submarines Academy for Skills and Knowledge - Prospectus Submarines Academy for Skills and Knowledge - Prospectus 1 Managing Director’s welcome In BAE Systems Submarines we take pride in delivering an essential edge to the Royal Navy, supporting them to protect what matters most. We are proud of our reputation for designing, building, testing, and commissioning world class submarines, and every one of our employees is here to make a vital contribution. Today’s nuclear-powered submarines are among the most complex engineering products in the world, and require a vast range of skills to deliver successfully, offering exciting opportunities for anyone joining our business. The shipyard has a proud and distinguished history of shipbuilding, with 140 years’ experience in supplying ships to the Royal Navy. We built our first submarine in 1886 and our first submarine for the Royal Navy in 1901. As an ambitious, determined and hard-working Apprentice, Higher Apprentice or Graduate, you could be part of our continuing success story. Today we continue to deliver world class submarines for the Royal Navy. -

Aerospace, Defence, and Government Services Mergers & Acquisitions
Aerospace, Defence, and Government Services Mergers & Acquisitions - European (January 1993 - April 2020) BAE L3Harris Rolls- Airbus Hensoldt Boeing Cobham Dassault Elbit General Dynamics GE GKN Honeywell Indra Kongsberg Leonardo Lockheed Martin Meggitt Northrop Grumman Rheinmetall Saab Safran Thales Ultra Raytheon Technologies Systems Aviation Systems Sistemas Technologies Royce Electronics Airborne tactical PFW Aerospace to Aviolinx Raytheon Kopter Group Atmos Sistemas Advent Hydroid to Huntington Airport security radio business to Hutchinson Bombardier C Series airborne tactical Leonardo&Codemar businesses to Leidos Vector Launch Otis & Carrier businesses BAE Systems ALP stake [25%] radios business Int’l Ingalls Industries JV [51%] Controls & Data TCS EW business to to Shareholders IE Asia-Pacific Sistemas Services to Valsef Telemus United Raytheon MTM Robotics buyout Jet Aviation Vienna Distributed Energy GERAC test lab and PK AirFinance to Informaticos Abiertas Night Vision business Rheinmetall MAN Base2 Solutions engineering to Sopemea Technologies 2 Inventory Locator Service to L3Harris Hamble aerostructure Solutions business to TRC Military Vehicles eAircraft 2 GDI Simulation to MBDA Alestis Aerospace stake [76%] NEXEYA CAMP Systems International Night Vision Apollo and Athene to Elbit Systems Stormscope product BAE Systems UK to Belcan Collins Psibernetix ElectroMechanical Websense to Aciturri Aeronautica RBSL JV w/ business to Aernnova Medav Technologies NVH stake [19.5%] 0 RUAG Switzerland Next Generation 911 to line to TransDigm -

BAE Systems Submarines What to Do in an Emergency Booklet
WHAT TO DO IN THE EVENT OF A RADIATION EMERGENCY WHAT TO DO IN THE EVENT OF A Radiation Emergency at BAE Systems Submarines and Ramsden Dock Basin, Barrow in Furness This booklet has been prepared for distribution to everyone living and working within the Detailed Emergency Planning Zone (Map on Page 15) of the Barrow BAE Systems and Ramsden Dock Basin Submarine Berths. EMERGENCY INFORMATION Tune into local media www.cumbria.gov.uk/emergencyplanning Valid until November 2023 1 WHAT TO DO IN THE EVENT OF A RADIATION EMERGENCY 2 WHAT TO DO IN THE EVENT OF A RADIATION EMERGENCY Introduction IT IS IMPORTANT THAT YOU KNOW WHAT ACTION TO TAKE SHOULD A RADIATION EMERGENCY OCCUR. THEREFORE IT IS IMPORTANT THAT YOU STUDY THIS BOOKLET CAREFULLY AND KEEP IT IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. o This booklet provides a simple guide and gives advice on what to do in the unlikely event of a radiation emergency at BAE Systems or Ramsden Dock Basin. o Nuclear powered submarines have been constructed at the Barrow site since 1959 and there has never been a radiation emergency. It should be emphasised that the possibility of such an event is very remote because the design of all plant is to the highest standards of safety and is independently monitored by the Office for Nuclear Regulation and the Ministry of Defence. o However, should the highly unlikely occur, there are stages to the development of a radiation emergency with each stage an opportunity for the Emergency Response Organisation to resolve the issue. -
Annual Report 2012 1
ANNE U FOR MORE A BAE Systems continues to build on its L R P INFORMATION O position as one of the world’s largest RT — 2012 and most geographically diverse defence, BAESYSTEMS.COM aerospace and security companies. BAE Systems is focused on delivering sustainable growth in shareholder value through its commitment to Total Performance. ANN E UAL R PORT 2012 Front cover: BAE Systems succeeds on the For BAE Systems at a glance see overleaf talent, commitment and dedication of every single employee. BAE Systems plc 6 Carlton Gardens Cautionary statement: All statements other than statements of historical fact included in this document, including, without limitation, those regarding the financial London SW1Y 5AD condition, results, operations and businesses of BAE Systems and its strategy, plans and objectives and the markets and economies in which it operates, are United Kingdom forward-looking statements. Such forward-looking statements which reflect management’s assumptions made on the basis of information available to it at this time, Telephone: +44 (0) 1252 373232 involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors which could cause the actual results, performance or achievements of BAE Systems or www.baesystems.com the markets and economies in which BAE Systems operates to be materially different from future results, performance or achievements expressed or implied by Registered in England and Wales No. 1470151 such forward-looking statements. BAE Systems plc and its directors accept no liability to third parties in respect of this report save as would arise under English law. Accordingly, any liability to a person who has demonstrated reliance on any untrue or misleading statement or omission shall be determined in accordance © BAE Systems plc 2012. -
Major Projects Report 2014 Appendices and Project Summary
Report by the Comptroller and Auditor General Ministry of Defence Major Projects Report 2014 and the Equipment Plan 2014 to 2024 Appendices and project summary sheets HC 941-II SESSION 2014-15 13 JANUARY 2015 Our vision is to help the nation spend wisely. Our public audit perspective helps Parliament hold government to account and improve public services. The National Audit Office scrutinises public spending for Parliament and is independent of government. The Comptroller and Auditor General (C&AG), Sir Amyas Morse KCB, is an Officer of the House of Commons and leads the NAO, which employs some 820 employees. The C&AG certifies the accounts of all government departments and many other public sector bodies. He has statutory authority to examine and report to Parliament on whether departments and the bodies they fund have used their resources efficiently, effectively, and with economy. Our studies evaluate the value for money of public spending, nationally and locally. Our recommendations and reports on good practice help government improve public services, and our work led to audited savings of £1.1 billion in 2013. Ministry of Defence Major Projects Report 2014 and the Equipment Plan 2014 to 2024 Appendices and project summary sheets Report by the Comptroller and Auditor General Ordered by the House of Commons to be printed on 13 January 2015 This report has been prepared under Section 6 of the National Audit Act 1983 for presentation to the House of Commons in accordance with Section 9 of the Act Sir Amyas Morse KCB Comptroller and Auditor General National Audit Office 8 January 2015 This volume has been published alongside a first volume comprising of – Ministry of Defence: Major Projects Report 2014 and the Equipment Plan 2014 to 2024 HC 941-I HC 941-II | £10.00 © National Audit Office 2015 The material featured in this document is subject to National Audit Office (NAO) copyright. -
BAE SYSTEMS Chppcase STUDY
BAE SYSTEMS ChPPCASE STUDY Introduction What is the landscape like in your organisation, even sometimes very complex platforms. The current how many project professionals are you looking to environment clearly signposts the world around us is or have gone through the ChPP standard so far? changing rapidly and the VUCA effect as in volatility, uncertainty, complexity and ambiguity is real. Excellence At BAE Systems, our advanced defence technology in Project Management therefore is a key enabler to protects people and national security, and keeps critical ensuring as an organisation we can deliver in any information and infrastructure secure. We search for environment that not only satisfies our business new ways to provide our customers with a competitive requirements but also our customers and shareholders edge across the air, maritime, land and cyber domains. too. We employ a skilled workforce of 85,800 people in more than 40 countries, and work closely with We have around 6,500 people globally in Project local partners to support economic development by Management across our Delivery, Project Control, transferring knowledge, skills and technology. Business Change and Functional roles. Currently we have 85 individuals who have achieved Chartership, We have thousands of projects across our Air, Land, Sea with a commitment to increase this every year as part of and Cyber sectors, of which over 70% of our order book our Project Management People Capability Strategy. is underpinned by the delivery of large, complex or BAE SYSTEMS ChPPCASE STUDY How is your organisation supporting these individuals to become chartered? Our Corporate Project Management Council’s (CPMC) main purpose is to improve our people and build a high calibre capability, share best practice and create clarity in reporting our performance to encourage the early identification of risk.