Schubert-Handbuch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schubert: the Nonsense Society Revisited
© Copyright, Princeton University Press. No part of this book may be distributed, posted, or reproduced in any form by digital or mechanical means without prior written permission of the publisher. Schubert: The Nonsense Society Revisited RITA STEBLIN Twenty years have now passed since I discovered materials belonging to the Unsinnsgesellschaft (Nonsense Society).1 This informal club, active in Vienna from April 1817 to December 1818, consisted mainly of young painters and poets with Schubert as one of its central members. In this essay I will review this discovery, my ensuing interpretations, and provide some new observations. In January 1994, at the start of a research project on Schubert ico- nography, I studied some illustrated documents at the Historisches Museum der Stadt Wien (now the Wienmuseum am Karlsplatz), titled “Unsinniaden.”2 The documents comprise forty-four watercolor pictures and thirty-seven pages of text recording two festive events celebrated by the Nonsense Society: the New Year’s Eve party at the end of 1817 and the group’s first birthday party on 18 April 1818.3 The pictures depict various club members, identified by their code names and dressed in fan- ciful costumes, as well as four group scenes for the first event, including Vivat es lebe Blasius Leks (Long live Blasius Leks; Figure 1), and two group scenes for the second event, including Feuergeister-Scene (Fire Spirit Scene; Figure 6 below).4 Because of the use of code names—and the misidentifi- cations written on the pictures by some previous owner of the -

Schubert's Late Style and Current Musical Scholarship
Cambridge University Press 978-1-107-11129-5 — Schubert's Late Music Edited by Lorraine Byrne Bodley , Julian Horton Excerpt More Information Introduction: Schubert’s late style and current musical scholarship lorraine byrne bodley The theme of lateness When discussing Schubert’s ‘late’ works it is worth remembering that wearereferringtoacomposerinhislatetwenties.Whythen,dowe ascribe the classification ‘late’? And in what sense do we mean ‘late’? Istherenot,inallSchubert’s‘latemusic’,simplyanexperiencedcomposer’s calm and confident grasp of the tools of his trade? Or did Schubert’s knowledge that he was dying propel an early flowering of a ‘late’ style? If so, then how can we define this style as distinct from maturity? While Schubert scholars generally agree that the composer’s style changed, there is a distinct division in how we approach such questions, the contentious issuebeingwhetheritisevenviabletospeakoflatestyleinacomposerwho died so young. Behind this debate lies the biblical belief in the timeliness of human life, where ‘lateness’ is perceived as the final phase. But is ‘lateness’ always an indication of lateness in life, or can it emerge through a recognition that the end is near? In attempting to answer this question it is important to problema- tize the ways in which biology and psychology are often co-opted to explain the imprint composers left on their art. Goethe is often recognized as the progenitor of Alterstil (old-age style) as a positive phenomenon that involved a gradual withdrawal from appearances and a consequent approach to the infinite and mystical.1 From him we derive the attributes of non-finito, subjectivity and the blending of formal with expressive ele- ments that are still widely accepted as markers of late style, as is the perception that old age can lead to transcendence. -
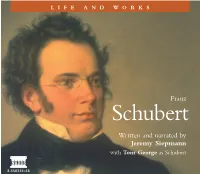
Franz Schubert Written and Narrated by Jeremy Siepmann with Tom George As Schubert
LIFE AND WORKS Franz Schubert Written and narrated by Jeremy Siepmann with Tom George as Schubert 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Preface If music is ‘about’ anything, it’s about life. No other medium can so quickly or more comprehensively lay bare the very soul of those who make or compose it. Biographies confined to the limitations of text are therefore at a serious disadvantage when it comes to the lives of composers. Only by combining verbal language with the music itself can one hope to achieve a fully rounded portrait. In the present series, the words of composers and their contemporaries are brought to life by distinguished actors in a narrative liberally spiced with musical illustrations. Unlike the standard audio portrait, the music is not used here simply for purposes of illustration within a basically narrative context. Thus we often hear very substantial chunks, and in several cases whole movements, which may be felt by some to ‘interrupt’ the story; but as its title implies the series is not just about the lives of the great composers, it is also an exploration of their works. Dismemberment of these for ‘theatrical’ effect would thus be almost sacrilegious! Likewise, the booklet is more than a complementary appendage and may be read independently, with no loss of interest or connection. Jeremy Siepmann 8.558135–38 3 Life and Works: Franz Schubert © AKG Portrait of Franz Schubert, watercolour, by Wilhelm August Rieder 8.558135–38 Life and Works: Franz Schubert Franz Schubert(1797-1828) Contents Page Track Lists 6 Cast 11 1 Historical Background: The Nineteenth Century 16 2 Schubert in His Time 26 3 The Major Works and Their Significance 41 4 A Graded Listening Plan 68 5 Recommended Reading 76 6 Personalities 82 7 A Calendar of Schubert’s Life 98 8 Glossary 132 The full spoken text can be found on the CD-ROM part of the discs and at: www.naxos.com/lifeandworks/schubert/spokentext 8.558135–38 5 Life and Works: Franz Schubert 1 Piano Quintet in A major (‘Trout’), D. -

Schubert in America: First Publications and Perf Ormances
Schubert in America: First Publications and Perf ormances f ROM THE BEETHOVEN AND ScHUBERT centennials in 1927 and 1928 to Josquin des Prez's 450th anniversary commemorated at a Festival-Conference. Lincoln Center, New York City, in June 1971, Americans have no less eagerly pressed to their bosoms the anniversaries of great European composers than have Europeans themselves. True. local color has now and then been attempted with such an article as M. D. Herter Norton's " Haydn in America (Before 1820)" in the Haydn number of The Musical Quarterly. XVIII/2 (April, 1932), 309-337, or· Otto Kinkeldey's " Beginnings of Beethoven in America" in the Beethoven number, XIII/2 (April. 1927), 217-248. However, the 1928 Schubert numbcr of the Quarter(y lacked any history what soever of first Schubert publications and performanccs in America. To rcmedy this lack, an anonymous five-page "History of Schubert Performanccs in America" was published in the Bulletin from National Headquarters Schubert Centennial. /819 Broadway. New York. Schubert Week November 18-25, 1928. lt began thus: The first written record of a Schubert work played in this country goes as far back, as 1835- sevcn ycars after thc Mastcr's death. One of New York's oldcst music publications, The American Musical Joumal. for May 1835 carries the following account. under the heading "Domestic Musical Rcport"- "Mr. Hermann gave a concert at the City Hall Thursday cvcning. April 2, 1835. Beethovcn's overture to Egmont and Weber's overture Der Freischütz were well pcrformed. Messrs. Taylor and Trust played a plcasing fantasía on the harp and flute by Franz Schubert. -

A Guide to Franz Schubert's Religious Songs
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by IUScholarWorks A GUIDE TO FRANZ SCHUBERT’S RELIGIOUS SONGS by Jason Jye-Sung Moon Submitted to the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music in Voice December 2013 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music in Voice. __________________________________ Mary Ann Hart, Chair & Research Director __________________________________ William Jon Gray __________________________________ Robert Harrison __________________________________ Brian Horne ii Copyright © 2013 by Jason Jye-Sung Moon All rights reserved iii Acknowledgements I would like to express my deepest gratitude to my committee chair and research director, Professor Mary Ann Hart, for the excellent guidance, caring, patience, and encouragement I needed to finish this long journey. I would also like to thank Dr. Brian Horne, who supported me with prayers and encouragement. He patiently corrected my writing even at the last moment. I would like to thank my good friend, Barbara Kirschner, who was with me throughout the writing process to help me by proofreading my entire document and constantly cheering me on. My family was always there for me. I thank my daughters, Christine and Joanne, my parents, and my mother-in-law for supporting me with their best wishes. My wife, Yoon Nam, deserves special thanks for standing by me with continuous prayers and care. I thank God for bring all these good people into my life. -

Reliquias Y Fragmentos De Una Sonata De Schubert
“Etc. Etc.” Reliquias y fragmentos de una sonata de Schubert Antoni Pizà Musicólogo, Director Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York Resumen. Tomando como ejemplo el caso de Reliquie, Sonata para piano en do mayor D. 840 de Schubert, este ensayo explora los entresijos que generan las obras musicales incompletas. ¿Qué diferencia hay entre un fragmento amputado y uno inacabado? ¿Qué autoridad tienen las reconstrucciones de obras incompletas? ¿Qué opciones tiene el intérprete a la hora de ejecutar esta obra? ¿Por qué nos atraen los fragmentos? La Sonata para piano en do mayor consiste en dos movimientos completos y otros dos inconclusos. Si bien algunos pianistas como Paul Badura-Skoda han grabado esta obra con su propia compleción, Sviatoslav Richter interrumpe su ejecución en el punto exacto donde termina la partitura Schubert. Su decisión se basa en la idea de que el intérprete debe respetar al máximo las intenciones del compositor. Sin embargo, al no completar el discurso musical, el pianista crea una herida sonora tan traumática que el vacío creado se convierte en otro añadido, otra compleción hecha de silencio y mudez. Paradójicamente, el hueco sonoro que deja Richter acaba siendo una intromisión mucho más intensa (y quizás más grave) que si hubiera añadido unos breves compases a la partitura. Palabras clave. Schubert; Reliquie, Sonata en Do mayor D. 840; obras incompletas; realizaciones; fragmentos; Benjamin; Schlegel, Richter. Abstract. Taking the Reliquie, Piano Sonata in C major D. 840 Schubert, this essay explores the intricacies that generate incomplete musical works. What’s the difference between a fragment where a piece has been taken away and an unfinished one? What kind of authority do the reconstructions of incomplete works have? What options has the artist while performing this work? Why do fragments attract us? The Piano Sonata in C major consists of two complete movements and two incomplete ones. -
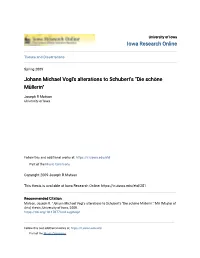
Johann Michael Vogl's Alterations to Schubert's "Die Schonë Mullerin̈ "
University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations Spring 2009 Johann Michael Vogl's alterations to Schubert's "Die schonë Mullerin̈ " Joseph R Matson University of Iowa Follow this and additional works at: https://ir.uiowa.edu/etd Part of the Music Commons Copyright 2009 Joseph R Matson This thesis is available at Iowa Research Online: https://ir.uiowa.edu/etd/251 Recommended Citation Matson, Joseph R. "Johann Michael Vogl's alterations to Schubert's "Die schonë Mullerin̈ "." MA (Master of Arts) thesis, University of Iowa, 2009. https://doi.org/10.17077/etd.xsg0v6p1 Follow this and additional works at: https://ir.uiowa.edu/etd Part of the Music Commons JOHANN MICHAEL VOGL’S ALTERATIONS TO SCHUBERT’S DIE SCHÖNE MÜLLERIN by Joseph R. Matson A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in Music in the Graduate College of The University of Iowa May 2009 Thesis Supervisor: Associate Professor Marian Wilson Kimber Copyright by JOSEPH R. MATSON 2009 All Rights Reserved Graduate College The University of Iowa Iowa City, Iowa CERTIFICATE OF APPROVAL __________________________ MASTER’S THESIS _________________ This is to certify the Master’s thesis of Joseph R. Matson has been approved by the Examining Committee for the thesis requirements for the Master of Arts degree in Music at the May 2009 graduation. Thesis Committee: ___________________________________ Marian Wilson Kimber, Thesis Supervisor ___________________________________ Christine Getz ___________________________________ Katherine Eberle ACKNOWLEDGMENTS I wish to acknowledge the support of several people. The faculty, staff, and student body in the School of Music gave me the opportunity and support to pursue my research, in spite of the flood that closed the music building in 2008. -
Wanderer” and His Music
TRIANGLES OF SOUL—SCHUBERT THE “WANDERER” AND HIS MUSIC EXPLAINED BY NEO-RIEMANNIAN GRAPHS by KANAKO ISHIHAMA A DISSERTATION Presented to the School of Music and Dance and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy September 2017 DISSERTATION APPROVAL PAGE Student: Kanako Ishihama Title: Triangles of Soul—Schubert the “Wanderer” and His Music Explained by Neo- Riemannian Graphs This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in the School of Music and Dance by: Jack Boss Chairperson Alexandre Dossin Core Member Drew Nobile Core Member Jeffrey Librett Institutional Representative and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded September 2017 ii © 2017 Kanako Ishihama This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (United States) License. iii DISSERTATION ABSTRACT Kanako Ishihama Doctor of Philosophy University of Oregon, School of Music and Dance September 2017 Title: Triangles of Soul—Schubert the “Wanderer” and His Music Explained by Neo- Riemannian Graphs In Schubert’s music, the theme “wandering” is used frequently, closely related to human life and death. I presume that, being stricken by serious illness and facing challenging relationships, Schubert lived his short life with agony and dismay, confronting the life theme “death.” In that sense, Schubert himself was probably the wanderer who kept trudging throughout his life journey. In 1822, Schubert composed the allegorical tale “My Dream,” and in that tale, he writes as follows; “when I attempted to sing of love, it turned to pain. -

Schubert and the Guitar
On the Periphery: Schubert and the Guitar Doctor of Musical Arts Essay Stony Brook University, 2015 George Benton England www.GeorgeEngland.com 2 Schubert studies have a remarkably controversial history. Peripheral to most of this scholarship is the matter of Schubert’s guitar music. With only two short works existing in manuscript form, his output for the instrument was minimal.1 Also, Schubert’s works with guitar are not typically viewed as his more advanced accomplishments. Many of the pieces that were published (read: not composed) for guitar accompaniment exemplify a very practical and commercially inclined Schubert. This Schubert created a fair amount of marketable music and tended easily to supply publishers like Anton Diabelli with the rights to his creations. These works demonstrate some of Schubert’s finest social music, which sold well in his lifetime. However commercially driven or simple these pieces may be, the inquiry into Schubert and the guitar provides us with an interesting duality: while his output of material for the instrument seems minimal, further investigation on this topic provides a more complete picture of the composer’s oeuvre. As the course of Schubert guitar scholarship has progressed in the past century, the question of claiming him as either a guitar composer or not has become moot, even passé. Thomas Heck aptly stated the question with an article in Soundboard, titled, “Schubert Lieder With Guitar…Permissible?”2 The answer to this question has been, for some time, a resounding yes! Continuing the discourse on Schubert’s works with guitar accompaniment is not only “permissible,” it is imperative. -

Considering Schubert and Nature: a Romantic Ecology
Considering Schubert and Nature: A Romantic Ecology MICHAEL FRANCIS DONOVAN A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN MUSIC YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO January 2014 © Michael Francis Donovan 2014 ii ABSTRACT Franz Schubert’s preoccupation with the nature-centric poetry of his day yielded a large body of musical landscapes and depictions of the human experience of nature. And while his songs are often associated with the “Volkstümlichkeit” of the 18th century, an aesthetic in which nature occupied a secondary role, this study underlines how Schubert would develop an idiosyncratic musical vocabulary conveying the inherently ecological nature of the texts, casting nature as a central subject in his poetic settings. The discourse of deep-ecology has reassessed the shallowness or quaintness traditionally ascribed to the Romantic view of nature, looking to the holistic view of nature in Romanticism as a template for the formulation of a contemporary deep-ecological worldview. Using experiential models of deep-ecology, namely phenomenology, embodied meaning and indigenous animism, this study revisits the archetypal Romantic wanderer’s experience of nature in Schubert’s poetic settings as an encounter between the individual and the natural world. Citing human-centric interpretations in musicological discourse, this study illustrates the need to reconsider the pivotal role of nature in seminal works of Schubert. Analyses of the choral setting of Gesang der Geister über den Wassern (D714), numerous Lieder, and the song cycle Die Winterreise uncovers the depth of Schubert’s commitment to the most forward-looking ideas on nature reflected in the philosophies of Goethe, Schiller, Schelling and Spinoza, fulfilling Friedrich Schiller’s vision for the formulation and expression of man’s place in nature in art. -

Salieri and Schubert's Early Opinion of Beethoven
Writing Under the Influence?: Salieri and Schubert's Early Opinion of Beethoven Christopher H. Gibbs To Ludwig van Beethoven From his worshipper and admirer Franz Schubert In 1822, Schubert dedicated his Variations on a French Theme for Piano Four-Hands, Op. 10 (D624) to Beethoven. This dedication was his most public and extravagant proclamation of an abiding reverence for the older master that he held until his dying day. Indeed, if Ferdinand Schubert is to be believed, his younger brother's last wish was to be buried near Beethoven, which is exactly what happened (Deutsch 1946:825). A lifelong devotion is implied in Schubert's letters' and plainly stated in the recollections of fam ily and friends. 2 The impress and challenge of Beethoven's music on Schubert's is also apparent from the start of his compositional career, and only intensified, I believe, as he matured and engaged with it ever more directly.3 Beyond purely compositional matters, Schubert modeled his pro fessional career on Beethoven's in crucial respects and benefited from his relations with many of the same performers, publishers, patrons, and crit ics who were involved with the older composer (Solomon 1979a; Gingerich 1996; Gibbs 2000). Contemporaries frequently made comparisons between their compositions; as we shall see, critics usually mentioned Beethoven when reviewing Schubert's piano and chamber works.4 While these circumstances are unsurprising-Beethoven was, after all, the preeminent composer of the time and the two men lived in the same city throughout Schubert's life-there is one sour note: Schubert's alleged hostility, early in his career, to Beethoven's music. -

Franz Schubert
1 FRANZ SCHUBERT Author Crawford Howie is a retired University music lecturer, but still active as a musicologist, writer and performer. His main interests are in 19th‐century Austrian and German music and the life and music of Schubert and Bruckner. He is chairman of the Schubert Institute in the UK, editor of its small journal or newsletter The Schubertian, and associate editor of the Bruckner Journal. Originally presented as a lecture , this document was created in 2012 and aims to (1) to place Schubert in historical context (2) to discuss music written in Vienna during Schubert’s time, and (3) to look briefly at Schubert’s sacred music. It is reprinted with permission for use by the Centrum Foundation. Centrum inserted hyperlinks to audio files below. 1. Schubert and early 19th‐century Vienna Quite a number of years ago (48 to be precise) I had the opportunity of spending two years as a postgraduate student at the Academy of Music in Vienna. By then, almost 20 years after the end of the Second World War and ten years after the end of the post‐war division of the city into four zones supervised by the Allies (American, British, French and Russian) and the re‐establishment of Austrian sovereignty in May 1955, Vienna had begun to recapture something of its glorious musical past. The two composers who symbolised this, of course, were the two who had been born and bred in Vienna – Franz Schubert (31 January 1797 – 19 November 1828) and Johann Strauss II (1825 – 1899). Whereas Strauss travelled throughout Europe with his waltz melodies, delighting audiences and becoming internationally famous, Schubert never set foot outside Austria during his all‐too‐brief life.