17. Ausgabe • 15
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
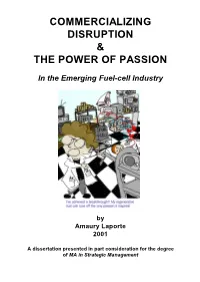
Commercializing Disruption & The
COMMERCIALIZING DISRUPTION & THE POWER OF PASSION In the Emerging Fuel-cell Industry by Amaury Laporte 2001 A dissertation presented in part consideration for the degree of MA in Strategic Management In memory of my father, François Laporte, who dedicated his life to the Third World’s development. May fuel-cells give these countries the boost they sorely need. ACKNOWLEDGMENTS I wish first of all to thank my friends and family, for their patience and their insistence that I not spend my entire summer in front of a computer screen. And a special thanks to Mortimer LeBigre for the picture! I must of course particularly thank my supervisor, Professor Joseph Lampel, for his invaluable guidance and support. Last, but by no means least, my heartfelt gratitude goes out to all those who took the time to answer my questions. I must acknowledge a particular debt to Paul McNeill, of H Power, for his insights on the question of passion. Summary It is suggested that firms commercializing disruptive innovations must address six key needs (the need for merit, the need for government support, the need for champions & visionaries, the need for cooperation, the need for niches and the need for speed) in order to achieve success. The validity of this framework is analyzed using the fuel-cell industry as a case study. The author concludes that though the first five needs are indeed present in the fuel-cell industry, their importance varies, both in relation to one another and with time. The importance of the sixth need, the need for speed, cannot yet be determined, as fuel-cells have yet to be widely commercialized. -

2021 | DURABILITÉ 1 We Put Relationships at the Center of CRM
CANADIAN-SWISS CHAMBER OF COMMERCE SUSTAINABILITY | 2021 | DURABILITÉ 1 We put relationships at the center of CRM At Nexell, we empower our clients to build better relationships with custom CRM solutions and strategic expertise. As a boutique Swiss company and Europe’s first Salesforce partner, we help businesses and nonprofits focus on their impact, not their systems. nexell.com | +41 41 511 8008 | [email protected] 2 CANADIAN-SWISS CHAMBER OF COMMERCE SUSTAINABILITY | 2021 | DURABILITÉ CONTENTS 5 PRESIDENT’S MESSAGE / MESSAGE DU PRÉSIDENT 7 A WORD FROM THE AMBASSADOR / UN MOT DE L’AMBASSADRICE 8 EDITORIAL THE CHAMBER 9 MISSION / NEW MEMBERS 10 BOARD OF DIRECTORS 11 MEMBERSHIP / CORPORATE MEMBERS 12 BUSINESS & LOCAL NEWS ARTICLES & INTERVIEWS 14 FOSTERING COLLABORATION IN GREEN TECHNOLOGIES CARBON ENGINEERING – A CANADIAN LEADER IN REMOVING CO2 16 FROM THE ATMOSPHERE 18 INTERVIEW: JOHN SAS AND THE NEXELL ANGELS 19 SUSTAINABILITY IN INVESTMENT PORTFOLIOS ABB AND BALLARD POWER SYSTEMS – COLLABORATING FOR A 20 GREENER MARITIME TRANSPORT 22 A CASE FOR A GREENER POST-PANDEMIC WORLD 24 SUSTAINABLE INVESTMENT – THE LONG VIEW 26 AN ENTREPRENEURIAL COUPLE – THE ANDERSONS 28 TWO SOULS IN ONE BODY ON A SEESAW 30 PEOPLE STORIES / HISTOIRES & PARCOURS CHAMBER INFO 32 ECONOMY, LABOR & CLIMATE STATISTICS 35 CHAMBER EVENTS 36 MEMBER PROFILE 37 LIVE & WORK IN CANADA / VIVRE & TRAVAILLER AU CANADA 38 CANADIAN-SWISS ORGANIZATIONS www.canswiss.ch OUR PARTNERS www.linkedin.com/company/can-swiss-cc/ GOLD PARTNER SILVER PARTNER www.facebook.com/canswiss.ch/ IMPRESSUM EDITOR Anne Guimond Kostecki, Tudor Iatan LAYOUT Caroline Leroux, Montrose Communications PHOTOGRAPHY CSCC Archives, Shutterstock PRINTING Imprimerie Couleurs Montagne CANADIAN-SWISS CHAMBER OF COMMERCE SUSTAINABILITY | 2021 | DURABILITÉ 3 The question isn’t whether a cyberattack will come. -

J-Fraser-Mustard-Fonds.Pdf
University of Toronto Archives J. Fraser Mustard Personal Records B2011-0010 Karen Suurtamm, 2012 Marnee Gamble, Revised 2014 Emily Sommers, revised 2019 © University of Toronto Archives and Records Management Services 2012 J. Fraser Mustard fonds University of Toronto Archives B2011-0010 TABLE OF CONTENTS Biographical sketch .............................................................................................................................................. 3 Scope and content ................................................................................................................................................. 5 Series 1: Biographical .......................................................................................................................................... 7 Series 2: Early scientific and medical career .............................................................................................. 7 Series 3: Correspondence .................................................................................................................................. 8 Series 4: Day planners ......................................................................................................................................... 9 Series 5: Travel files ............................................................................................................................................. 9 Series 6: Early presentations ........................................................................................................................ -

California Commission Energy
APRIL 1996 CALIFORNIA ENERGY COMMISSION Pete Wilson, Governor The ABCs of AFVs – A Guide to Alternative Fuel Vehicles Page – 1 Note About the Internet / PDF Version of the ABCs of AFVs… Page numbers have been changed in this Adobe Acrobat Portable Document File (PDF) format edition from Roman numerals for cover and introductory pages to Arabic numerals. They, therefore, will not agree with page numbers on the Table of Contents page. All other content remains the same. We apologize for any inconvenience. Page – 2 The ABCs of AFVs – A Guide to Alternative Fuel Vehicles The ABCs of AFVs – A Guide to Alternative Fuel Vehicles Page – 3 Lists of contacts in this document are provided as a public service by the California Energy Commission. They are not intended as an endorsement of any product, company or service. The California Energy Commission, its management and staff make no claims, implied or otherwise, about the information listed here. We apologize for any errors that may occur. The contact lists are also provided and updated on the Energy Commission’s Internet site. The address (URL) of the Commission’s Homepage is: http://www.energy.ca.gov/energy/ Please send corrections of updates via Internet e-mail to [email protected] or by regular mail to: Bob Aldrich Information Officer California Energy Commission 1516 Ninth Street, MS-29 Sacramento, CA 95814 PUBLICATION INFORMATION First Edition Printing January 9, 1995 Second Edition Printing February 10, 1995 Includes Session Summary and list of attendees of California Alternative Fuel Vehicle Partnership (CAFVP) Sympoisum, and map and list of public EV recharging facilities in California. -

R&D Strategies for New Automotive Technologies
R&D Strategies for New Automotive Technologies: Insights from Fuel Cells Patrick P. Steinemann International Motor Vehicle Program (IMVP) Massachusetts Institute of Technology November 14, 1999 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace@MIT This study benefited from extensive discussion with many managers at DaimlerChrysler, Ford Motor, and Ballard Power Systems. I wish to thank these people for valuable comments, and my advisors, Prof. John Heywood and Dr. Frank Field, for thoughtful advice and guidance. The International Motor Vehicle Program at MIT is gratefully acknowledged for supporting this research. Several companies have changed names or were acquired by another company throughout the period studied in this report. The names of the companies mentioned in the text corresponds whenever possible to the time period referred to in the text, for example Daimler-Benz until May 1998, and DaimlerChrysler thereafter. Patrick P. Steinemann International Motor Vehicle Program (IMVP) Massachusetts Institute of Technology 77 Massachusetts Ave., Building E40-242A Cambridge, MA 02139, USA Email: [email protected] 2 ABSTRACT This study analyzes how the automobile industry is pursuing the development of fuel cells as a new propulsion technology for automobiles. Fuel cells represent a fundamentally different powertrain technology that competes technically with the internal combustion engine, which has traditionally been a core competence of automobile manufacturers. The emergence of fuel cells provides a threat to automakers’ competence in internal combustion engines, but also presents an opportunity for establishing a competitive position and gaining competence in a new technology. The study gives insights into strategic issues that automakers face through fundamentally new technologies. -
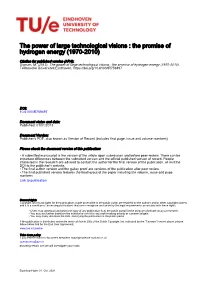
The Power of Large Technological Visions : the Promise of Hydrogen Energy (1970-2010)
The power of large technological visions : the promise of hydrogen energy (1970-2010) Citation for published version (APA): Dignum, M. (2013). The power of large technological visions : the promise of hydrogen energy (1970-2010). Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR759497 DOI: 10.6100/IR759497 Document status and date: Published: 01/01/2013 Document Version: Publisher’s PDF, also known as Version of Record (includes final page, issue and volume numbers) Please check the document version of this publication: • A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website. • The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review. • The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers. Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. -
Copyrighted Material
1 1 Introducing Fuel Cells 1.1 Historical Perspective This book is an introduction to fuel‐cell systems; it aims to provide an understanding of the technology — what it is, how it works and what are its applications. Essentially, a fuel cell can be defined as a device that produces electrical power directly from a fuel via an electrochemical process. In some respects, this operation is similar to that of a conventional battery except that the reactants are stored outside the cell. Therefore, the performance of the device is limited only by the availability of the fuel and oxidant supply and not by the cell design. For this reason, fuel cells are rated by their power output (kW) rather than by their capacity (kWh). Before addressing the technology in depth, it is necessary to understand that by virtue of being electrochemical, fuel cells have both chemical and electrical characteristics. Accordingly, their development has been inextricably linked with the development of electrochemistry as a distinct branch of physical chemistry. At the beginning of the 19th century, it was recognized that an ‘electrochemical cell’ (nowadays, commonly called a ‘battery’) could be made by placing two dissimilar metals in an aqueous salt solution. This discovery was made by Alessandro Volta, the professor of experimental physics at Pavia University, who constructed a pile of alternating discs of copper (or silver or brass) and zinc (or tin) that were separated by pasteboard discs (or ‘any other spongy matter’) soaked in brine. When the top and bottom of the pile were connected by a wire, the assembly delivered, for the first time in history, a more or less steady flow of electricity. -
Hydrogen Futures: Toward a Sustainable Energy System
International Journal of Hydrogen Energy 27 (2002) 235–264 www.elsevier.com/locate/ijhydene Hydrogen futures: toward a sustainable energy system Seth Dunn ∗ Worldwatch Institute, 1776 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20036 1904, USA Abstract Fueled by concerns about urban air pollution, energy security, and climate change, the notion of a “hydrogen economy” is moving beyond the realm of scientists and engineers and into the lexicon of political and business leaders. Interest in hydrogen, the simplest and most abundant element in the universe, is also rising due to technical advances in fuel cells — the potential successors to batteries in portable electronics, power plants, and the internal combustion engine. But where will the hydrogen come from? Government and industry, keeping one foot in the hydrocarbon economy, are pursuing an incremental route, using gasoline or methanol as the source of the hydrogen, with the fuel reformed on board vehicles. A cleaner path, deriving hydrogen from natural gas and renewable energy and using the fuel directly on board vehicles, has received signiÿcantly less support, in part because the cost of building a hydrogen infrastructure is widely viewed as prohibitively high. Yet a number of recent studies suggest that moving to the direct use of hydrogen may be much cleaner and far less expensive. Just as government played a catalytic role in the creation of the Internet, government will have an essential part in building a hydrogen economy. Research and development, incentives and regulations, and partnerships with industry have sparked isolated initiatives. But stronger public policies and educational e8orts are needed to accelerate the process. -

PDF Version of Article
AGRICULTURE CHEMICALS & MATERIALS COMMUNICATIONS COMPUTING THE ADVANCE OF TECHNOLOGY depends on many heroic ef- DEFENSE forts, not all in the laboratory. Scientists and engineers extend our understanding and control of the physical ENERGY world, while industrialists and corporations mobilize their own forces to make innovations available and ENVIRONMENT commentators and legislators shape the policies guid- MANUFACTURING ing how society uses technology. This new annual roundup, the SCIENTIFIC AMERICAN 50, honors four MEDICAL DIAGNOSTICS dozen individuals, teams and companies—selected by MEDICAL TREATMENTS the editors for their recent contributions to 12 broad categories of technological endeavor—as well as a Re- TRANSPORTATION search Leader and a Business Leader of the Year. Join us in celebrating their bright visions of the future. GENERAL TECHNOLOGY TOM DRAPER DESIGN SCIENTIFIC AMERICAN 43 COPYRIGHT 2002 SCIENTIFIC AMERICAN, INC. SCIENTIFIC AMERICAN STEPHEN GOFF, HUANMING YANG and JUN YU Goff, Syngenta’s Torrey Mesa Research Institute; Yang, Beijing Genomics Institute; and Yu, University of Washington Genome Center Vision: Deciphering the genome of rice paves the way for breakthroughs in farming humankind’s most important food staples. THE APRIL 5, 2002, ISSUE OF SCIENCE published two papers from independent laboratories that simultaneously reached a long-awaited goal: a map of the rice genome. The studies provided gene sequences—lists of genetic building blocks, called nucleotide bases, that make up an organism’s chromosomes—for two types of rice, a crop that feeds more than half the world’s population. One study, ) led by Huanming Yang and Jun Yu, unveiled a draft sequence for indica, a sub- species that is common in most of Asia. -

Fuel Cell Folly Preliminary E. R. Pat Murphy May 9, 2003
Fuel Cell Folly Preliminary E. R. Pat Murphy May 9, 2003 Table of Contents Introduction Selling the Fuel Cell The Fuel Cell Stock Market Record California Air Resources Board – EV Folly The Need for Accuracy – Oil Depletion What is a Fuel Cell What is Hydrogen Sources of Hydrogen The Fuel Cell/Hydrogen Battery System Fuel Cell Misrepresentations The Real Cost of Hydrogen – When the experts ignore data How Efficient is the Fuel Cell One “Not so Hidden” Agenda – Nuclear Power Renewables and Hydrogen Production – A Huge Risk Needed – An Objective Evaluation The Real Problem – The Consumer The Car and Values – “America’s Love Affair” Conclusion A Proposal For A Ride Share Transportation System References Fool Cell Folly Version 1 By Pat Murphy Page 1 of 1 Introduction: In the late 1990s articles about electric cars began to appear with more frequency in the media - heralded as a major societal transition from polluting internal combustion engines to “clean, emission free vehicles”. In 1997 small numbers of these “electric vehicles” (EVs) were shipped to test customers. Owner groups were formed, web sites were developed and a new exciting world of fundamental change in transportation began to be extolled in magazines and newspapers. GM shipped the EV1 in 1997. Ford bought the rights to the “Th!nk” electric car, developed by a company in Norway, and began shipping versions of that vehicle. Ford also developed a truck, the Ford Ranger EV. Honda shipped the EV Plus and Toyota the RAV4 EV. From 1997 through 2000, the EV was proposed as the solution to foreign oil dependence and environmental problems. -

Canada Archives Canada Published Heritage Direction Du Branch Patrimoine De I'edition
University of Alberta Fueling Dreams of Grandeur: Fuel Cell Research and Development and the Pursuit of the Technological Panacea, 1940-2005 by Matthew Nicholas Eisler ff+\ A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of History and Classics Edmonton, Alberta Spring 2008 Library and Bibliotheque et 1*1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-45418-3 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-45418-3 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Plntemet, prefer, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation.