Fakten Und Zahlen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

How Intercultural Experiences Created Identities of Returnees : a Comparison of Kikokushijo in the Taishou, Showa and Heisei Eras
松山大学論集 第31巻第1号抜刷 2019年4月発行 How Intercultural Experiences Created Identities of Returnees : A Comparison of kikokushijo in the Taishou, Showa and Heisei eras Kaori Ono How Intercultural Experiences Created Identities of Returnees : A Comparison of kikokushijo in the Taishou, Showa and Heisei eras Kaori Ono 228 松山大学論集 第31巻 第1号 1.Introduction Increased mobility across countries and cultures has led to a global rise in the number of sojourning children(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2016). With this change, identity negotiation of the so-called kikokushijos warrants more attention. In Japan, most of the research on sojourning children has focused on challenges encountered by kikokushijos quite extensively (Ichikawa, 2004; Kanno, 2003; Kidder, 1992; Mcdonald, 1995/2011; Miyaji, 1985;Osawa,1986; Podalsky, 2009; Pollack & Reken, 2001/2009; Sueda2012), in contrast, the dynamics of a successful reentry and the emotional factors these children experience when they transfer between schools with different cultural backgrounds during their developmental years has not received due attention. This study sought to fill this gap since a clearer understanding of this process will assist Japanese communities that accept kikokushijos to help their repatriation better. 2.Literature Review 2.1 Introduction To better understand the issues of kikokushijo[returnees]living in Japan, this paper will begin by first introducing empirical studies of cross-cultural values frequently referenced in the field of intercultural relations. Next, the term kikokushijo will be defined and the literature on previous studies of returnees will be examined. 2.2 Theories on the Adjustment of Individuals in Intercultural Contexts Berry’s acculturation model1)(Berry, 2005)explains the processes by which an individual either goes through cultural and psychological changes in an intercultural setting or actively resists such change. -

Language Learners' Beliefs: Development and Change A
LANGUAGE LEARNERS’ BELIEFS: DEVELOPMENT AND CHANGE A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education By Sakae Suzuki May, 2012 Examining Committee Members Marshall Childs, Advisory Chair, TESOL/CITE David Beglar, TESOL/CITE Mark Sawyer, External Member, Kwansai Gakuin University Tim Murphey, External Member, Kanda University of International Studies Masako Sakamoto, External Member, Bunka Gakuen University © Copyright 2012 by Sakae Suzuki iii ABSTRACT This longitudinal study was designed to provide an orderly account of how beliefs about English language learning develop among seven Japanese high school students, identify beliefs that are beneficial and interfering for language learning and the routes by which these beliefs are reached, and identify belief changes and their sources. Beliefs are defined as a cognitive representation about self and the world. They are situated in experiences and social context. Learner beliefs pertain to many aspects of language learning and come from multiple sources, including educational background, experience living overseas, peers, teachers, and persons met in chance encounters. The data for the study were collected from seven students attending a Japanese public high school. Beginning when the students were first-year high school students (10th graders), the data, which were drawn from in-depth interviews, journals, written reports, observations, and school records, form a qualitative multiple-case-study. Data gathering ended when the students chose a university in the third year of high school. There were five major findings. First, learners develop and modify their beliefs based on their life experiences inside and outside the classroom. -
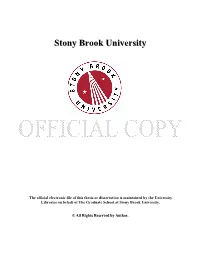
Stony Brook University
SSStttooonnnyyy BBBrrrooooookkk UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy The official electronic file of this thesis or dissertation is maintained by the University Libraries on behalf of The Graduate School at Stony Brook University. ©©© AAAllllll RRRiiiggghhhtttsss RRReeessseeerrrvvveeeddd bbbyyy AAAuuuttthhhooorrr... Mediating Trans/nationalism: Japanese ‘Jun’ai’ (Pure-Love) in Popular Media Representations A Dissertation Presented by I-Te Rita Sung to The Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Comparative Literature Stony Brook University August 2016 Stony Brook University The Graduate School I-Te Rita Sung We, the dissertation committee for the above candidate for the Doctor of Philosophy degree, hereby recommend acceptance of this dissertation. E. Ann Kaplan, Distinguished Professor, Dissertation Co-Advisor Cultural Analysis & Theory Krin Gabbard, Professor Emeritus, Dissertation Co-Advisor Cultural Analysis & Theory Jeffrey Santa Ana, Associate Professor, Chairperson of Defense Cultural Analysis & Theory and English Department Leo T.S. Ching, Outside Member, Duke University, Department of Asian and Middle Eastern Studies Aaron A. Gerow, Outside Member, Yale University, Department of East Asian Languages and Literatures This dissertation is accepted by the Graduate School Nancy Goroff Interim Dean of the Graduate School ii Abstract of the Dissertation Mediating Trans/nationalism: Japanese ‘Jun’ai’ (Pure-Love) in Popular Media Representations by I-Te Rita Sung Doctor of Philosophy in Comparative Literature Stony Brook University 2016 Since the beginning of the 21st century, the jun’ai (pure-love) genre has flourished in Japan, both in works of popular literature and in film. This phenomenon coincides with a time when the country is seen by the media as being characterized by soshitsukan (sense of loss). -

Discourse and Practice
Educational Studies in Japan: International Yearbook No. 12, March, 2018. pp. 35-48 Patterns of variations in the ‘internationalising education’ discourse and practice Kaori H. Okano* This paper examines variations and shifts of emphasis in the ‘internation- alising education’ discourse and practice, and attempts to identify patterns in these variations. By examining two sectors, compulsory education and univer- sities, it identifi es four main strands of discourse: (1) international (understand- ing) education (kokusai rikai kyôiku) in the form of engagement with other (of- ten Western) countries; (2) domestic internationalisation (uchinaru kokusaika); (3) human rights education (jinken kyôiku) for zainichi Koreans; and (4) global human resources and competitiveness in the global arena. Each of the four strands has been taken up to differing degrees, in varying combinations over time, in discussing internationalisation. The paper shows how each of these strands has made a ‘connection’ to one of the other strands, depending on the sector, the level of educational administration and specifi c local circumstances; and in so doing over time how they have lead to varying discourses and prac- tices. This advances our understanding of the discourse of ‘internationalisation’ in education as a historical product that is still a work in progress. Keywords: Internationalisation; education; Japan; multiculturalism The term kokusaika, translated into English as ‘internationalisation’, has been a catchall phrase widely used in the government, business, academic and public discourse in the last fi ve decades. It has often been interpreted differently in specifi c localities, sectors of the soci- ety (e.g., business, social welfare, education), and levels of public administration (e.g., na- tional, prefectural, municipal, township). -

Part One: the Essentials of Society: Men and Women 1
Notes PART ONE: THE ESSENTIALS OF SOCIETY: MEN AND WOMEN 1. In terms of fixed wages, Labour Ministry figures for 1994 show men to earn more than half as much again (161 per cent) as women (Asahi Shimbun Japan Almanac 1997, p. 100). After recruitment (when the gap in pay is smallest) men generally go on a ‘career escalator’, whereas women go on a ‘clerical escalator’. Career path and promotional opportunities are affected, among other things, by educational attain- ment. Whereas numerically a smaller percentage of matriculating male students (43 per cent) than female students (48 per cent) proceed to some form of tertiary education, a majority of females (52 per cent)— and almost no males (5 per cent)—merely attend a short-term junior college as opposed to a regular university, meaning that males typically have much stronger qualifications (Ministry of Education figures, in Asahi Shimbun Japan Almanac 1997, p. 240). 2. Management and Coordination Agency figures, in Asahi Shimbun Japan Almanac 1997, p. 48. 3. See for example Okonogi 86, p. 1. 4. See Smith 83, p. 128, for a vivid illustration of the often extreme degree of prioritisation of the company over self. Smith recounts an incident in 1979 when a male worker successfully tackled a robber. He had not realised that the robber was in fact armed with a knife, and when asked by the television news reporter if he would still have tackled the robber if he had known this, he replied that he wouldn’t have, because he might have been injured, had to take time off work as a result, and thereby inconvenience his company. -
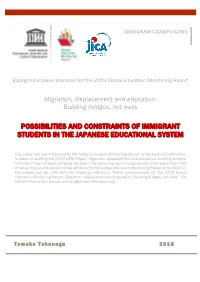
Possibilities and Constraints of Immigrant Students in the Japanese Educational System
ED/GEMR/MRT/2018/P1/41/REV Background paper prepared for the 2019 Global Education Monitoring Report Migration, displacement and education: Building bridges, not walls POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS OF IMMIGRANT STUDENTS IN THE JAPANESE EDUCATIONAL SYSTEM This paper was commissioned by the Global Education Monitoring Report as background information to assist in drafting the 2019 GEM Report, Migration, displacement and education: Building bridges, not walls. It has not been edited by the team. The views and opinions expressed in this paper are those of the author(s) and should not be attributed to the Global Education Monitoring Report or to UNESCO. The papers can be cited with the following reference: “Paper commissioned for the 2019 Global Education Monitoring Report, Migration, displacement and education: Building bridges, not walls”. For further information, please contact [email protected]. Tomoko Tokunaga 2 0 1 8 Japan has a small but increasingly visible immigrant population, especially in the context of an aging Japanese population and a declining native cohort of children. Given the lack of a national education policy, integrating immigrant children into the Japanese education system has been a challenge. Nevertheless, while educational problems such as high rates of non-attendance, low progression rates, and high dropout rates among immigrant students have been reported, there has been a gradual improvement in educational attainment as seen in the increase in the numbers of students who graduate from colleges and secure permanent jobs. The purpose of this paper is to examine the Japanese education system and its policies toward immigrant students, and to explore the educational experiences of these students by looking across ethnicity, socio-economic status, gender, and educational types and levels. -

A Descriptive Study of Japanese Biliterate Students in the United States : Bilingualism, Language-Minority Education, and Teachers' Role
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-1998 A descriptive study of Japanese biliterate students in the United States : bilingualism, language-minority education, and teachers' role. Yoshiko Nagaoka University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Nagaoka, Yoshiko, "A descriptive study of Japanese biliterate students in the United States : bilingualism, language-minority education, and teachers' role." (1998). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 5338. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/5338 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. A DESCRIPTIVE STUDY OF JAPANESE BILITERATE STUDENTS IN THE UNITED STATES: BILINGUALISM, LANGUAGE-MINORITY EDUCATION, AND TEACHERS' ROLE A Dissertation Presented by YOSHIKO NAGAOKA Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF EDUCATION September 1998 School of Education © Copyright by Yoshiko Nagaoka 1998 All Rights Reserved A DESCRIPTIVE STUDY OF JAPANESE BILITERATE STUDENTS IN THE UNITED STATES: BILINGUALISM, LANGUAGE-MINORITY EDUCATION, TEACHER'S ROLE A Dissertation Presented by YOSHIKO NAGAOKA approved as to styl4 ahd /content by i- Atron A. Gentry, Chair Robert W. Maloy, Member Charles K. Smith, Member lAJLA taifey W. Jackson, Dean SchAol of Education ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my gratitude to the chair of my dissertation committee. Dr. -

New Media and Japanese-Brazilian Return Migrants in Japan
“PARTIALLY CONNECTED, PARTIALLY PROTECTED”: NEW MEDIA AND JAPANESE-BRAZILIAN RETURN MIGRANTS IN JAPAN BY RYUTA KOMAKI DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Communications in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013 Urbana, Illinois Doctoral Committee: Professor Lisa Nakamura, Chair Professor John Nerone Associate Professor Fernando Elichirigoity Associate Professor Rayvon Fouché ii Abstract This dissertation explores the use of the internet, mobile phones and other types of new and old media by Japanese-Brazilian return migrants in Japan, who are Brazilian nationals of Japanese ancestry that migrate transnationally from Brazil to Japan to work. The study first discusses the history of Japanese-Brazilian return migration, situating it in a larger history of labor migration to Japan and the development of “flexible capitalism” in the “network society” in the contemporary world. It also examines the current state of Japanese-Brazilian and Brazilian ethnic media in Japan, and discusses the relationship between the Japanese government’s policies regarding immigration and multilingual media services and the ways in which Portuguese-language media products and services are provided to the return migrants. I argue that the government’s indifference towards social and cultural life of non-Japanese residents and its reluctance to serve informational and communicational needs of the nation’s diversifying population put the provision of multilingual and multicultural media in the hands of the private sector, which had an undesirable consequences on Japanese-Brazilian return migrants as the end users of the media as a global financial crisis damaged Japan’s economy in 2008. -

Understanding Futōkō As a Social Problem in Japan: the Social Context and Motivation for Change
ABSTRACT Understanding Futōkō as a Social Problem in Japan: The Social Context and Motivation for Change Brittany Nicole Lozano Director: Yuko Prefume, Senior Lecturer in Japanese Futōkō is a growing social issue in Japan in which students experience so much anxiety from the school environment that they become physically unable to attend, regardless of their intentions. There is much conflict behind the framing of this issue by society, academia, the media, and the government, each of which have competing interpretations about responsibility for the problem and appropriate responses to it. Reform efforts motivated in part by futōkō focus mainly on either economic interests or progressive moralist values, but there is a gap between the rhetoric and actual change resulting from political and ideological conflicts. Options available to children struggling with futōkō at present include counseling or free- schools (institutions independent from the state-mandated system), and the perspectives found within the latter are strikingly different from those reflected by the discourses, representing an inclusive, child-based approach to education that may hold valuable concepts for society as a whole. APPROVED BY DIRECTOR OF HONORS THESIS: _________________________________________________________________ Mrs. Yuko Prefume, Department of Modern Foreign Languages APPROVED BY THE HONORS PROGRAM ________________________________________________________________ Dr. Andrew Wisely, Director DATE: ________________________________ UNDERSTANDING FUTŌKŌ AS -

Political and Cultural Perspectives on Japan's Insider Minorities
Volume 3 | Issue 4 | Article ID 1723 | Apr 27, 2005 The Asia-Pacific Journal | Japan Focus Political and Cultural Perspectives on Japan's Insider Minorities Joshua Roth Political and Cultural Perspectives Fowler 1996). One might also include gender on Japan’s Insider Minorities (Nishikawa, 1997) and sexuality, as well as class, when examining Japan’s social by Joshua Hotaka Roth heterogeneity. In order to illustrate other dimensions of heterogeneity, this essay will focus on three non-ethnic minorities—the disabled, and atomic bomb victims (hibakusha), This article introduces the concept of “Insider in addition to the Burakumin descendants of minorities”, those whose difference is of a sort former outcaste groups, and three ethnic that currently does not deny their Japanese- minorities—the Ainu, Okinawans and Nikkeijin ness in the eyes of other Japanese, as opposed (Japanese immigrants to other countries and to outsider minorities, who are considered their descendants) migrants to Japan. foreign despite their long, even multi-Shared experiences of stigmatization and generational, residence within Japan. Most discrimination justify considering this diverse surveys of minorities in Japan have focused on set of minorities together. In some cases, ethnic minorities, including Koreans and discrimination may throw minorities together Chinese, as well as the indigenous Ainu and spatially as they are marginalized in certain Okinawans. The Burakumin ends up being the urban or rural districts. In a Burakumin only non-ethnic group to be included (see De neighborhood of Kyoto reside a large number Vos and Wagatsuma, 1995; Weiner, 1997; of disabled people who are not Burakumin Ohnuki-Tierney, 1998). Such a focus on ethnic (Caron, 1999, p.436). -

Japanese Sojourners Learning English: Language Ideologies And
Japanese Sojourners Learning English: Language Ideologies and Identity among Middle School Students DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Hiroshi Shima Graduate Program in Education The Ohio State University 2011 Dissertation Committee: Marcia Farr, Advisor Keiko Samimy Mari Haneda Copyrighted by Hiroshi Shima 2011 Abstract Employing Bronfenbrenner‘s (1979) ecological model of development, this ethnographic study investigated six Japanese middle school expatriate students in the United States (4 boys and 2 girls) from Autumn 2009 to Spring 2010 to better understand their linguistic environment, their beliefs and values in English, and how those beliefs and values were nurtured. All the students stayed in the host country for more than three years and they were all toward the end of their sojourn in America. In order to qualitatively reveal how the students learned and used English, and what views they had toward English, weekly interviews with the students inquired about their social networks and access to linguistic resources such as textbooks and television. At the same time, I visited one of the students‘ schools to investigate how he was socialized to use English during casual conversations with his peers at the lunch table. The first half of this study is based on the interviews to describe the Japanese students‘ linguistic environment. The environment where the students used English was broadly divided into four domains: home, school, peer, and media. Despite overlap across domains, the students‘ typical use of English and their values in language showed distinct features in each domain. -
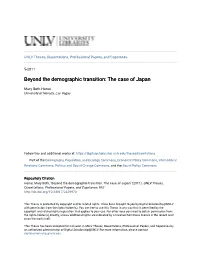
Beyond the Demographic Transition: the Case of Japan
UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones 5-2011 Beyond the demographic transition: The case of Japan Mary Beth Horiai University of Nevada, Las Vegas Follow this and additional works at: https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations Part of the Demography, Population, and Ecology Commons, Economic Policy Commons, International Relations Commons, Politics and Social Change Commons, and the Social Policy Commons Repository Citation Horiai, Mary Beth, "Beyond the demographic transition: The case of Japan" (2011). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 987. http://dx.doi.org/10.34917/2329970 This Thesis is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Scholarship@UNLV with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Thesis in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Thesis has been accepted for inclusion in UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones by an authorized administrator of Digital Scholarship@UNLV. For more information, please contact [email protected]. BEYOND THE DEMOGRAPHIC TRANSITION: THE CASE OF JAPAN by Mary Beth Horiai Bachelor of Arts University of Nevada, Las Vegas 2009 A thesis document submitted in partial fulfillment of the requirements