Deutscher Bundestag Unterrichtung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Results Displayed in This Document Are Preliminary and Do Not Represent a Validated Or Finalized Result of the New Gtld Prioritization Draw
The results displayed in this document are preliminary and do not represent a validated or finalized result of the New gTLD Prioritization Draw. These preliminary results are provided for information only and should not be relied upon for any purpose. Final results will be posted on ICANN's website at http://gtldresult.icann.org/application- result/applicationstatus within 24 hours of the end of the Draw. Priority # App-ID Applicant Name String Pontificium Consilium de Comunicationibus Socialibus 1 1-1311-58570 (PCCS) (Pontifical Council for Social Communication) 天主教 2 1-1318-83013 Amazon EU S.à r.l. ストア شبكة .International Domain Registry Pty. Ltd 1-1926-49360 3 4 1-940-19689 Shangri‐La International Hotel Management Limited 香格里拉 5 1-914-3594 CITIC Group Corporation 中信 6 1-862-29948 CORE Association онлайн 7 1-848-71299 Temasek Holdings (Private) Limtied 淡马锡 8 1-1708-19635 Stable Tone Limited 世界 9 1-862-90073 CORE Association сайт 10 1-928-73202 Kerry Trading Co. Limited 嘉里大酒店 11 1-1490-59840 Wild Island, LLC 商店 12 1-1318-40887 Amazon EU S.à r.l. ファッション كيوتل (Qatar Telecom (Qtel 1-1928-24515 13 موزايك (Qatar Telecom (Qtel 1-1930-13222 14 15 1-994-51307 Top Level Domain Holdings Limited 网址 16 1-1254-52569 VeriSign Sarl 大拿 17 1-2102-26509 Global eCommerce TLD Asia Limited 网店 18 1-955-42062 SAMSUNG SDS CO., LTD 삼성 19 1-1244-37294 Wal-Mart Stores, Inc. 一号店 20 1-1254-86222 VeriSign Sarl 點看 21 1-859-69634 Zodiac Scorpio Limited 八卦 22 1-904-60726 Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG vermögensberater 23 1-962-55795 Eagle Horizon Limited 集团 24 1-1318-83995 Amazon EU S.à r.l. -

Prospectus Dated 12 March 2013 KONINKLIJKE KPN N.V
Prospectus dated 12 March 2013 KONINKLIJKE KPN N.V. (Incorporated in The Netherlands as a public limited company with its corporate seat in The Hague) €1,100,000,000 Perpetual Capital Securities £400,000,000 Capital Securities due 2073 ______________________________________ Issue Price: 99.478% per cent. in respect of the Euro Securities 99.326% per cent. in respect of the Sterling Securities ______________________________________ The €1,100,000,000 Perpetual Capital Securities (the Euro Securities) and the £400,000,000 Capital Securities due 2073 (the Sterling Securities, and together with the Euro Securities, collectively referred to as the Securities, and each referred to as a Tranche) will be issued by Koninklijke KPN N.V. (the Issuer) on 14 March 2013 (the Issue Date). The offering of the Euro Securities and Sterling Securities is referred to as the Offering. The Euro Securities will bear interest on their principal amount from (and including) the Issue Date to (but excluding) 14 September 2018 (the First Euro Reset Date) at a rate of 6.125 per cent. per annum, payable annually in arrear on 14 September in each year, except that the first payment of interest, to be made on 14 September 2013, will be in respect of the period from (and including) the Issue Date to (but excluding) 14 September 2013 and will amount to €30.88 per €1,000 in principal amount of the Euro Securities. Thereafter, unless previously redeemed, the Euro Securities will bear interest from (and including) 14 September 2018 to (but excluding) 14 September 2023 at a rate per annum which shall be 5.202 per cent. -
Unitymedia Kabel Deutschland Kabel BW Netcologne Kabelkiosk 1-2-3.Tv
Unitymedia Kabel Deutschland Kabel BW Netcologne KabelKiosk 1-2-3.tv Digital TV BASIC Kabel Digital Free FtA FtA n/a Digital TV PLUS Kabel Digital Home Kabel Digital Home Familie th KabelKiosk Family XL 13 Street Premiere Familie Premiere Familie Premiere Familie Premiere Familie 3Sat FtA FtA FtA FtA n/a 4 Music n/a n/a FtA n/a n/a 9Live Digital TV BASIC Kabel Digital Free FtA FtA KabelKiosk Basis Adult Channel n/a n/a n/a Familie KabelKiosk Sports Al Auola Inter n/a n/a FtA n/a n/a Al Jazeera (arabisch) Digital TV BONUS n/a FtA FtA n/a Al Jazeera Children's (arabisch) n/a n/a FtA FtA n/a Al Jazeera International (englisch) Digital TV BASIC Kabel Digital Free FtA FtA n/a Al-Safwa n/a n/a n/a n/a Arabisch Al-Yawn n/a n/a n/a n/a Arabisch Alpenglühen TVX n/a n/a Männer Paket n/a n/a Alsat n/a n/a Albanien n/a n/a Animal Planet Premiere Familie Premiere Familie Premiere Familie Premiere Familie n/a Animax Digital TV PLUS Kabel Digital Home Kabel Digital Home n/a n/a Anixe HD n/a FtA FtA FtA n/a Anixe SD Digital TV BASIC Kabel Digital Free FtA FtA n/a ANN n/a Kabel Digital Free n/a n/a n/a Arirang TV n/a n/a FtA n/a n/a ART Hekayat (arabisch) Digital TV Arabisch n/a n/a n/a n/a ART Movie 1 (arabisch) Digital TV Arabisch n/a n/a n/a n/a ART Prime Sport (arabisch) Digital TV Arabisch n/a n/a n/a n/a arte FtA FtA FtA FtA n/a Astra HD+ n/a n/a n/a FtA n/a Astro TV Digital TV BASIC Kabel Digital Free FtA FtA n/a Digital TV Türkei Kabel Digital Türkisch Türkisch Türkisch Unterhaltung Türkisch Basis ATV Avrupa Digital TV Türkei Premium Kabel Digital -
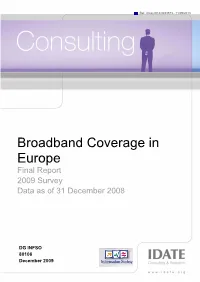
Broadband Coverage in Europe Final Report 2009 Survey Data As of 31 December 2008
Ref. Ares(2013)3033573 - 11/09/2013 Broadband Coverage in Europe Final Report 2009 Survey Data as of 31 December 2008 DG INFSO 80106 December 2009 IDATE 1 Development of Broadband Access in Europe Table of contents 1. Methodological notes .......................................................................................................................................5 2. Executive summary ..........................................................................................................................................7 3. European benchmark .......................................................................................................................................9 3.1. EU-27 + Norway & Iceland at the end of 2008........................................................................................ 9 3.1.1. Fixed broadband subscriber bases and penetration.................................................................... 9 3.1.2. DSL coverage and penetration.................................................................................................. 11 3.1.3. Cable modem coverage and penetration .................................................................................. 18 3.1.4. FTTH subscribers...................................................................................................................... 24 3.1.5. Satellite solutions ...................................................................................................................... 25 3.1.6. 3G coverage and take-up......................................................................................................... -

Creating a Brighter Future
Creating a brighter future CASE STUDIES COLLECTION FTTH COUNCIL EUROPE — February 2015 www.ftthcouncil.eu CASE STUDIES COLLECTION INDEX ANDORRA • THE FTTH CASE STUDY OF ANDORRA TELECOM 4 AUSTRIA • THE FTTH CASE STUDY OF ARGE GLASFASER WALDVIERTEL 6 DENMARK • THE FTTH CASE STUDY OF WAOO! 8 FINLAND • THE FTTH CASE STUDY OF OSTROBOTHNIA 10 • THE FTTH CASE STUDY OF SUUPOHJA 12 FRANCE • THE FTTH CASE STUDY OF PAU PYRENEES 14 • THE FTTH CASE STUDY OF PAYS CHARTRAIN 16 GERMANY • THE FTTH CASE STUDY OF BORNET 18 • THE FTTH CASE STUDY OF M-NET 20 • THE FTTH CASE STUDY OF NETCOLOGNE 22 • THE FTTH CASE STUDY OF OBERHAUSEN 24 • THE FTTH CASE STUDY OF SASBACHWALDEN 26 HUNGARY • THE FTTH CASE STUDY OF BÓLY CITY 28 ITALY • THE FTTH CASE STUDY OF FASTWEB 30 LATVIA • THE FTTH CASE STUDY OF LATTELECOM 32 LITHUANIA • THE FTTH CASE STUDY OF TEO 34 LUXEMBOURG • THE FTTH CASE STUDY OF P&T LUXEMBOURG 36 www.ftthcouncil.eu CASE STUDIES COLLECTION INDEX MACEDONIA • THE FTTH CASE STUDY OF MAKEDONSKI TELEKOM 38 THE NETHERLANDS • THE FTTH CASE STUDY OF AMSTERDAM CITYNET 40 NORWAY • THE FTTH CASE STUDY OF ALTIBOX 42 • THE FTTH CASE STUDY OF ATB NETT 44 • THE FTTH CASE STUDY OF IT-NORRBOTTEN 46 PORTUGAL • THE FTTH CASE STUDY OF PORTUGAL TELECOM 48 RUSSIA • THE FTTH CASE STUDY OF ER-TELECOM 50 SPAIN • THE FTTH CASE STUDY OF RED ASTURCÓN 52 SWEDEN • THE FTTH CASE STUDY OF SKANOVA 54 • THE FTTH CASE STUDY OF STADSNÄT I SVEALAND 56 • THE FTTH CASE STUDY OF STOKAB 58 SWITZERLAND • THE FTTH CASE STUDY OF SWISSCOM 60 • THE FTTH CASE STUDY OF OBERWALLIS 62 UK • THE FTTH CASE STUDY OF CITYFIBRE BOURNEMOUTH 64 • THE FTTH CASE STUDY OF HYPEROPTIC 66 • THE FTTH CASE STUDY OF JT (JERSEY TELECOM) 68 • THE FTTH CASE STUDY OF KC LIGHTSTREAM 70 • THE FTTH CASE STUDY OF WWHC CAMBUSLANG 72 www.ftthcouncil.eu www.ftthcouncil.eu FTTH CASE STUDY Andorra Telecom Small country, FTTH world leader Andorra’s commitment to universal ultra-fast broadband for all citizens has paid impressive dividends over a short period. -

International Media and Communication Statistics 2010
N O R D I C M E D I A T R E N D S 1 2 A Sampler of International Media and Communication Statistics 2010 Compiled by Sara Leckner & Ulrika Facht N O R D I C O M Nordic Media Trends 12 A Sampler of International Media and Communication Statistics 2010 COMPILED BY: Sara LECKNER and Ulrika FACHT The Nordic Ministers of Culture have made globalization one of their top priorities, unified in the strategy Creativity – the Nordic Response to Globalization. The aim is to create a more prosperous Nordic Region. This publication is part of this strategy. ISSN 1401-0410 ISBN 978-91-86523-15-2 PUBLISHED BY: NORDICOM University of Gothenburg P O Box 713 SE 405 30 GÖTEBORG Sweden EDITOR NORDIC MEDIA TRENDS: Ulla CARLSSON COVER BY: Roger PALMQVIST Contents Abbrevations 6 Foreword 7 Introduction 9 List of tables & figures 11 Internet in the world 19 ICT 21 The Internet market 22 Computers 32 Internet sites & hosts 33 Languages 36 Internet access 37 Internet use 38 Fixed & mobile telephony 51 Internet by region 63 Africa 65 North & South America 75 Asia & the Pacific 85 Europe 95 Commonwealth of Independent States – CIS 110 Middle East 113 Television in the world 119 The TV market 121 TV access & distribution 127 TV viewing 139 Television by region 143 Africa 145 North & South America 149 Asia & the Pacific 157 Europe 163 Middle East 189 Radio in the world 197 Channels 199 Digital radio 202 Revenues 203 Access 206 Listening 207 Newspapers in the world 211 Top ten titles 213 Language 214 Free dailes 215 Paid-for newspapers 217 Paid-for dailies 218 Revenues & costs 230 Reading 233 References 235 5 Abbreviations General terms . -

Teleliberalisation in Denmark
Table of contents 1. History of the Danish Telecommunications Sector 2. Relevance of the Case - Politics - Literature - Daily news - To ourselves 3. Market overview Teleliberalisation- Real players in Denmark - Interesting small players 4. The Telia case - Company overview - Position in the market - Market strategy 5. Has Telia learned from NetCologne? - Pilot project in Ørestad 6. Conclusion 7. Further activities a. References and literature b. Glossary c. Supplementary statistics Frontpage Birds view to Ørestad, 1999. Ørestad covers an area of 0.6x5 km on Amager Fælled. It extends from Copenhagen University, Amager in the North to the control centre for the planned Metro, south of the motorway to Kastrup Airport and the Øresund bridge. It is anticipated that Ørestad will be fully developed by 2036 in the following way: 20% culture and service 20% housing 60% business. As from August 2002 The IT University of Copenhagen will be situated in the north-east part of the area. Per B. Rasmussen Per B. Rasmussen StudiesPer B. in Rasmussen e-commerce Studies in e-commerce Teleliberalization in Denmark Studies in e-commerce 1999 Studies in e-commerce One of the most interesting e-commerce cases between the 6 main cases discussed during the fall semester 1999 on the e-commerce line at the IT University in Copenhagen was the NetCologne case [1]. To me it raised the question: Would it be possible to transfer the successful outcome of the German case to Denmark? Taking my background in the recent liberalization of the Danish telecommunications sector I decided to explore the possibilities of Danish companies to use this new challenge to promote the e-commerce on the global Internet market, and also to look into the future development of the Danish Internet sector. -
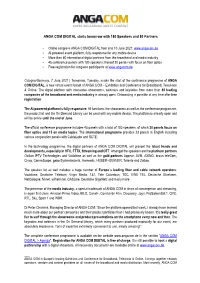
21-06-07 PM ANGA COM DIGITAL Startet Mit Glasfaser- Und
ANGA COM DIGITAL starts tomorrow with 180 Speakers and 80 Partners • Online congress ANGA COM DIGITAL from 8 to 10 June 2021: www.angacom.de • AI-powered event platform, fully-responsive for any mobile device • More than 80 international digital partners from the broadband and media industry • 45 conference panels with 180 speakers; thereof 20 panels with focus on fiber optics • Free registration for congress participants at www.angacom.de Cologne/Germany, 7 June 2021 | Tomorrow, Tuesday, marks the start of the conference programme of ANGA COM DIGITAL , a new virtual event format of ANGA COM – Exhibition and Conference for Broadband, Television & Online. The digital platform with interactive showrooms, webinars and keynotes from more than 80 leading companies of the broadband and media industry is already open. Onboarding is possible at any time after free registration . The AI-powered platform is fully responsive . All functions, the showrooms as well as the conference programme, the product list and the On Demand Library can be used with any mobile device. The platform is already open and will be online until the end of June . The official conference programme includes 45 panels with a total of 180 speakers, of which 20 panels focus on fiber optics and 15 on media topics . The international programme provides 23 panels in English including various cooperation panels with CableLabs and SCTE. In the technology programme, the digital partners of ANGA COM DIGITAL will present the latest trends and developments, especially in HFC, FTTX, Streaming and OTT . Amongst the speakers are the platinum partners Ocilion IPTV Technologies and Vodafone as well as the gold partners Appear, AVM, AXING, braun teleCom, Cisco, CommScope, gabo Systemtechnik, Harmonic, HUBER+SUHNER, Teleste and Zattoo. -
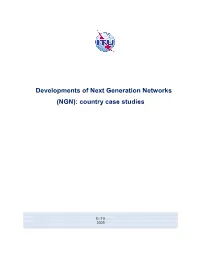
NGN): Country Case Studies
Developments of Next Generation Networks (NGN): country case studies © ITU 2009 ACKNOWLEDGEMENTS This report was prepared by Dr. Vaiva Lazauskaite, RME/BDT. © ITU 2009 International Telecommunication Union (ITU), Geneva All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, by any means whatsoever, without the prior written permission of ITU. Denominations and classifications employed in this publication do not imply any opinion on the part of the International Telecommunication Union concerning the legal or other status of any territory or any endorsement or acceptance of any boundary. Where the designation ―country‖ appears in this publication, it covers countries and territories. The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions of ITU or of its membership. Please consider the environment before printing this report. 2 TABLE OF CONTENTS 1. Introduction ............................................................................................................................ 5 2. What are NGNs? How do we understand NGNs? .............................................................. 6 3. Overview of VoIP, IPTV and FTTH markets ....................................................................... 10 4. NGN in Europe ...................................................................................................................... 13 4.1. Austria ...................................................................................................................... -

HDTV in Germany: Lack of Innovation Management Leads to Market Failure
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Erber, Georg; Heitzler, Sven Article HDTV in Germany: Lack of Innovation Management Leads to Market Failure Weekly Report Provided in Cooperation with: German Institute for Economic Research (DIW Berlin) Suggested Citation: Erber, Georg; Heitzler, Sven (2010) : HDTV in Germany: Lack of Innovation Management Leads to Market Failure, Weekly Report, ISSN 1860-3343, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, Vol. 6, Iss. 28, pp. 215-222 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/151103 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu German Institute No. 28/2010 for Economic Research Volume 6 September 8, 2010 www.diw.de Weekly Report HDTV in Germany: Lack of Innovation Management Leads to Market Failure High definition television may now be poised for a breakthrough in Germany. -
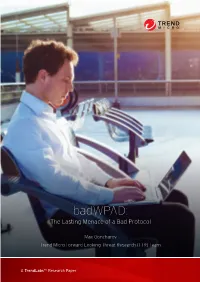
Badwpad: the Lasting Menace of a Bad Protocol
badWPAD: The Lasting Menace of a Bad Protocol Max Goncharov Trend Micro Forward-Looking Threat Research (FTR) Team A TrendLabsSM Research Paper TREND MICRO LEGAL DISCLAIMER The information provided herein is for general information Contents and educational purposes only. It is not intended and should not be construed to constitute legal advice. The information contained herein may not be applicable to all situations and may not reflect the most current situation. Nothing contained herein should be relied on or acted upon without the benefit of legal advice based on the 4 particular facts and circumstances presented and nothing herein should be construed otherwise. Trend Micro What is WPAD? reserves the right to modify the contents of this document at any time without prior notice. Translations of any material into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to 8 the original language official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are badWPAD Attacks not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Although Trend Micro uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information herein, Trend Micro makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency, or completeness. You agree 13 that access to and use of and reliance on this document and the content thereof is at your own risk. Trend Micro Our WPAD Experiment disclaims all warranties of any kind, express or implied. Neither Trend Micro nor any party involved in creating, producing, or delivering this document shall be liable for any consequence, loss, or damage, including direct, indirect, special, consequential, loss of business profits, or special damages, whatsoever arising out of access to, use of, or inability to use, or in connection with the use of 21 this document, or any errors or omissions in the content thereof. -

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) Q4 2019 Earnings Call
Formatted Report 19-Feb-2020 Deutsche Telekom AG (DTE.DE) Q4 2019 Earnings Call Total Pages: 32 1-877-FACTSET www.callstreet.com Copyright © 2001-2020 FactSet CallStreet, LLC Deutsche Telekom AG (DTE.DE) Formatted Report Q4 2019 Earnings Call 19-Feb-2020 CORPORATE PARTICIPANTS Timotheus Höttges Hannes C. Wittig Chief Executive Officer Senior Vice President, Investor Relations Christian P. Illek Chief Financial Officer ..................................................................................................................................................................................................................................................................... OTHER PARTICIPANTS Akhil Dattani James Ratzer JPMorgan Securities Plc New Street Research LLP Polo Tang Ulrich Rathe UBS AG (London Branch) Jefferies International Ltd. Christian Fangmann Robert Grindle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Deutsche Bank AG Georgios Ierodiaconou Joshua Mills Citigroup Global Markets Ltd. Exane SA (United Kingdom) Steve Malcolm Ottavio Adorisio Redburn (Europe) Ltd. Société Générale SA (UK) Frederic Boulan Bank of America Merrill Lynch 2 1-877-FACTSET www.callstreet.com Copyright © 2001-2020 FactSet CallStreet, LLC Deutsche Telekom AG (DTE.DE) Formatted Report Q4 2019 Earnings Call 19-Feb-2020 MANAGEMENT DISCUSSION SECTION Timotheus Höttges Chief Executive Officer BUSINESS HIGHLIGHTS .............................................................................................................................................................................................