Zur Evolution Und Verbreitungsgeschichte Der Suidae (Artiodactyla, Mammalia) 321-342 © Biodiversity Heritage Library
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
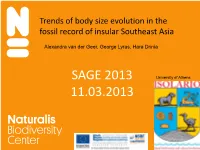
Stegodon Florensis Insularis
Trends of body size evolution in the fossil record of insular Southeast Asia Alexandra van der Geer, George Lyras, Hara Drinia SAGE 2013 University of Athens 11.03.2013 Aim of our project Isolario: morphological changes in insular endemics the impact of humans on endemic island species (and vice versa) Study especially episodes IV to VI Applied to South East Asia First of all, which fossil, pre-Holocene faunas are known from this area? Note: fossil faunas are often incomplete (fossilization is a rare process), and taxonomy of fossil species is necessarily less diverse because morphological distinctions based on coat color and pattern, tail tuft, vocalizations, genetic composition etc do not play a role © Hoe dieren op eilanden evolueren; Veen Magazines, 2009 Java Unbalanced fauna (typical island fauna Java, Early Pleistocene with hippos, deer and elephants), ‘swampy’ (pollen studies) Faunal level: Satir (Bumiayu area) Only endemics (on the species level) Fossils: Mastodon (Sinomastodon bumiajuensis) Dwarf hippo (small Hexaprotodon sivajavanicus, aka H. simplex) Deer (indet) Giant tortoise (Colossochelys) ? Tree-mouse? (Chiropodomys) Sinomastodon bumiajuensis ?pygmy stegodont? (isolated, Hexaprotodon sivajavanicus (= H simplex) scattered findings: Sambungmacan, Cirebon, Carian, Jetis), Stegodon hypsilophus of Hooijer 1954 Maybe also Stegoloxodon indonesicus from Ci Panggloseran (Bumiayu area) Progressively more balanced, marginally Java, Middle Pleistocene impovered (‘filtered’) faunas (mainland- like), Homo erectus – Stegodon faunas, Faunal levels: Ci Saat - Trinil HK– Kedung Brubus “dry, open woodland” – Ngandong Endemics on (sub)species level, strongly related to ‘Siwaliks’ fauna of India Fossils: Homo erectus, large and small herbivores (Bubalus, Bibos, Axis, Muntiacus, Tapirus, Duboisia santeng Duboisia, Elephas, Stegodon, Rhinoceros 2x), large and small carnivores (Pachycrocuta, Axis lydekkeri Panthera 2x, Mececyon, Lutrogale 2x), pigs (Sus 2x), Macaca, rodents (Hystrix Elephas hysudrindicus brachyura, Maxomys, five (!) native Rattus species), birds (e.g. -

Catalogue Palaeontology Vertebrates (Updated July 2020)
Hermann L. Strack Livres Anciens - Antiquarian Bookdealer - Antiquariaat Histoire Naturelle - Sciences - Médecine - Voyages Sciences - Natural History - Medicine - Travel Wetenschappen - Natuurlijke Historie - Medisch - Reizen Porzh Hervé - 22780 Loguivy Plougras - Bretagne - France Tel.: +33-(0)679439230 - email: [email protected] site: www.strackbooks.nl Dear friends and customers, I am pleased to present my new catalogue. Most of my book stock contains many rare and seldom offered items. I hope you will find something of interest in this catalogue, otherwise I am in the position to search any book you find difficult to obtain. Please send me your want list. I am always interested in buying books, journals or even whole libraries on all fields of science (zoology, botany, geology, medicine, archaeology, physics etc.). Please offer me your duplicates. Terms of sale and delivery: We accept orders by mail, telephone or e-mail. All items are offered subject to prior sale. Please do not forget to mention the unique item number when ordering books. Prices are in Euro. Postage, handling and bank costs are charged extra. Books are sent by surface mail (unless we are instructed otherwise) upon receipt of payment. Confirmed orders are reserved for 30 days. If payment is not received within that period, we are in liberty to sell those items to other customers. Return policy: Books may be returned within 14 days, provided we are notified in advance and that the books are well packed and still in good condition. Catalogue Palaeontology Vertebrates (Updated July 2020) Archaeology AE11189 ROSSI, M.S. DE, 1867. € 80,00 Rapporto sugli studi e sulle scoperte paleoetnologiche nel bacino della campagna romana del Cav. -

Chapter 1 - Introduction
EURASIAN MIDDLE AND LATE MIOCENE HOMINOID PALEOBIOGEOGRAPHY AND THE GEOGRAPHIC ORIGINS OF THE HOMININAE by Mariam C. Nargolwalla A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of Anthropology University of Toronto © Copyright by M. Nargolwalla (2009) Eurasian Middle and Late Miocene Hominoid Paleobiogeography and the Geographic Origins of the Homininae Mariam C. Nargolwalla Doctor of Philosophy Department of Anthropology University of Toronto 2009 Abstract The origin and diversification of great apes and humans is among the most researched and debated series of events in the evolutionary history of the Primates. A fundamental part of understanding these events involves reconstructing paleoenvironmental and paleogeographic patterns in the Eurasian Miocene; a time period and geographic expanse rich in evidence of lineage origins and dispersals of numerous mammalian lineages, including apes. Traditionally, the geographic origin of the African ape and human lineage is considered to have occurred in Africa, however, an alternative hypothesis favouring a Eurasian origin has been proposed. This hypothesis suggests that that after an initial dispersal from Africa to Eurasia at ~17Ma and subsequent radiation from Spain to China, fossil apes disperse back to Africa at least once and found the African ape and human lineage in the late Miocene. The purpose of this study is to test the Eurasian origin hypothesis through the analysis of spatial and temporal patterns of distribution, in situ evolution, interprovincial and intercontinental dispersals of Eurasian terrestrial mammals in response to environmental factors. Using the NOW and Paleobiology databases, together with data collected through survey and excavation of middle and late Miocene vertebrate localities in Hungary and Romania, taphonomic bias and sampling completeness of Eurasian faunas are assessed. -

Zeitschrift Für Säugetierkunde)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mammalian Biology (früher Zeitschrift für Säugetierkunde) Jahr/Year: 1974 Band/Volume: 40 Autor(en)/Author(s): Azzaroli A. Artikel/Article: Remarks on the Pliocene Suidae of Europe 355-367 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/ Remarks on the Pliocene Suidae of Europe 355 Sharma, R.; Raman, R. (1971): Chromosomes of a few species of Rodents of Indian Sub- continent. Mammal. Chromos. Newsletter 12, 112 — 115. Vinogradov, B. S.; Argiropulo, A. I. (1941): Fauna of the U.S.S.R. Mammals. Key to Rodents. Moskau. Übersetzt aus dem Russischen durch IPST Jerusalem 1968. Weigel, I. (1969): Systematische Übersicht über die Insektenfresser und Nager Nepals nebst Bemerkungen zur Tiergeographie. Khumbu Himal; Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal-Himalaya 3, 149—196. Yosida, T. H.; Kato, H.; Tsuchiya, K.; Sagai, T.; Moriwaki, K. (1974): Cytogenetical Survey of Black Rats, Rattus rattus, in Southwest and Central Asia, with Special Regard to the Evolutional Relationship between Three Geographical Types. Chromosoma 45, 99—109. Anschriften der Verfasser: Prof. Dr. Jochen Niethammer, Zoologisches Institut der Universi- tät, D - 53 Bonn, Poppelsdorfer Schloß; Prof. Dr. Jochen Mar- tens, Instiut für Zoologie der Johannes Gutenberg-Universität, D - 65 Mainz, Saarstraße 21 Remarks on the Pliocene Suidae of Europe By A. Azzaroli Receipt of Ms. 3. 2. 1975 Stratigraphical notes The continental stages equivalent to the Pliocene are the Ruscinian (Tobien 1970; = "zone de Perpignan" of Thaler 1966) and the Early Villifranchian (Azzaroli 1970; Azzaroli and Vialli 1971). Tobien inserted a "Csarnotian" between the Ruscinian and the Early Villafranchian, but it is doubtful that this stage is really distinct from the Ruscinian, although the latter may be subdivided into smaller faunal zones. -

71St Annual Meeting Society of Vertebrate Paleontology Paris Las Vegas Las Vegas, Nevada, USA November 2 – 5, 2011 SESSION CONCURRENT SESSION CONCURRENT
ISSN 1937-2809 online Journal of Supplement to the November 2011 Vertebrate Paleontology Vertebrate Society of Vertebrate Paleontology Society of Vertebrate 71st Annual Meeting Paleontology Society of Vertebrate Las Vegas Paris Nevada, USA Las Vegas, November 2 – 5, 2011 Program and Abstracts Society of Vertebrate Paleontology 71st Annual Meeting Program and Abstracts COMMITTEE MEETING ROOM POSTER SESSION/ CONCURRENT CONCURRENT SESSION EXHIBITS SESSION COMMITTEE MEETING ROOMS AUCTION EVENT REGISTRATION, CONCURRENT MERCHANDISE SESSION LOUNGE, EDUCATION & OUTREACH SPEAKER READY COMMITTEE MEETING POSTER SESSION ROOM ROOM SOCIETY OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY ABSTRACTS OF PAPERS SEVENTY-FIRST ANNUAL MEETING PARIS LAS VEGAS HOTEL LAS VEGAS, NV, USA NOVEMBER 2–5, 2011 HOST COMMITTEE Stephen Rowland, Co-Chair; Aubrey Bonde, Co-Chair; Joshua Bonde; David Elliott; Lee Hall; Jerry Harris; Andrew Milner; Eric Roberts EXECUTIVE COMMITTEE Philip Currie, President; Blaire Van Valkenburgh, Past President; Catherine Forster, Vice President; Christopher Bell, Secretary; Ted Vlamis, Treasurer; Julia Clarke, Member at Large; Kristina Curry Rogers, Member at Large; Lars Werdelin, Member at Large SYMPOSIUM CONVENORS Roger B.J. Benson, Richard J. Butler, Nadia B. Fröbisch, Hans C.E. Larsson, Mark A. Loewen, Philip D. Mannion, Jim I. Mead, Eric M. Roberts, Scott D. Sampson, Eric D. Scott, Kathleen Springer PROGRAM COMMITTEE Jonathan Bloch, Co-Chair; Anjali Goswami, Co-Chair; Jason Anderson; Paul Barrett; Brian Beatty; Kerin Claeson; Kristina Curry Rogers; Ted Daeschler; David Evans; David Fox; Nadia B. Fröbisch; Christian Kammerer; Johannes Müller; Emily Rayfield; William Sanders; Bruce Shockey; Mary Silcox; Michelle Stocker; Rebecca Terry November 2011—PROGRAM AND ABSTRACTS 1 Members and Friends of the Society of Vertebrate Paleontology, The Host Committee cordially welcomes you to the 71st Annual Meeting of the Society of Vertebrate Paleontology in Las Vegas. -

Propotamochoerus Provincialis (Gervais, 1859) (Suidae, Mammalia)
Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 50 (1), 2011, 29-34. Modena, 1 luglio 201129 Propotamochoerus provincialis (Gervais, 1859) (Suidae, Mammalia) from the latest Miocene (late Messinian; MN13) of Monticino Quarry (Brisighella, Emilia-Romagna, Italy) Gianni GALLAI & Lorenzo ROOK G. Gallai, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, Via G. La Pira 4, I-50121 Firenze, Italy; [email protected] L. Rook, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, Via G. La Pira 4, I-50121 Firenze, Italy; [email protected] KEY WORDS - Propotamochoerus provincialis (Gervais, 1859), Suidae, dentition, post-cranial skeleton, Late Miocene, Messinian, Monticino Quarry, Brisighella, Italy. ABSTRACT - Nine specimens of fossil pigs are described here from the latest Miocene mammal assemblage of Monticino Gypsum Quarry (also referred to as Brisighella). The tooth remains consist of three elements of the upper dentition (I1, M3 and M2), and two of the lower dentition (P2 and M1). There are four post-cranial elements (astragalus, cuboid, navicular and third phalanx). The degree of dental wear, the closure of the root of the incisor, as well as the relative dimensions of the post-cranial remains indicate that the fossils belong to at least two individuals, a juvenile and an adult. The specimens have been assigned to the species Propotamochoerus provincialis (Gervais, 1859) based on a combinaton of dental morphometrics and morphological characters. Affinities may be shown with recent forms ofSus scrofa Linnaeus, 1758, based on aspects of the morphology of the post-cranial remains implying that the latter are quite homogenous within primitive or derived taxa of the family. As the post-cranial morphology of Propotamochoerus is poorly known the description given here of the findings at Brisighella is an important addition to the knowledge regarding the genus. -

A Study of the Animal Bone Recovered from Pits 9 and 10 at the Site of Nagsabaran in Northern Luzon, Philippines
A Study of the Animal Bone Recovered from Pits 9 and 10 at the Site of Nagsabaran in Northern Luzon, Philippines Philip J. Piper1, Fredeliza Z. Campos1, and Hsiao-chun Hung2 Abstract Excavations in 2004 at the site of Nagsabaran in northern Luzon produced a small but important animal bone assemblage dating to the Neolithic and Metal Age periods of the region. Detailed zooarchaeological analysis of the bone fragments has demonstrated that during the Neolithic period human subsistence strategies focussed on the hunting of wild pigs and deer, supplemented by the rearing of domestic pigs and fishing. In the Metal Age, the immense shell middens attest to the importance of aquatic invertebrates in the diet, but human populations continue to hunt wild pigs and deer and raise domestic pigs as they did in the Neolithic period. The domestic dog is evident within the archaeological record from about 1,500 years ago. Introduction The archaeological site of Nagsabaran in northern Luzon (Figures 1a and 1b) consists of a large shell midden located on the south bank of the Zabaran Creek (or Nagsabaran Creek), close to where it joins the Cagayan River from the west. It is about 22 kilometres from the mouth of the Cagayan River located in the Barangay Alaguia, Lal-lo (N18。09’31‛, E121。38’22‛). Bordered on the north by the Zabaran Creek and wet rice 1 Archaeological Studies Program, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines Email: [email protected]; [email protected] 2 Research Center of Humanities and Social Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan Email: [email protected] Hukay Volume 14, pp. -

Eastern Georgia and Western Azerbaijan, South Caucasus)
Synopsis of the terrestrial vertebrate faunas from the Middle Kura Basin (Eastern Georgia and Western Azerbaijan, South Caucasus) MAIA BUKHSIANIDZE and KAKHABER KOIAVA Bukhsianidze, M. and Koiava, K. 2018. Synopsis of the terrestrial vertebrate faunas from the Middle Kura Basin (Eastern Georgia and Western Azerbaijan, South Caucasus). Acta Palaeontologica Polonica 63 (3): 441–461. This paper summarizes knowledge on the Neogene–Quaternary terrestrial fossil record from the Middle Kura Basin accumulated over a century and aims to its integration into the current research. This fossil evidence is essential in understanding the evolution of the Eurasian biome, since this territory is located at the border of Eastern Mediterranean and Central Asian regions. The general biostratigraphic framework suggests existence of two major intervals of the terrestrial fossil record in the area, spanning ca. 10–7 Ma and ca. 3–1 Ma, and points to an important hiatus between the late Miocene and late Pliocene. General aspects of the paleogeographic history and fossil record suggest that the biogeographic role of the Middle Kura Basin has been changing over geological time from a refugium (Khersonian) to a full-fledged part of the Greco-Iranian province (Meotian–Pontian). The dynamic environmental changes during the Quaternary do not depict this territory as a refugium in its general sense. The greatest value of this fossil record is the potential to understand a detailed history of terrestrial life during demise of late Miocene Hominoidea in Eurasia and early Homo dispersal out of Africa. Late Miocene record of the Middle Kura Basin captures the latest stage of the Eastern Paratethys regression, and among other fossils counts the latest and the easternmost occurence of dryopithecine, Udabnopithecus garedziensis, while the almost uninterrupted fossil record of the late Pliocene–Early Pleistocene covers the time interval of the early human occupation of Caucasus and Eurasia. -

X. Paleontology, Biostratigraphy
BIBLIOGRAPHY OF THE GEOLOGY OF INDONESIA AND SURROUNDING AREAS Edition 7.0, July 2018 J.T. VAN GORSEL X. PALEONTOLOGY, BIOSTRATIGRAPHY www.vangorselslist.com X. PALEONTOLOGY, BIOSTRATIGRAPHY X. PALEONTOLOGY, BIOSTRATIGRAPHY ................................................................................................... 1 X.1. Quaternary-Recent faunas-microfloras and distribution ....................................................................... 60 X.2. Tertiary ............................................................................................................................................. 120 X.3. Jurassic- Cretaceous ........................................................................................................................ 161 X.4. Triassic ............................................................................................................................................ 171 X.5. Paleozoic ......................................................................................................................................... 179 X.6. Quaternary Hominids, Mammals and associated stratigraphy ........................................................... 191 This chapter X of the Bibliography 7.0 contains 288 pages with >2150 papers. These are mainly papers of a more general or regional nature. Numerous additional paleontological papers that deal with faunas/ floras from specific localities are listed under those areas in this Bibliography. It is organized in six sub-chapters: - X.1 on modern and sub-recent -

Microstonyx Antiquus Aus Dem Alt-Pliozän Mittel-Europas
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien Jahr/Year: 1972 Band/Volume: 76 Autor(en)/Author(s): Thenius Erich Artikel/Article: Microstonyx antiquus aus dem Alt-Pliozän Mittel-Europas. Zur Taxonomie und Evolution der Suidae (Mammalia). 539-586 ©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhistor. Mus. Wien 76 539-586 Wien, April 1972 Microstonyx antiquus aus dem Alt-Pliozän Mittel-Europas. Zur Taxonomie und Evolution der Suidae (Mammalia) Von Erich THENIUS X) (Mit 10 Textabbildungen und 3 Tafeln) Manuskript eingelangt am 15. Juni 1970 Inhaltsübersicht Seite Zusammenfassung 539 Summary 540 Einleitung 540 Fundort und Altersstellung der Fundschichten 542 Beschreibung von Schädel und Gebiß 543 Taxonomische und phylogenetische Stellung von Microstonyx 555 Zur funktioneilen Analyse des Microstonyx-Sch&dels 566 Lebensraum und Lebensweise von Microstonyx 574 Die zeitliche und räumliche Verbreitung von Microstonyx antiquus 575 Zur Evolution der Suidae 576 Ergebnisse 581 Literaturverzeichnis 581 Zusammenfassung Aus altpliozänen (pannonischen) Schottern von Stratzing N Krems in der Molassezone Niederösterreichs wird ein Schädel von Microstonyx antiquus be- schrieben. Es ist der erste Schädelrest dieser Art, die damit erstmalig sicher aus dem österreichischen Tertiär nachgewiesen ist. Ein Vergleich mit fossilen und rezenten Suiden zeigt die generische Sonderstellung von Microstonyx. Sie wird als Endform der Hyotheriinen und nicht als Angehörige der Suinae ge- deutet und vom miozänen Hyotherium abgeleitet. Die Gattungs- und Art- Diagnose wird neu definiert. Microstonyx antiquus ist als Mitglied der Hipparionenfaunen vom Eppels- heim-Typ eine Waldform, M. major dagegen ein Savannenbewohner und Ange- höriger von Pikermi-Faunen. -

(Suidae, Mammalia) from the Philippines and The
Geobios 49 (2016) 285–291 Available online at ScienceDirect www.sciencedirect.com Original article A new species of Celebochoerus (Suidae, Mammalia) from the Philippines and the paleobiogeography of the genus Celebochoerus § Hooijer, 1948 a, b c d a Thomas Ingicco *, Gert van den Bergh , John de Vos , Abigael Castro , Noel Amano , e Angel Bautista a De´partement de Pre´histoire, UMR 7194, Muse´um national d’Histoire naturelle, Muse´e de l’Homme, 17, place du Trocade´ro, 75016 Paris, France b Centre for Archaeological Science, School of Earth & Environmental Sciences, University of Wollongong, Wollongong, NSW 2522, Australia c Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, The Netherlands d Geology Division, National Museum of the Philippines, Taft Ave, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila, Philippines e Cultural Properties Division, National Museum of the Philippines, Taft Ave, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila, Philippines A R T I C L E I N F O A B S T R A C T Article history: Celebochoerus is a unique suid having extremely large upper tusks, and which was to date only known Received 25 June 2015 from the Pliocene-Pleistocene of Sulawesi Island in Indonesia. Here, we report on the discovery of a Accepted 13 May 2016 canine fragment referable to Celebochoerus from the Cagayan Valley of Luzon, Northern Philippines. We Available online 4 July 2016 name a new species, Celebochoerus cagayanensis nov. sp., which differs from the Sulawesi species Celebochoerus heekereni in having mesial and distal enamel bands on the upper canines. We see these Keywords: characteristics as symplesiomorphic in suids and propose a migration route from the Philippines to Suidae Sulawesi, possibly out of Taiwan, which would have occurred independently from the better known Celebochoerus cagayanensis nov. -

New Fossil Suid Specimens from the Terminal Miocene Hominoid Locality of Shuitangba, Zhaotong, Yunnan Province, China
Journal of Mammalian Evolution (2019) 26:557–571 https://doi.org/10.1007/s10914-018-9431-3 ORIGINAL PAPER New Fossil Suid Specimens from the Terminal Miocene Hominoid Locality of Shuitangba, Zhaotong, Yunnan Province, China Sukuan Hou1,2,3 & Denise F. Su2 & Jay Kelley4 & Tao Deng1,3 & Nina G. Jablonski5 & Lawrence J. Flynn6 & Xueping Ji7,8 & Jiayong Cao9 & Xin Yang 10 Published online: 14 March 2018 # Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018, corrected publication April/2018 Abstract Fossil suid specimens recovered from the latest Miocene site of Shuitangba, Zhaotong Basin, Yunnan Province, provide new information on the classification and relationship of Chinese Miocene Suinae. Most of the recovered specimens are referred to a relatively advanced and large species of Suinae, Propotamochoerus hyotherioides, based on dental dimensions and morphology. Detailed morphological comparisons were made between the Shuitangba Pr. hyotherioides and other Asian Miocene suines. From these comparisons, we suggest that Pr. hyotherioides from Shuitangba and northern China may be relatively derived compared to the specimens from Lufeng and Yuanmou, southern China and that Pr. hyotherioides and Pr. wui represent separate branches of the genus in China. Furthermore, Microstonyx differs from Pr. hyotherioides in p4/P4 and m3/M3 characters. Molarochoerus is suggested to represent a relatively derived taxon due to the uniquely molarized upper and lower fourth premolars. Miochoerus youngi is suggested to have a closer relationship to Sus and Microstonyx than to Propotamochoerus due to its small size and p4 morphology. Hippopotamodon ultimus, Potamochoerus chinhsienense, Dicoryphochoerus medius, and D. binxianensis exhibit complex morphologies that variously resemble Propotamochoerus, Microstonyx,andSus and are suggested to be possible transitional forms between Propotamochoerus, Microstonyx,andSus.