Eine Frau an Der Front
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
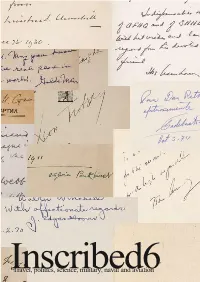
Inscribed 6 (2).Pdf
Inscribed6 CONTENTS 1 1. AVIATION 33 2. MILITARY 59 3. NAVAL 67 4. ROYALTY, POLITICIANS, AND OTHER PUBLIC FIGURES 180 5. SCIENCE AND TECHNOLOGY 195 6. HIGH LATITUDES, INCLUDING THE POLES 206 7. MOUNTAINEERING 211 8. SPACE EXPLORATION 214 9. GENERAL TRAVEL SECTION 1. AVIATION including books from the libraries of Douglas Bader and “Laddie” Lucas. 1. [AITKEN (Group Captain Sir Max)]. LARIOS (Captain José, Duke of Lerma). Combat over Spain. Memoirs of a Nationalist Fighter Pilot 1936–1939. Portrait frontispiece, illustrations. First edition. 8vo., cloth, pictorial dust jacket. London, Neville Spearman. nd (1966). £80 A presentation copy, inscribed on the half title page ‘To Group Captain Sir Max AitkenDFC. DSO. Let us pray that the high ideals we fought for, with such fervent enthusiasm and sacrifice, may never be allowed to perish or be forgotten. With my warmest regards. Pepito Lerma. May 1968’. From the dust jacket: ‘“Combat over Spain” is one of the few first-hand accounts of the Spanish Civil War, and is the only one published in England to be written from the Nationalist point of view’. Lerma was a bomber and fighter pilot for the duration of the war, flying 278 missions. Aitken, the son of Lord Beaverbrook, joined the RAFVR in 1935, and flew Blenheims and Hurricanes, shooting down 14 enemy aircraft. Dust jacket just creased at the head and tail of the spine. A formidable Vic formation – Bader, Deere, Malan. 2. [BADER (Group Captain Douglas)]. DEERE (Group Captain Alan C.) DOWDING Air Chief Marshal, Lord), foreword. Nine Lives. Portrait frontispiece, illustrations. First edition. -

Eve Curie-Labouisse 1904-2007
The Invisible Light The Journal of The British Society for the History of Radiology 21st Birthday Year 1987-2008 The Centenary of the death of Henri Becquerel Number 28, May 2008 ISSN 1479-6945 (Print) ISSN 1479-6953 (Online) http://www.bshr.org.uk 2 Contents Page Editorial Notes 3 X-RAY THERAPY AND THE EARLY YEARS, 1902-1907 by Noel Timothy 4 Start of the “Radium Story” by Richard Mould 11 “The first Argentinean radiological journal” by Alfredo Buzzi and César Gotta 13 “Eve Curie-Labouisse 1904-2007” by Richard F. Mould 16 British Society for the History of Medicine, Congress September 2009 in Belfast 30 Interesting Web sites 31 “William Hunter and the Art and Science of Eighteenth-Century Collecting” 31 And finally: Betty Boop 32 Editorial Notes Our Radiology History Committee was founded way back in 1987. I hope everyone likes this issue of ‘The Invisible Light’ in this our 21st Birthday Year. There are four good articles for you to read. Do please consider getting involved in our committee and do contact me if you are interested. I would be delighted to include any of your articles in the next issue of ‘The Invisible Light.’ Please send me any material that you have. This journal is also available on-line to members. If you wish to receive it in that way please contact Jean Barrett at [email protected] This year 2008 is the centenary year of the death of Henri Becquerel who discovered natural radioactivity and was joint Nobel laureate with Marie and Pierre. -

A Library Letter from the Boston Athenteum
A THEN _UM ITEMS A Library The Boston Letter from Athenteum No. 28 JUNE 1943 A Super-Catalogue HE Athenreum has already received thirty-six volumes of a stupendous set of books, estimated at one hundred and sixty on completion, bearing the title "A Catalog of Books, Represented by Library of Congress Printed Cards." (It takes a firm will and hand to write "Catalog" for "Catalogue," but who are we to oppose the dictates of Congress, backed by the second choice ofWebster?) These volumes run to more than 6oo pages each, with reduced photographic reproductions of eighteen catalogue cards on each page. Since the total content of printed book and pamphlet titles in the Library of Congress amounts to more than 6,6oo,ooo, and the number protnised in this monumental work is I ,94I, I 28, it is evident that "printed cards" and not indi vidual books are the subject of listing. For reasons explained in the Preface, for the benefit rather of librarians than for such casual readers as those addressed in our ITEMS, the Catalogue is "something less and something more than a complete inventory of the printed books in the Library of Congress." However less or more, the volumes constitute a gigantic tool of scholarship of which the veriest layman in the field of books must recognize the value. For the general reader, bent on no quest of bibliographical information on a particular book, the Intro duction by Archibald MacLeish, Librarian of Congress, will hold rewards of its own. With true realism he looks upon the work as likely to "touch the imagination of imaginative users (readers there will be none)." On the subject of catalogues in general he brings some interesting facts to light. -

Rev. Torna Nasseri 1905-1987
Established 1964 . Dedicated to the A dvancement of Education .: of Assyrians SECOND & THIRD QUARTER 1987 VOLUME 10 NO.2 & 3 Rev. Torna Nasseri 1905-1987 CULTURAL -EDUCATIONAL -SOCIAL A ssyrian Periodicals We urge our readers to read and support the Assyrian publications. The active participa- SECOND & THIRD QUARTER 1987 tion of all Assyrians is the only guarantee of VOL 10 NO. 2& 3 the success of Assyrian periodicals. Julius N. Shabbas Editor Joel J. Elias Ass't. Editor Ashour Mouradkhan Ass't. Editor IN THIS ISSUE: Assyrian Section Peggie J. Hernandez Circulation • Assyrian Group Tour to the Soviet Union 2 • Letters to the Editor 3 POLICY • Germans - The Modern-Day Descendants of the Assyrians. .......... ....... .. 4 • What is the Ashurbanipal Library. .. .. .... ... .. 5 ARTICLES SUBMITTED FOR PUBLICATION WILL BE • Here and There.. .. .. .. .. .. ..... .. .... .. 6 SELECTED BY THE EDITORIAL STAFF ON THE BASIS OF THEIR RELATIVE MERITTOTHEASSYRIAN LITERATURE, • Professor Constantin Matveyev Receiving HISTORY, AND CURRENT EVENTS. Professorship Diploma 7 • Major Assyrian/Greek Conference Planned 8 OPINIONS EXPRESSED IN THIS MAGAZINE ARE THOSE OFTHE RESPECTIVE AUTHORS AND NOT NECESSARILY • Ivan Abramovich Simonoff - An Assyrian of THOSE OF NINEVEH. Arzni, Soviet Armenia. .. .. ... .. ..... .. 9 ASSYRIAN FOUNDATION OF AMERICA ESTABLISHED IN • Monument in Arzni 10 JUNE 1964 AND INCORPORATED IN THE STATE OF Fourth Century Manuscript CALIFORNIA AS A NON·PROFIT, TAX EXEMPT ORGANI· • Thirteen Assyrian Bishops and Fathers in ZATION DEDICATED TO THE ADVANCEMENT OF EDU- Georgia, U.S.S.R. ... .... .. ... ... ... .. 13 CATION OF ASSYRIANS. • In Memorium , 14 • Feasts and Commemorations. .... .. .. 15 • Thoughts to Live By: The Hidden Treasure 17 by Abram L George • Thank You For Your Contributions 18 ADDRESS LETTERS TO • Graduates 19 THE EDITOR • Dating a Winged Bull , 21 NINEVEH by Professor Constantin Matveyev 1918 SAN PABLO AVENUE • Whither Christian Missions 24 BERKELEY, CALIFORNIA 94702 David B. -

English for Victory
;': , ^':::;:;::;:;:;:::;l{sn • / f 'i::::::::::«""»""S '. 'iaatSSSSS:S!S:S!!!!!S!!!!*^S aaaai . • iliiinis::: . v... / •{••kVi -ih . i\m^ ^.,»:^^^!,^^,^'^^a^*51flTl:4^,..L:.amIl,^l»l»«»lm^lm»^^ If m UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES EDUCATION LIBRARY FLORIDA CURRICULUM LABORATORY COLLEGE OF EDUCATION - U. OF FLA. AND STATE DEPT. OF PUBLIC INSTRUCTION P. K. YONGE SCHOOL • GAINESVILLE. FLA. \M^ ^ A \ Z7S.lf English for Victory A MANUAL OF PRACTICAL MATERIALS FOR THE ENGLISH CLASSROOM THE NEW YORK CITY ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH m( New York City Association of Teachers of English Officers CLARA A. MOLENDYK. President Lafayette HigK School JESSE GRUMETTE, Vice-President Abraham Lincoln High School RUDOLPH COOPER, Secretary High School of Music and Art ALICE FEUERSTEIN, Treasurer Juha Richman High School Executive Committee MARY CARRILLO Wadleigh High School ARTHUR GOLDWAY Bronx Vocational High School for Boys ELIZABETH SMITH New Dorp High School EDWARD STASHEFF* Christopher Columbus High School GEORGE SULLIVAN Long Island City High School SHIRER VAN STEENBERGH James Madison High School ALICE VIERHAUS Junior High School No. 37, Bronx ACKNOWLEDGMENT Grateful acknowledgment is made to the following teachers and committees: The hundreds of resourceful and creative New York City teachers of Enghsh whose contributions made this book possible. The members of the War Sources Committee (Simon Certner, Ernestine Fleischer, WiUiam Frauenglass, Arthur Goldway, Henry Goodman, Clara Molendyk, Charles Spiegler, and Edward Stasheff) wlio solicited and organized these materials. The members of the War and Peace Materials Workshop Com- mittee (Simon Certner, Henry Goodman, Jesse Grumette, Blanche Katz, Rose Nurnberg, and Charles Spiegler) who edited and supple- mented the work of the War Sources Committee, The members of the Summer 1945 Workshop Committee (Emma Cohen, Esther Ducat. -

Macdowell Colony Doreen Carwithen Teresa Carreno Ethel Smyth Ruth Gipps Maud Powell Dorothy Gow Society of Women Musicians
The Maud Powell SignatureSignature Women in Music The March of the Women Marion Bauer Amy Beach Jenny Lind The MacDowell Colony Doreen Carwithen Teresa Carreno Ethel Smyth Ruth Gipps Maud Powell Dorothy Gow Society of Women Musicians Premiere Online Issue ~ June 2008 2 The Maud Powell Signature, Women in Music, June 2008 The Maud Powell Signature, Women in Music The March of the Women June 2008, Vol. II, No. 2 Premiere online issue Contents From the desk of . Daryle Gardner-Bonneau, Sigma Alpha Iota …………………………………………... 5 Editorial—The March of the Women ……………………………………………………………………………… 7 Jenny Lind, The Swedish Nightingale by Leslie Holmes ……………………………………………………….. 11 Women with a Cause, The Creation of the MacDowell Colony by Robin Rausch ………………………….. 21 Marion Bauer, From the Wild West to New York Modernism by Susan Pickett ……………………………... 31 Graveyard Stories by Susan Pickett …………………………………………………………………….. 47 The Society of Women Musicians, A Major Step Forward …………………………………………………… 49 in the “March of the Women” by Pamela Blevins Doreen Carwithen, Breaking Down Barriers by Andrew Palmer ………………………………………………. 57 The Children’s Corner ……………………………………………………………………………………………... 69 Amy Beach, “Stealing from the Birds” and other adventures in music by Marie Harris Cameos of More Women in Music ………………………………………………………………………………. 81 Teresa Carreño by Pamela Blevins Maud Powell by Karen Shaffer Dorothy Gow by John France Ethel Smyth by Pamela Blevins The Learning Center ……………………………………………………………………………………………….. 93 Brighter Women Through Music by Madeline Frank -

Freya Stark (1893-1993) Was Famous As an Explorer of Remote Middle Eastern Areas, As a Travel Writer and Was Accredited with a Deep Understanding of the Arab Mind
Library of the Australian Defence Force Academy w University College The University of New South Wales Donor: C.A. CAMPBELL UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES Thesis/Project Report Sheet Surname or Family name: Firstname: CHRI.S.TINE Othername/s: MN Abbreviation for degree as given in the University calendar: MA... .(.HONS.) School: Faculty: ENQLISH. Titfc: F.REXA...S.XARK Abstract 350 words maximum: (PLEASE TYPE) Dame Freya Stark (1893-1993) was famous as an explorer of remote Middle Eastern areas, as a travel writer and was accredited with a deep understanding of the Arab mind. She received many awards and distinctions, commonly reserved for men. She wrote an autobiography, detailing her achievements, which revealed a self-made writer and explorer. She depicted a delicate invalid, yet her reputation was as an intrepid explorer; her writing career was an immediate success; her views on the Arab mind were courted at the highest level. Three of her friends wrote biographies about her, but all were based upon her own autobiography. Throughout her biographies there was a thin thread of subversive comment. The dissonance required explanation. My examination of her later-published letters result in an alternative story. She was not self-made, there was an unsuspected network of relations, friends and circumstances which had contributed to her otherwise inexplicably successful travelling, writing and "political" career. Her actual exploration was found to amount to very little - very brief and the product of good advice as much as anything else. An exploration of her health problems revealed them to be largely illusory. After examination of Stark's attitude towards "Orientalism" is defined and examined in detail, it is revealed that she understood little and sympathized even less with middle class Arabs. -
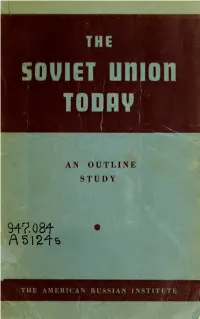
The Soviet Union Today
AN OUTLINE STUDY 94?. 08+ A512^H THE AMERICAN RUSSIAN INSTITUTE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES THE SOVIET UNION TODAY An Outline Study Syllabus and Bibliography by The Staff of THE AMERICAN RUSSIAN INSTITUTE 56 WEST 45th STREET, NEW YORK, 19, N. Y. NEW YORK, 1943 Copyright 1943 by THE AMERICAN RUSSIAN INSTITUTE FOR CULTURAL RELATIONS WITH THE SOVIET UNION, INC. 56 West 45th Street New York, 19, N. Y. Prepared by the Staff of The American Russian Institute: BERNARD L. KOTEN WILLIAM MANDEL JAMES P. MITCHELL HARRIET L. MOORE ROSE N. RUBIN Edited and Produced under union conditions; composed, printed and bound by union labor. BMU - UOPWA 18 CIO <*gi^*.@ ABCO PRESS INC * TABLE OF CONTENTS Foreword (7) Purpose, Division of Time, Study Kit, Readings, Suggested Methods of Use (7). Chapter I. The Land and the People (8-15) Map of the Union of Soviet Socialist Republics, (8-9). I. Area and Population of the Sixteen Republics (9). II. The Peoples (10-12) ; Slavic (10), Turkic and Turco — Tatar (11), Transcaucasian (11), Iranian (11), Baltic (11), Finno-Ugrian (11), Mongol (11), Armenian (11), Jewish (11), German (11), Molda- vian (12), of the North (12). III. Physical Geography and Climate (12-15); Range (12), Vegetation (12), Economic Geography of European Russia (13), of the Urals (13), of Siberia (13), of the Far East (13), of the Caucasus (14), of Kazakhstan (14), of Central Asia (14), of the Arctic (15). Discussion Questions (15). Chapter II. The Historical Setting (16-23) Study Suggestions (16). I. Background for the Overthrow of Tsarism (16-17), the February Revolution (16). -
Freya Stark's Known Covert Activities in the Middle East, 1927–1943
Appendix A: Freya Stark’s known covert activities in the Middle East, 1927–1943, compiled from various archival and published sources From To Region Visited Objective/product Client 1927–10 1928 Levant Beirut; Unknown. Probably debriefed SIS/ Damascus; regarding the Jebel Druze WO? Jebel Druze; Palestine; Cairo 1930–04 1930–06 Persia Elburz Cartographic survey (Valley of WO Mountains the Assassins) 1931–08 1931–10 Persia Elburz Cartographic and WO/ Mountains; archaeological surveys (Valley RGS Luristan of the Assassins; Luri graves); RGS reports 1931–10 1933–03 Baghdad – Baghdad Times (mostly) ? 1932–09 1933–02 Persia Luristan Cartographic survey (Pusht-i- WO Kuh [uncharted]) 1934–12 1935–04 Yemen Hadhramaut Probably no intelligence. RGS? Aborted (measles) 1937–10 1938–03 Yemen Hadhramaut Probably no intelligence; just RGS RGS reports. (Wakefield archaeological expedition leader) 1939–03 1939–07 Syria Hama, Probably no intelligence RGS? Orontes valley, Aleppo © The Author(s) 2019 261 A. O’Sullivan, The Baghdad Set, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15183-6 262 APPENDIX A: FREYA STARK’S KNOWN COVERT ACTIVITIES IN THE MIDDLE EAST… From To Region Visited Objective/product Client 1939–10 1939–10 Cairo – Meetings in Cairo with various – intelligence personalities: Cawthorn (MEIC), Thornhill (SIS), Clayton (DDMI), et al. 1939–11 1940–02 Aden – Assistant Information Officer. MOI/ Ikhwan al-Hurriya. Bonzo FO scheme 1940–02 1940–03 Yemen Sana’a Political, military, economic MEIC/ intelligence. Persuasion FO 1940–07 1941–03 Cairo Ikhwan. Bonzo scheme MOI/ SOE 1941–03 1943–02 Baghdad Ikhwan MOI 1943–02 1943–03 Delhi Bonzo scheme GOC 1943–04 1943–08 Baghdad Ikhwan MOI Periods between travels spent in the UK and/or Italy. -

CITIZENS of LONDON Lynne Olson
CITIZENS OF LONDON Lynne Olson NOTES INTRODUCTION xiii “convinced us”: Letter from unidentified sender, John Gilbert Winant scrap- book, in possession of Rivington Winant. xiv “We were”: Alex Danchev and Daniel Todman, eds., War Diaries, 1939–1945: Field Marshal Lord Alanbrooke (London: Weidenfeld & Nicolson, 2001), p. 248. “There were many”: John G. Winant, A Letter from Grosvenor Square: An Ac- count of a Stewardship (Boston: Houghton Mifflin, 1947), p. 3. “There was one man”: Times (London), April 24, 1946. “conveyed to the entire”: Wallace Carroll letter to Washington Post, undated, Winant papers, FDRL. xv “two prima donnas”: Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: Harper and Brothers, 1948), p. 236. xvi “The British approached”: Carlo D’Este, Eisenhower: A Soldier’s Life (New York: Henry Holt, 2002), p. 337. xvii “It was not Mr. Winant”: “British Mourn Winant,” New York Times, Nov. 5, 1947. “Blacked out”: Donald L. Miller, Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany (New York: Simon & Schuster, 2006), p. 137. xviii “This is an American- made”: Peter Clarke, The Last Thousand Days of the British Empire: Churchill, Roosevelt, and the Birth of the Pax Americana (New York: Bloomsbury, 2008), p. 103. “they needed to know”: Norman Longmate, The G.I.’s: The Americans in Brit- ain, 1942– 1945 (New York: Scribner, 1975), p. 376. “to concentrate on the things”: Star, Feb. 3, 1941. xix “must learn to live together”: Bernard Bellush, He Walked Alone: A Biography of John Gilbert Winant (The Hague: Mouton, 1968), p. -
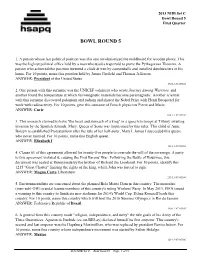
2013 NHB Set C Round #5
2013 NHB Set C Bowl Round 5 First Quarter BOWL ROUND 5 1. A person whose last political position was this one revolutionized the moldboard for wooden plows. This was the highest political office held by a man who used a trapezoid to prove the Pythagorean Theorem. A person who achieved this position invented a clock driven by cannonballs and installed dumbwaiters in his home. For 10 points, name this position held by James Garfield and Thomas Jefferson. ANSWER: President of the United States 190-13-87-05101 2. One person with this surname was the UNICEF volunteer who wrote Journey Among Warriors, and another found the temperature at which ferromagnetic materials become paramagnetic. Another scientist with this surname discovered polonium and radium and shared the Nobel Prize with Henri Becquerel for work with radioactivity. For 10 points, give this surname of French physicists Pierre and Marie. ANSWER: Curie 014-13-87-05102 3. This monarch claimed to have "the heart and stomach of a king" in a speech to troops at Tilbury awaiting invasion by the Spanish Armada. Mary, Queen of Scots was imprisoned by this ruler. This child of Anne Boleyn re-established Protestantism after the rule of her half-sister, Mary I. James I succeeded this queen, who never married. For 10 points, name this English queen. ANSWER: Elizabeth I 121-13-87-05103 4. Clause 61 of this agreement allowed for twenty-five people to overrule the will of the sovereign. A party to this agreement violated it, causing the First Barons' War. Following the Battle of Bouvines, this document was sealed at Runnymede by the brother of Richard the Lionheart. -

Maraton Publishing House Catalogue 2021
MARATON PUBLISHING HOUSE CATALOGUE 2021 www.emaraton.cz Mira Yakovenko, Agnessa Mironova Agnessa Zpověď ženy stalinského čekisty The recorded oral memories of Agnessa Mironova (1903–1982) is a must book for anybody who wants to know what was a personal life like under Stalinism. For the first time ever, Agnessa’s notes open the secret door into living rooms and boudoirs of Stalin’s “hangmen”, top-ranked Soviet secret police officers during the purges of 1930-40ies. However, anyone who reads this book with the intention to better understand the past, will also discover an outstanding female character, a proud predator, who reveals all truths about herself frankly and without keeping anything back. A life story of this unique woman, so beautiful and repulsive at once, has developed during the most terrible and bloody period of modern history. Agnessa’s husband, ‘the main love of her life’ as she dubbed him, was the NKVD officer Sergei Mironov. Thanks to his extremely fast and successful career, Agnessa got to the very top society of the Stalin era. We follow the amazing trajectory of her life full of most drastic contrasts: first she talks with Stalin at the New Year celebration party in Kremlin, and next freezes in a Gulag camp lost in cold Kazakh steppes; first she lives alone with her husband in a huge mansion once belonging to the royal governor of Siberia, and next in a miserable pigeonhole in communal apartment in Moscow; first she travels in a luxury saloon cars and limos, and next is a prisoner of the NKVD jail.