Umsetzungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Zwischen Retz Und Laa
Niederösterreichische Kulturwege Zwischen Retz und Laa 15 Seite 3 Alphabetisches Die Landschaft, Ortsverzeichnis ein Gedicht 1 Alberndorf 28 19 Pernersdorf 24 2 Blaustauden 31, 32, 40 20 Pfaffendorf 24- 25 Das Weinviertel ist ein lyrisches Das Land will genau angesehen 3 Deinzendorf 22, 23 21 Pillersdorf 16-17 Land. Theodor Kramer (1897 werden. Oft versteckt sich der – 1958), der im Exil nie heimisch Zauber in den Rückseiten der lang 4 Hadres 28-29 22 Platt 23 werden konnte, schrieb den Dörfern gezogenen Dörfer. Ab und 5 Hanfthal 3, 39, 42 23 Pulkau 3, 11-13 Liebeserklärungen: zu schwingt sich das Land Im alten Gasthausgarten / kommt zu einer sanften Welle 6 Haugsdorf 26-27 24 Retz 3-7 durch den Zaun ganz zag / der Ruch auf. Die Pulkau entspringt bei 7 Immendorf 21 25 Schrattenthal 14-15, 17, 18 von Hobelscharten / am frühen Nach- Harth im Waldviertel und 8 Jetzelsdorf 26 26 Seefeld-Kadolz 30 mittag; / fern klappert noch ein Tel- mündet bei Laa in die Thaya. ler, / und manchmal, wie ein Wisch, Sie zieht Falten in die Oberflä- 9 Kleinhaugsdorf 26 27 Stronsdorf 36-37 / fährt träge bald, bald heller / ein che, entlang von Ortschaften, 10 Laa a.d. Thaya 42-45 28 Untermarkersdorf 28 Lichtfleck übern Tisch. (aus „Im die sich streckenweise nahtlos alten Gasthausgarten“) aneinander knüpfen und begleitet 11 Leodagger 18-19 29 Unterretzbach 9-10 Alois Vogel, Lois Schifferl, Hannes den Kulturweg zwischen Retz und 12 Mailberg 31, 32, 34-35, 46 30 Unterstinkenbrunn 38-39 Weinberger und Walter Kainz Laa fast unsichtbar. In den Manharts- 13 Mitterhof 33 31 Waitzendorf 18-19 (und die Aufzählung ist nur kur- berg formt sie für ein kurzes Stück sorisch) verdichten die Landschaft 14 ein abgeschiedenes, waldreiches Tal. -

Satzung Des Gemeindeverbandes Für Abfallwirtschaft Und Abgabeneinhebung Im Verwaltungsbezirk Hollabrunn; Fassung 1
Satzung des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Hollabrunn; Fassung 1. Jänner 2017 Genehmigt mit der am 20. Dezember 2016 ausgegebenen Novelle der NÖ Gemeinde- verbändeverordnung, LGBl. Nr. 98/2016 SATZUNG §1 Name und Sitz des Gemeindeverbandes Der Gemeindeverband führt den Namen „Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk Hollabrunn“ und hat seinen Sitz in Hollabrunn. §2 Beteiligte Gemeinden Dem Gemeindeverband gehören folgende Gemeinden an: Alberndorf im Pulkautal, Göllersdorf, Grabern, Guntersdorf, Hadres, Hardegg, Haugsdorf, Heldenberg, Hohenwarth-Mühlbach a. M., Hollabrunn, Mailberg, Maissau, Nappersdorf- Kammersdorf, Pernersdorf, Pulkau, Ravelsbach, Retz, Retzbach, Schrattenthal, Seefeld - Kadolz, Sitzendorf an der Schmida, Wullersdorf, Zellerndorf, Ziersdorf. §3 Aufgaben des Gemeindeverbandes (1) Aus dem eigenen Wirkungsbereich der verbandsangehörigen Gemeinden obliegt dem Gemeindeverband die Vollziehung und die Besorgung der Aufgaben auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft sowie die Bemessung, Vorschreibung, Einhebung und zwangsweise Einbringung der diesbezüglichen Abgaben und die Beteiligung an Gesellschaften des Handelsrecht, die die Entsorgung und Verwertung von Abfall zum Gegenstand haben. Dem Gemeindeverband obliegt nicht die Sicherung und die Sanierung von Altlasten im Sinne des Altlastensanierungsgesetzes. (2) Aus dem eigenen Wirkungsbereich der verbandsangehörigen Gemeinden obliegt dem Gemeindeverband die Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und -

COURT (CHAMBER) CASE of BRANDSTETTER V. AUSTRIA
CONSEIL COUNCIL DE L’EUROPE OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COURT (CHAMBER) CASE OF BRANDSTETTER v. AUSTRIA (Application no. 11170/84; 12876/87; 13468/87) JUDGMENT STRASBOURG 28 August 1991 BRANDSTETTER v. AUSTRIA JUDGMENT 1 In the case of Brandstetter v. Austria, The European Court of Human Rights, sitting, in accordance with Article 43 (art. 43) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ("the Convention") and the relevant provisions of the Rules of Court, as a Chamber composed of the following judges: Mr R. RYSSDAL, President, Mr Thór VILHJÁLMSSON, Mrs D. BINDSCHEDLER-ROBERT, Mr F. GÖLCÜKLÜ, Mr F. MATSCHER, Mr R. MACDONALD, Mr C. RUSSO, Mr A. SPIELMANN, Mr S.K. MARTENS, and also of Mr M.-A. EISSEN, Registrar, and Mr H. PETZOLD, Deputy Registrar, Having deliberated in private on 21 February and 27 June 1991, Delivers the following judgment which was adopted on the last- mentioned date: PROCEDURE 1. The case was referred to the Court by the European Commission of Human Rights ("the Commission") and by the Government of the Republic of Austria ("the Government") on 11 July and 1 October 1990 respectively, within the three-month period laid down by Article 32 para. 1 and Article 47 (art. 32-1, art. 47) of the Convention. It originated in three applications (nos. 11170/84, 12876/87 and 13468/87) against Austria lodged with the Commission under Article 25 (art. 25) by an Austrian national, Mr Karl Brandstetter, on 6 September 1984, 13 March 1987 and 21 October 1987. -

ABHANDLUNGEN DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Abh
©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at ABHANDLUNGEN DER GEOLOGISCHEN BUNDESANSTALT Abh. Geol. B.-A. ISSN 0378-0864 ISBN 978-3-85316-058-9 Band 65 S. 211–219 Wien, 10. 11. 2010 Fifty Years of Geological Cooperation between Austria, the Czech Republic and the Slovak Republic Quaternary Sediments at the Southeastern Margin of the Bohemian Massif in the Borderland of Austria and the Czech Republic (Lower Austria – South Moravia) Pavel havlíček1, oldřich holásek1, reinhard roetzel2 & libuŠe sMolíková3 7 Text-Figures, 1 Table Österreichische Karte 1 : 50.000 Quaternary sediments Blatt 8 Geras Micromorphology Blatt 9 Retz Paleogeography Blatt 22 Hollabrunn South Moravia Blatt 23 Hadres Lower Austria Stratigraphy Weinviertel Fossil soils Contents Zusammenfassung . 211 Abstract . 211 Introduction. 212 Geological Setting. 212 Development of Quaternary Sediments . 213 Distribution of Aeolian Sediments and Fossil Soils . 214 Description of Fossil Soils. 215 Conclusions . 216 Acknowledgements. 217 References . 217 Quartäre Sedimente am Südostrand der Böhmischen Masse im Grenzgebiet von Österreich und der Tschechischen Republik (Niederösterreich – Südmähren) Zusammenfassung Am Südostrand der Böhmischen Masse wurden im Grenzgebiet von Österreich und der Tschechischen Republik in Niederösterreich und Südmähren quartäre Sedimente untersucht. Neben der geologischen Detailkartierung der quartären Schichtfolgen erfolgte die mikromorphologische Untersuchung der in den Löss-Komplexen eingeschalteten fossilen Böden. Damit konnten die Paläoböden in diesem Raum typologisch bewertet und stratigraphisch eingestuft werden. Die meisten Löss-Komplexe mit ihren fossilen Böden blieben im Bereich des Kartenblattes Hadres im Pulkautal und südlich von Hollabrunn und auf tsche- chischem Gebiet auf dem Kartenblatt Retz vor allem im Nationalpark Podyjí entlang des Thayatales erhalten. Die untersuchten Aufschlüsse beinhalten Paläoböden der Bodenkomplexe PK II bis PK X aus dem gesamten Pleistozän. -

Und Energie-Modellregion
Klima- und Energie-Modellregion KEM PULKAUTAL Umsetzungsphase Weiterführungsphase I Weiterführungsphase II Weiterführungsphase III Zwischenbericht Endbericht Inhaltsverzeichnis: 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion 2. Zielsetzung 3. Eingebundene Akteursgruppen 4. Aktivitätenbericht 5. Best Practice Beispiel der Umsetzung 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion Facts zur Klima- und Energie-Modellregion Name der Klima- und Energiemodellregion (KEM): Klima- und Energiemodellregion Pulkautal (Offizielle Regionsbezeichnung) Geschäftszahl der KEM B671722 Trägerorganisation, Rechtsform Initiative Pulkautal - Verein zur Entwicklungsförderung der Ge- meinden des Gerichtsbezirkes Haugsdorf Verein (ZBR: 733091490) Deckt sich die Abgrenzung und Bezeichnung der KEM mit einem Ja bereits etablierten Regionsbegriff (j/n)? Falls ja, bitte Regionsbezeichnung anführen: Pulkautal Facts zur Klima- und Energie-Modellregion: - Anzahl der Gemeinden: 6 - Anzahl der Einwohner/innen: 6.536 (1.1.2019) - geografische Beschreibung (max. 400 Zeichen) Das Pulkautal liegt im nördlichen Weinviertel in Niederöster- reich und grenzt direkt an die Tschechische Republik. Die Region liegt zwischen zwei Ballungszentren, ca. 80 km nord- westlich von Wien an der Grenze zu Tschechien, nur 15 km von Znaim entfernt. Die Landschaft mit ihren sanften Hügeln ist geprägt durch Ackerlandschaften und Weingärten. Website der Klima- und Energie-Modellregion: www.pulkautal.at Büro des MRM: - Adresse Laaer Str. 12, 2054 Haugsdorf - Öffnungszeiten Mo. – Fr. von 8:00 -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Klima- Und Energie-Modellregionen
Klima- und Energie-Modellregion : KLIMA- UND ENERGIEMODELLREGION PULKAUTAL Bericht der Umsetzungsphase Weiterführungsphase I Weiterführungsphase II Weiterführungsphase III Zwischenbericht Endbericht Inhaltsverzeichnis: 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion 2. Zielsetzung 3. Eingebundene Akteursgruppen 4. Aktivitätenbericht 5. Best Practice Beispiel der Umsetzung 1. Fact-Sheet zur Klima- und Energie-Modellregion Facts zur Klima- und Energie-Modellregion Name der Klima- und Energiemodellregion (KEM): Klima- und Energiemodellregion Pulkautal (Offizielle Regionsbezeichnung) Geschäftszahl der KEM B287567 Trägerorganisation, Rechtsform Initiative Pulkautal – Verein zur Entwicklungsförde- rung der Gemeinden des Gerichtbezirkes Haugsdorf Deckt sich die Abgrenzung und Bezeichnung der X Ja KEM mit einem bereits etablierten Regionsbegriff (j/n)? Initiative Pulkautal Falls ja, bitte Regionsbezeichnung anführen: Facts zur Klima- und Energiemodellregion: - Anzahl der Gemeinden: Die KEM umfasst insgesamt 6 Gemeinden - Anzahl der Einwohner/innen: 6.543 Einwohnern in der KEM - geografische Beschreibung (max. 400 Zeichen) Die Region Pulkautal liegt im nördlichen Weinviertel in Niederösterreich im politischen Bezirk Hol- labrunn. Das Pulkautal grenzt direkt an die Tsche- chische Republik. Namensgeber des Tales ist der Fluss Pulkau. Die Region liegt zwischen zwei Bal-lungszentren, ca. 80 Kilometer nord-westlich von Wien an der Grenze zu Tschechien, nur 15 Kilometer von Znaim und ca. 80 Kilometer von Brünn entfernt. Modellregions-Manager/in (MRM) -

Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn
Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn Josef Weislein-Straße 19 | 2020 Hollabrunn Telefon: +43 (2952) 2222 - 70 | Fax: +43 (2952) 2222 - 71 | EMail: [email protected] endgültige Ergebnisliste Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb 25.06.2011 - 25.06.2011 BFKDO Hollabrunn Rang Gruppenname Instanz AFKDO Nr. Gesamt Bronze ohne Alterspunkte / Eigene 1 Riegersburg 1 Riegersburg Retz 12 405,80 2 Thern 1 Thern Ravelsbach 44 405,10 3 Grübern Grübern Ravelsbach 40 400,10 4 Watzelsdorf 1 Watzelsdorf Retz 2 399,60 5 Alberndorf Alberndorf Haugsdorf 20 398,80 6 Kleinriedenthal Kleinriedenthal Retz 4 398,10 7 Zellerndorf 1 Zellerndorf Retz 1 395,40 8 Retz 1 Retz Retz 8 394,80 9 Watzelsdorf 3 Watzelsdorf Retz 14 393,70 10 Obergrabern Obergrabern Hollabrunn 84 389,50 11 Maissau 2 Maissau Ravelsbach 41 385,90 12 Rafing Rafing Retz 7 385,70 13 Jetzelsdorf 1 Jetzelsdorf Haugsdorf 22 381,50 14 Kammersdorf Kammersdorf Hollabrunn 33 381,20 15 Untermarkersdorf Untermarkersdorf Haugsdorf 29 380,80 16 Zellerndorf 2 Zellerndorf Retz 13 379,60 17 Pfaffendorf-Karlsdorf 1 Pfaffendorf-Karlsdorf Haugsdorf 27 379,40 18 Grund Grund Hollabrunn 83 377,80 19 Obergrub Obergrub Hollabrunn 35 377,00 20 Pernersdorf Pernersdorf Haugsdorf 26 374,90 21 Breitenwaida Breitenwaida Hollabrunn 31 373,60 22 Haugsdorf Haugsdorf Haugsdorf 21 371,00 23 Seefeld-Kadolz Seefeld-Kadolz Haugsdorf 28 366,10 24 Eitzersthal I Eitzersthal Hollabrunn 32 365,60 25 Peigarten Peigarten Haugsdorf 82 365,30 26 Retz 2 Retz Retz 15 362,40 27 Ravelsbach Ravelsbach Ravelsbach 43 362,40 28 Groß Wetzdorf Groß -

DIE BÖDEN DES WESTLICHEN WEINVIERTELS 97-105 ©Geol
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt Jahr/Year: 1999 Band/Volume: 1999 Autor(en)/Author(s): Stich Robert Artikel/Article: DIE BÖDEN DES WESTLICHEN WEINVIERTELS 97-105 ©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt 1999 • Retz - Hollabrunn Beiträge DIE BÖDEN DES WESTLICHEN WEINVIERTELS Robert STICH Das flachwellige Hügelland des Weinviertels im Nordosten Niederösterreichs wird durch die Waschbergzone in das östliche Weinviertel mit dem Inneralpinen Wiener Becken und das westliche Weinviertel geteilt. Letzteres gehört zur Molassezone und wird von tertiären Tonen, Sanden, Mergeln und Schottern (z.B. Hollabrunner Schotter aus dem Pannonium), z.T. unter Lößbedeckung aufgebaut. Das westliche Weinviertel ist im Hauptproduktionsgebiet „Nordöstliches Flach- und Hügelland" in einem Seehöhenbereich von 195 m bis 450 m gelegen und umfaßt als Kleinproduktionsge biet die Landschaftsräume des Wagram, des Manhartsberges, des Schmidatales, des Pul kautales, des Pulkau-Retzer Weinlandes und der Hohenwarther Platte (WAGNER, 1990). Auf grund der Thematik der Arbeitstagung sollen aber hier die Böden des Retzer und Holla brunner Raumes dargestellt werden. Hier dominieren die Weinbaubetriebe, es sind jedoch auch viele "gemischte Landwirtschaftsbe triebe" und Marktfruchtbetriebe vorhanden, vor allem in den Grenzbereichen zum Hollabrunn- Mistelbacher -

Vineyard Interfaces in the Heart of Europe Northbound Journey
VINEYARD INTERFACES IN THE HEART OF EUROPE NORTHBOUND JOURNEY NAME: #austrianwine | #winesummit | 23–26 May 2019 Download Catalogue, Tasting Lists & Photos: www.austrianwine.com/wine-summit Social Media & Press AUSTRIAN WINE SOCIAL MEDIA CHANNELS Follow us, if you love Austrian Wine as much as we do ♥ Share your favourite moments with #austrianwine and #winesummit Instagram @austrianwine | @austrianwineuk | @austrianwineusa Facebook @oesterreichwein | @austrianwine YouTube www.youtube.com/oesterreichwein EVENT PRESS KITS with specially selected information about the winegrowing country Austria. www.austrianwine.com/press-kit Preface WELCOME TO AUSTRIA! © AWMB/Anna Stöcher We are so very glad to welcome you to this lersee, Mittelburgenland and Eisenberg year’s Austrian Wine Summit, Vineyard – all adjacent to Hungary – to Vulkanland Interfaces in the Heart of Europe! Although Steiermark, bordering on Slovenia. Accre- each Wine Summit is unique, this one feels dited specialists will elucidate the historical very special to me, as it fulfils a longtime development of each border region, while dream of mine: to pay a dedicated visit to wines from our Czech, Slovakian, Hunga- some of Austria’s best vineyards – speci- rian and Slovenian friends will accompany fically, those that lie at the borders of our you throughout your visit. country; these borders that never were bor- ders until after 1918. New lines of demar- Finally, you will assemble in Vienna with cation were drawn then, which abruptly di- your colleagues from the other Wine Sum- vided excellent terroirs, leaving the parts in mit groups for a day’s conference dedica- separate countries and leading to a century ted to the history of Austrian wine. -

Stadtgemeinde Retz BERTHOLD Aszdürnleis I Hadres I Hollabrunn
Abfuhrplan ** ACHTUNG ** Mülltonnen sind ab 6 Uhr Stadtgemeinde Retz bereitzustellen! 2021 Entsorgungsgebiete Entsorgungsgebiet 1: Jänner Februar März April Mai Juni Adolf Lehr Straße, Althofgasse, Bäckergasse, Bahnhofstraße, Bahnhofplatz Matth. Brunner-Gasse, Brunngasse, Burggasse, Geißlerstraße, Gollitschweg, Staatsftg. 1 FR Neujahr 1 MO BIO 1 MO BIO 1 DO 1 SA 1 DI RM 2 Haidgraben, Hauptplatz, Herrengasse, Höfleinerstraße, Ignazigasse, 2 SA 2 DI 2 DI 2 FR 2 SO 2 MI Im Stadtfeld, Industriestraße, Jahnstraße, J. Kienast-Straße, GS 1+2 RM 1 Fronleichnam Karl Königplatz, Klosterbrücklweg, Klostergasse, Joh. Köller-Gasse, 3 SO 3 MI 3 MI 3 SA 3 MO 3 DO Dr. G.Korner-Gasse, Kremserstraße, Laurenz von Kurz-G., Ostersonntag 4 MO BIO 4 DO GSL 4 DO 4 SO 4 DI RM 2 4 FR Landesbahnstraße, Lehengasse, Lieblstraße, An der Maut, 5 DI 5 FR 5 FR 5 MO Ostermontag 5 MI 5 SA K.Mössmer-Platz, Obernalberstraße, Puntschertstraße, Rudolf Resch-G., Retzer Straße, Alois Richter-Gasse, Roseggergasse, Sandweggasse, Hl. 3 König 6 MI 6 SA 6 SA 6 DI RM 1 6 DO 6 SO Schloßplatz, Schmiedgasse, Pf.J.Schnabl-Gasse, Seeweg, 7 DO 7 SO 7 SO 7 MI RM 2 7 FR 7 MO BIO Unternalberstraße, Ferdinand Slaby-G., Thayatalstraße, Verderberstraße, 8 FR 8 MO RM 1 8 MO RM 1 8 DO 8 SA 8 DI Vinzenzigasse, Vinzenziplatz, Wallstraße, Wienerstraße, J. Widhalm-Straße, Zum weissen Engel 9 SA 9 DI RM 2 9 DI RM 2 9 FR 9 SO 9 MI GS 1+2 Entsorgungsgebiet 2: 10 SO 10 MI 10 MI 10 SA 10 MO BIO 10 DO GSL Am Anger, Angertorstraße, Altenberggasse, Berggasse, Faschinggasse, Fenthgasse, F.Zimer-G., Fladnitzerstraße, Fladnitzerweg, Florianigasse, 11 MO RM 1 11 DO 11 DO 11 SO 11 DI 11 FR Freudenthalweg, Friedhofgasse, Gatterburgstraße , Göttweigergasse, 12 DI RM 2 12 FR 12 FR 12 MO BIO 12 MI 12 SA Hölzeln, Kaiserpromenade, Kalvarienberggasse, Keilberggasse, 13 MI 13 SA 13 SA 13 DI 13 DO Christi Hf. -
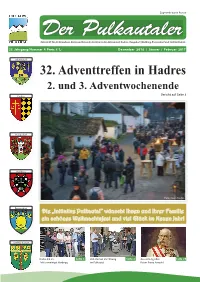
Der Pulkautaler
Zugestellt durch Post.at Der Pulkautaler Zeitschriftfür die Bewohner,Gästeund Freunde der Gemeinden Alberndorf, Hadres,Haugsdorf, Mailberg, Pernersdorfund Seefeld-Kadolz 23. Jahrgang/Nummer 4Preis: €1,- Dezember 2016 /Jänner /Februar 2017 Alberndorf 32. AdventtreffeninHadres 2. und 3. Adventwochenende Berichtauf Seite3 Hadres Haugsdorf Mailberg Foto:Sonja Jordan Pernersdorf Die „InitiativePulkautal” wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und viel Glück im Neuen Jahr! Seefeld-Kadolz Foto:Franz Enzmann -NÖN Radio 4/4 im Seite4 Polt-Roman Verfilmung Seite2 Ausstellung über Seite20 Schlossweingut Hardegg im Pulkautal Kaiser Franz Joseph I Alt, aber Polt! Ein Buch wirdzum Film! "Simon Polt hing seinen unglücklichen Gedanken nach, und weil er vertraut Mädchens Laura, mit ihnen war,ließ er sie achtlos das im Wiesbach ihr laufen, eins werden mit den schüt- Ende findet, wer- teren Schattenringsum. Obwohl den vom Direktor es draußen noch einigermaßen hell des Theaters in der war an diesem späten Nachmittag Josefstadt, Herbert im Oktober,hatte Polt die Türsei- Föttinger,und der nes Presshauseszugemacht, weil großartigen Sandra er Ruhe haben wollte. Nureine Cervikdargestellt. kleine Fensteröffnung ließ Licht Dassind nur einige herein, und oben waren dort, wo die Beispiele. Es ist für Dachziegel lose aneinander lagen, mich immer wie- helle, dünne Streifen im Dunkel zu der eindrucksvoll, sehen. Dergewesene Gendarm saß wie viele erstrangige da, schaute auf seine Hände und war Schauspieler und sich selbst genug." Schaupielerinnen Herbstlich, ruhig und behaglich mit großer Freude fängt er an, dieser Roman -und auch dazu bereit sind, an im Film wirdesruhigzugehen, aller- denVerfilmungen dings mit dramatischen Ausnahmen. dieser Romane mit- Foto:Franz Enzmann -NÖN Ichhabe mit Julian Pölsler in den zuwirken.