PDF Herunterladen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Vol. 16, No. 2 Summer 1983 the GREAT LAKES ENTOMOLOGIST
MARK F. O'BRIEN Vol. 16, No. 2 Summer 1983 THE GREAT LAKES ENTOMOLOGIST PUBLISHED BY THE MICHIGAN EN1"OMOLOGICAL SOCIErry THE GREAT LAKES ENTOMOLOGIST Published by the Michigan Entomological Society Volume 16 No.2 ISSN 0090-0222 TABLE OF CONTENTS Seasonal Flight Patterns of Hemiptera in a North Carolina Black Walnut Plantation. 7. Miridae. J. E. McPherson, B. C. Weber, and T. J. Henry ............................ 35 Effects of Various Split Developmental Photophases and Constant Light During Each 24 Hour Period on Adult Morphology in Thyanta calceata (Hemiptera: Pentatomidae) J. E. McPherson, T. E. Vogt, and S. M. Paskewitz .......................... 43 Buprestidae, Cerambycidae, and Scolytidae Associated with Successive Stages of Agrilus bilineatus (Coleoptera: Buprestidae) Infestation of Oaks in Wisconsin R. A. Haack, D. M. Benjamin, and K. D. Haack ............................ 47 A Pyralid Moth (Lepidoptera) as Pollinator of Blunt-leaf Orchid Edward G. Voss and Richard E. Riefner, Jr. ............................... 57 Checklist of American Uloboridae (Arachnida: Araneae) Brent D. Ope II ........................................................... 61 COVER ILLUSTRATION Blister beetles (Meloidae) feeding on Siberian pea-tree (Caragana arborescens). Photo graph by Louis F. Wilson, North Central Forest Experiment Station, USDA Forest Ser....ice. East Lansing, Michigan. THE MICHIGAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY 1982-83 OFFICERS President Ronald J. Priest President-Elect Gary A. Dunn Executive Secretary M. C. Nielsen Journal Editor D. C. L. Gosling Newsletter Editor Louis F. Wilson The Michigan Entomological Society traces its origins to the old Detroit Entomological Society and was organized on 4 November 1954 to " ... promote the science ofentomology in all its branches and by all feasible means, and to advance cooperation and good fellowship among persons interested in entomology." The Society attempts to facilitate the exchange of ideas and information in both amateur and professional circles, and encourages the study of insects by youth. -

Eggsac Differences in the Spider Family Uloboridae (Arachnida: Araneae)L
Eggsac Differences in the spider Family Uloboridae (Arachnida: Araneae)l BnrNr D. Oprll Department of Biology, Virginia Polytechnic Institute and State Universitv. Blacksburg, Virginia 2406I, U.S.A. Abstract' Scanning electron microscope study of eggsacsprocluced by representatives of the genera Hgptiotes, Miagrammopes, Octonoba,-Philop)neila, Tangaroa, IJloborzts, and Zosis shows them to contain silk of three diameter classes,the clistribution of which does not mirror the familv's phylogeny. The eggsacs of some taxa are constructed of a single layer of fine silk fibers having a diameter o] about 1.0 pm ancl others of two la,n,ers of this silk, judged to be of tubuliform glancl origin. others construct eggsacsit""a 6inr" silk and covered by coarse silk fibers having a diameter of aboirt t.o rrp. Eggsacs of Haptiotes are made of trvo coarse layers covered by tuftecl silk having a fiber 6iameter of about 5'6 pm. Both coarse and tufted silk camoufl"g" tufteJ silk possibly,also serving to collect "ggr"cs, moisture and protect eggs from mechanital ancl insect damage. Coarse and tufted silk may be produced by ampullate glands. The spider family Uloboridae is represented world-wide (Opell, 1g79). Its 18 genera show behavioral diversity in the type of capture webs^producedand in the shape and placement of silken thut u." spun around egg clusters (Berland, "ggr""r Ig32; Comstock, lglB; Eberhard, l96g; Gertsch, l97g; Girault, lgl4; Kaston, 1948; Lubin et al., tgTB; Scheffer, lg05; Trail, rg}2; wiehle, rgz7, 1928; Yoshida, 1981; personal observations).The stellate or elongate, lenticular eggsacs of Philop,onella (Fig, l) often are suspended from t"h" of u horizontal "dg", orb-web and are guarded bv females, whereas those of dctonoba and Zosis are incorporated into the horizontal orb-web and usually are left unattended (Fig. -
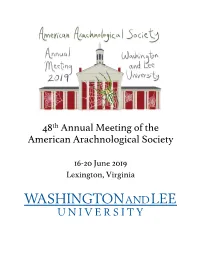
Full Program (.PDF)
48th Annual Meeting of the American Arachnological Society 16-20 June 2019 Lexington, Virginia Table of Contents Acknowledgements ............................................................................................................ 1 Venue and Town ................................................................................................................. 1 Emergency Contacts .......................................................................................................... 2 American Arachnological Society Code of Professional Conduct ............................. 3 MEETING SCHEDULE IN BRIEF ....................................................................................... 4 MEETING SCHEDULE ........................................................................................................ 6 POSTER TITLES AND AUTHORS ................................................................................... 15 ABSTRACTS ...................................................................................................................... 18 ORAL PRESENTATION ABSTRACTS ..................................................................................... 19 POSTER ABSTRACTS ............................................................................................................... 47 CONFERENCE PARTICIPANTS ...................................................................................... 63 Acknowledgements This meeting was made possible by the enthusiastic support of numerous people. We are especially grateful -

Members of the Dartmouth Biology Fsp 2011
MEMBERS OF THE DARTMOUTH BIOLOGY FSP 2011 FACULTY RYAN G. CALSBEEK DAVID R. PEART BRAD W. TAYLOR LAB COORDINATOR CRAIG D. LAYNE GRADUATE ASSISTANTS M. C. DURYEA GILLIAN L. MORITZ SPECIAL ASSISTANT AND COPY EDITOR SARAH E. WENGERT UNDERGRADUATES KELLY S. AHO JENNIFER A. FREISE MARIELLE F. BATTISTONI SUZANNE J. KELSON ELIN C. BECK EMILY KYKER-SNOWMAN LARRY L. BOWMAN, JR. ANDREW N. MERTENS ROHAN N. CHAUDHARY REBECCA M. NIEMIEC ZACHARY J. CLARE-SALZLER SARA E. REMSEN IAN D. ENGLER FRANCES M. WANG KATHERINE L. FITZGERALD i Dartmouth Studies in Tropical Ecology, Vol. 21 Dartmouth College runs an annual 9-10 week ecological field research program in Costa Rica and the Caribbean. Manuscripts from the research projects in this program have been published in the annual volume “Dartmouth Studies in Tropical Ecology” since 1989. Copies are held in the Dartmouth library and in Costa Rica at the San Jose office of the Organization for Tropical Studies (OTS/OET), at the OTS field stations at Palo Verde, Las Cruces and La Selva, at the Cuerici Biological Station, at the Sirena Station of the Corcovado National Park (through 2010), and at the Monteverde Biological Station. On Little Cayman Island, there are copies at the Little Cayman Research Center. Dartmouth faculty from the Department of Biological Sciences, along with two Ph.D. students from Dartmouth’s Environmental and Evolutionary Biology graduate program, advise ca. 15 advanced undergraduate students on this program. The first few projects are designed by the advisors, but undergraduates soon begin conceiving and designing their own projects. The order of authorship on each paper was chosen randomly, in keeping with the style of the program, which emphasizes a cooperative and egalitarian relationship among undergraduates in each project. -

Su Yong Chao Dissertation.Ready to Submit0517
A gang of thieves — evolution of cooperative kleptoparasitism in the subfamily Argyrodinae (Araneae: Theridiidae). By Yong-Chao Su University of Kansas, 2012 Submitted to the graduate degree program in the Department of Ecology and Evolutionary Biology and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson : Deborah R. Smith ________________________________ Member : Rafe M. Brown ________________________________ Member : Bruce Cutler ________________________________ Member : Mark T. Holder ________________________________ Member : Paul A. Selden ________________________________ Member : Matthew Buechner Date Defended : May 14th , 2012 The Dissertation Committee for Yong-Chao Su certifies that this is the approved version of the following dissertation: A gang of thieves — evolution of cooperative kleptoparasitism in the subfamily Argyrodinae (Araneae: Theridiidae). ________________________________ Chairperson : Deborah R. Smith Date approved: May 16th, 2012 ii Abstract This is the first comprehensive study of group-living behavior in kleptoparasitic Argyrodinae, and the first species level molecular phylogenetic analysis of the Argyrodinae (Araneae: Theridiidae). I included four research chapters in this dissertation. In Chapter 2, I showed the first empirical study of cooperative kleptoparasitism in Argyrodes miniaceus. The results showed that, at least at the level of foraging, group- living behavior has adaptive -

Predation by Argyrodes (Theridiidae) on Solitary and Communal Spiders*
PREDATION BY ARGYRODES (THERIDIIDAE) ON SOLITARY AND COMMUNAL SPIDERS* BY DEBORAH SMITH TRAIL Section of Neurobiology and Behavior Department of Entomology Cornell University Ithaca, N.Y. 14853 INTRODUCTION Species of Argyrodes Simon (Theridiidae) are best known as kleptoparasites in the webs of other spiders, particularly in the tropics (Exline 1945; Exline and Levi 1962; Kaston 1965; Vollrath 1976, 1978, 1979). They live in or near the webs of their hosts and take prey from the host's web. The methods used to take prey from the host vary for different species of Argyrodes and different host species. In some cases the Argyrodes take food which the host has left at the capture site or in the hub of the web. They may also take small trapped insects which are not normally used by the host (Robinson and Olazarri 1971). In other cases the kleptoparasites feed from prey while it is still in the jaws of the host spider (Robinson and Robinson 1973). Temperate zone Argyrodes are also found in the webs of other spiders, where they are generally considered to be commensal or kleptoparasitic. However, some temperate zone species of Argy- rodes have been observed preying on their hosts. Argyrodes fictilium (Hentz) was observed feeding on an Araneus sp. host (Exline and Levi 1962) and on Frontinella communis (Hentz) (Archer 1946). Lamore (1958) reported A. trigonum (Hentz) feeding on Mecynogea lemniscata (Walckenaer) and Wise (in press) reports the results of an experimental study of the impact of A. trigonum on a population of Metepeira labyrinthea (Hentz.) It may be that predation on other spiders is more important than kleptoparasitism for some temperate Argyrodes. -

Spider Ecology in the Erfenis Dam Nature Reserve, Free State Province (Arachnida: Araneae)
SPIDER ECOLOGY IN THE ERFENIS DAM NATURE RESERVE, FREE STATE PROVINCE (ARACHNIDA: ARANEAE) by René Fourie Submitted in accordance with the requirement for the degree Magister Scientiae in the Faculty of Natural and Agricultural Sciences, Department of Zoology and Entomology, University of the Free State January 2010 SUPERVISOR: Charles R. Haddad CO-SUPERVISOR: Dr. Anna S. Dippenaar-Schoeman I declare that the dissertation hereby handed in for the qualification Master Scientiae at the University of the Free State, is my own independent work and that I have not previously submitted the same work for a qualification at/in another University/faculty. ……………………………. René Fourie CONTENTS ABSTRACT i UITTREKSEL iii ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 - Studies of spider (Arachnida: Araneae) ecology in the different biomes of South Africa 1.1. Abstract 2 1.2. Introduction 2 1.3 The South African National Survey of Arachnida (SANSA) 3 1.4. Spider ecology studies done in South Africa 5 1.4.1. Spider studies done in the biomes 5 1.4.1.1. Fynbos 6 1.4.1.2. Succulent Karoo 8 1.4.1.3. Nama Karoo 9 1.4.1.4. Forest 10 1.4.1.5. Thicket 11 1.4.1.6. Savanna 12 1.4.1.6.1. Patterns in the conservation areas of the Savanna biome 12 1.4.1.6.2. Patterns in agroecosystems in the Savanna biome in Mpumalanga 14 1.4.1.7. Grassland 17 1.4.1.8. Desert 18 1.4.2. Aims of study 18 1.5. Conclusion 18 1.6. References 19 CHAPTER 2 - Diversity and abundance of spiders (Arachnida: Araneae) in the field and tree layers of Erfenis Dam Nature Reserve, Free State Province 2.1. -

Two Hymenopteran Egg Sac Associates of the Tent-Web Orbweaving Spider, Cyrtophora Citricola (Forskål, 1775) (Araneae, Araneidae)
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Faculty Publications and Other Works -- Ecology and Evolutionary Biology Ecology and Evolutionary Biology 2019 Two hymenopteran egg sac associates of the tent-web orbweaving spider, Cyrtophora citricola (Forskål, 1775) (Araneae, Araneidae) Angela Chuang University of Tennessee, Knoxville Michael W. William Gates Beltsville Agricultural Research Center, Washington Lena Grinsted Royal Holloway University of London, UK Richard Askew Unaffiliated, St Marcel du Périgord, France Christy Leppanen University of Tennessee, Knoxville, US Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_ecolpubs Recommended Citation Chuang, Angela; William Gates, Michael W.; Grinsted, Lena; Askew, Richard; and Leppanen, Christy, "Two hymenopteran egg sac associates of the tent-web orbweaving spider, Cyrtophora citricola (Forskål, 1775) (Araneae, Araneidae)" (2019). Faculty Publications and Other Works -- Ecology and Evolutionary Biology. https://trace.tennessee.edu/utk_ecolpubs/85 This Article is brought to you for free and open access by the Ecology and Evolutionary Biology at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications and Other Works -- Ecology and Evolutionary Biology by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 874: 1–18 (2019) Two wasp associates of Cyrtophora -

Spider Webs As Habitat Patches—The Distribution of Kleptoparasites
2003. The Journal of Arachnology 31:344±349 SPIDER WEBS AS HABITAT PATCHESÐTHE DISTRIBUTION OF KLEPTOPARASITES (ARGYRODES, THERIDIIDAE) AMONG HOST WEBS (NEPHILA, TETRAGNATHIDAE) Ingi Agnarsson: Systematic Biology±Entomology, E-530, Smithsonian Institution, NHB-105, PO Box 37012, Washington, D.C. 20013-7012 & Department of Biological Sciences, George Washington University, Washington DC, 20052 USA ABSTRACT. Most adult golden orb weavers (Nephila clavipes) have kleptoparasites of the genus Ar- gyrodes in their webs. The kleptoparasitic load correlates positively with web size. Clustered (intercon- nected) webs have a more predictable number of kleptoparasites than do solitary webs, but there is no difference in the mean number of kleptoparasites between the two. From the view of the kleptoparasite, host webs are habitat patches or islands. Isolated webs show characteristics of small patches, where web size is a poor indicator of kleptoparasite number and variation is high. The distribution of kleptoparasites in clustered webs, on the other hand, seems to ®t the ``ideal free distribution'' where web size nearly entirely predicts kleptoparasitic load. Thus clustered webs, as a habitat patch, are more than merely the combination of their parts. The predictability of kleptoparasite load in clustered webs may be a function of the stability (longevity) of those habitat patches, and ease of colonization, as neighboring webs act as sources. Keywords: Habitat islands, habitat stability, ideal free distribution, orb web, patch connectivity Obligatory kleptoparasites of the genus Ar- site number? Is a cluster of interconnected gyrodes Simon 1864 are completely depen- webs equivalent to a gigantic solitary web? dent on their host webs (Kullmann 1959; Voll- Does the distribution of kleptoparasites in host rath 1987; Cangialosi 1990; Miyashita 2001); webs appear to ®t the ideal free distribution from the perspective of the kleptoparasite, model, as suggested by Elgar (1993)? host webs are thus natural habitat patches, or Many authors have studied the biology of islands. -

Biol. Juan Maldonado Carrizales Maestro En Ciencias Biológicas
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS ÁREA TEMÁTICA EN ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN FACULTAD DE BIOLOGÍA Comunidades de arañas (Arachnida: Araneae) en ambientes urbanos y vegetación aledaña del Poniente de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. TESIS Que presenta Biol. Juan Maldonado Carrizales Requisito para obtener el grado de Maestro en Ciencias Biológicas Director: Dr. Javier Ponce Saavedra Co-Director: Dr. Alejandro Valdez Mondragón Morelia, Michoacán Marzo 2020 DEDICATORIA A Quetzali y Diana, gracias por su apoyo, comprensión y amor… ¡Las amo infinitamente! AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a Diana Ávila Trejo por toda la paciencia, apoyo y comprensión, todo el amor, experiencia y vida que me has brindado para poder concluir esta etapa de mi formación… Gracias amor por toda la dedicación y atención hacia nuestra guerrera que cuidamos y nos cuida, por cuidarme, por salirte de tu casa para convertirte en la mía… Gracias por ser mi equipo, mi inspiración, mi motor, mi todo…¡TE AMO SIEMPRE! Gracias a mi hija Quetzali Maldonado Ávila, que me has enseñado a ser mejor humano, por brindarme todo ese amor con solo una sonrisa, por ser tú la mejor de todas las personas en este mundo. Gracias por estar aquí mi niña guerrera ¡TE AMO! Quiero agradecer a mi madre Karina Carrizales Torres, quien siempre me ha apoyado y está ahí para cuidarme, aconsejarme y amarme, gracias por todo lo que me das con todo tu amor mamá, siempre te llevo conmigo ¡Te amo mamá! A mi abuela Ma. de la Luz Torres Trejo y mi tía Margarita Torres Trejo, que son como mis segundas mamás y me han enseñado que hay que trabajar para conseguir todo lo que queremos, gracias por todo su apoyo. -

Notes on the Reproductive Biology and Social Behavior of Two Sympatric Specie S of Philoponella (Araneae, Uloboridae)
1997 . The Journal of Arachnology 25 :11–1 9 NOTES ON THE REPRODUCTIVE BIOLOGY AND SOCIAL BEHAVIOR OF TWO SYMPATRIC SPECIE S OF PHILOPONELLA (ARANEAE, ULOBORIDAE) Deborah R. Smith: Department of Entomology, Haworth Hall, University of Kansas , Lawrence Kansas 66045 US A ABSTRACT . Populations of the facultatively communal species Philoponella oweni (Chamberlin 1924) and Philoponella arizonica (Gertsch 1936) (Uloboridae) occur sympatrically in the Chiricahua mountain s of southeastern Arizona . This study compares reproductive biology, structure of communal groups, an d feeding rates of the two species, and documents differences in their phenology, webs, web constructio n sites, egg-cases and spiderlings . I suggest environmental factors that may select for different reproductiv e strategies in the two species . Many members of the spider family Ulo- lived than females and disappear from th e boridae have been observed living in groups population during the course of the summer. (Opell 1979; Muma Gertsch 1964) . For Females can lay eggs throughout the summe r only a few of these species has the nature o f and may survive until early autumn, but in th e their group-living behavior been investigated : populations studied no adult females overwin- the facultatively communal Philoponella ow- tered for a second breeding season . eni (see Smith 1982, 1983) and P. semiplu- Immatures hatch and emerge from the egg - mosa (Simon 1893)(see Lahmann Eberhar d case during the summer. As is true of other 1979) ; P. republicana (Simon 1891), with its uloborid spiders, the young can spin webs in large, semi-permanent colonies (Smith 1985; the first post-emergence instar (Szlep 1961 ; Binford Rypstra 1992) ; and a west African Eberhard 1977) . -

1997. the Journal of Arachnology 25:11-19 NOTES on THE
1997. The Journal of Arachnology 25:11-19 NOTES ON THE REPRODUCTIVE BIOLOGY AND SOCIAL BEHAVIOR OF TWO SYMPATRIC SPECIES OF PHILOPONELLA (ARANEAE, ULOBORIDAE) Deborah R. Smith: Department of Entomology, Haworth Hall, University of Kansas, Lawrence Kansas 66045 USA ABSTRACT. Populations of the facultatively communal species Philoponella oweni (Chamberlin 1924) and Philoponella arizonica (Gertsch 1936) (Uloboridae) occur sympatrically in the Chiricahua mountains of southeastern Arizona. This study compares reproductive biology, structure of communal groups, and feeding rates of the two species, and documents differences in their phenology, webs, web construction sites, egg-cases and spiderlings. I suggest environmental factors that may select for different reproductive strategies in the two species. Many members of the spider family Ulo- lived than females and disappear from the boridae have been observed living in groups population during the course of the summer. (Opell 1979; Muma & Gertsch 1964). For Females can lay eggs throughout the summer only a few of these species has the nature of and may survive until early autumn, but in the their group-living behavior been investigated: populations studied no adult females overwin- the facultatively communal Philoponella ow- tered for a second breeding season. eni (see Smith 1982, 1983) and P. semiplu- Immatures hatch and emerge from the egg- mosa (Simon 1893)(see Lahmann & Eberhard case during the summer. As is true of other 1979); P. republicana (Simon 1891), with its uloborid spiders, the young can spin webs in instar large, semi-permanent colonies (Smith 1985; the first post-emergence (Szlep 1961; Eberhard The Binford & Rypstra 1992); and a west African 1977).