Wissenschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rudd (Scardinius Erythrophthalmus) Introduced to the Iberian Peninsula: Feeding Ecology in Lake Banyoles
Hydrobiologia 436: 159–164, 2000. 159 © 2000 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Rudd (Scardinius erythrophthalmus) introduced to the Iberian peninsula: feeding ecology in Lake Banyoles Emili Garc´ıa-Berthou & Ramon Moreno-Amich Departament de Ci`encies Ambientals & Institut d’Ecologia Aqu`atica, Universitat de Girona, E-17071 Girona, Catalonia, Spain Phone: +34 972 418 467. Fax: +34 972 418 150. E-mail: [email protected] Received in revised form 10 March 2000; accepted 20 June 2000 Key words: cyprinid fish, rudd, Scardinius erythrophthalmus, food, diet Abstract The first data on the ecology of rudd (Scardinius erythrophthalmus) introduced to the Iberian peninsula are presen- ted. The habitat and diet variation of rudd were studied in Lake Banyoles (Spain), an oligotrophic karstic lake dominated by exotic fish species. Rudd were strictly littoral and the diet was based on detritus and plant material. The most important animal prey were the cladocerans Daphnia longispina and Scapholeberis rammneri, amphi- pods and several late stages of nematoceran dipterans. Rudd were more zooplanktivorous in spring and autumn and less in summer. There was also a size-dependent diet shift, from microcrustaceans to macroinvertebrates. The diet of rudd was also distinguished by the importance of plant material and various small neustonic invertebrates, particularly S. rammneri and late stages of nematocerans, showing a strong resource partitioning with other fish species. The degree of herbivory in Lake Banyoles was lower than usual. Introduction or early 20th and since the 1980s are expanding their distribution (Burkhead & Williams, 1991), though Rudd (Scardinius erythrophthalmus) are medium- their interactions with native species remain unknown sized cyprinid fish native to freshwaters of Europe and (Easton et al., 1993). -
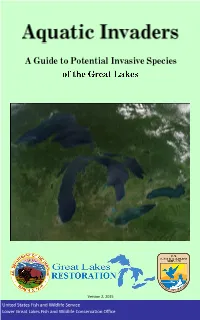
Labidesthes Sicculus
Version 2, 2015 United States Fish and Wildlife Service Lower Great Lakes Fish and Wildlife Conservation Office 1 Atherinidae Atherinidae Sand Smelt Distinguishing Features: — (Atherina boyeri) — Sand Smelt (Non-native) Old World Silversides Old World Silversides Old World (Atherina boyeri) Two widely separated dorsal fins Eye wider than Silver color snout length 39-49 lateral line scales 2 anal spines, 13-15.5 rays Rainbow Smelt (Non -Native) (Osmerus mordax) No dorsal spines Pale green dorsally Single dorsal with adipose fin Coloring: Silver Elongated, pointed snout No anal spines Size: Length: up to 145mm SL Pink/purple/blue iridescence on sides Distinguishing Features: Dorsal spines (total): 7-10 Brook Silverside (Native) 1 spine, 10-11 rays Dorsal soft rays (total): 8-16 (Labidesthes sicculus) 4 spines Anal spines: 2 Anal soft rays: 13-15.5 Eye diameter wider than snout length Habitat: Pelagic in lakes, slow or still waters Similar Species: Rainbow Smelt (Osmerus mordax), 75-80 lateral line scales Brook Silverside (Labidesthes sicculus) Elongated anal fin Images are not to scale 2 3 Centrarchidae Centrarchidae Redear Sunfish Distinguishing Features: (Lepomis microlophus) Redear Sunfish (Non-native) — — Sunfishes (Lepomis microlophus) Sunfishes Red on opercular flap No iridescent lines on cheek Long, pointed pectoral fins Bluegill (Native) Dark blotch at base (Lepomis macrochirus) of dorsal fin No red on opercular flap Coloring: Brownish-green to gray Blue-purple iridescence on cheek Bright red outer margin on opercular flap -

Summary Report of Freshwater Nonindigenous Aquatic Species in U.S
Summary Report of Freshwater Nonindigenous Aquatic Species in U.S. Fish and Wildlife Service Region 4—An Update April 2013 Prepared by: Pam L. Fuller, Amy J. Benson, and Matthew J. Cannister U.S. Geological Survey Southeast Ecological Science Center Gainesville, Florida Prepared for: U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Atlanta, Georgia Cover Photos: Silver Carp, Hypophthalmichthys molitrix – Auburn University Giant Applesnail, Pomacea maculata – David Knott Straightedge Crayfish, Procambarus hayi – U.S. Forest Service i Table of Contents Table of Contents ...................................................................................................................................... ii List of Figures ............................................................................................................................................ v List of Tables ............................................................................................................................................ vi INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 1 Overview of Region 4 Introductions Since 2000 ....................................................................................... 1 Format of Species Accounts ...................................................................................................................... 2 Explanation of Maps ................................................................................................................................ -

Kapuscinski Et Al 2012 Rudd Hydrobiologia
Hydrobiologia (2012) 693:169–181 DOI 10.1007/s10750-012-1106-0 PRIMARY RESEARCH PAPER Feeding patterns and population structure of an invasive cyprinid, the rudd Scardinius erythrophthalmus (Cypriniformes, Cyprinidae), in Buffalo Harbor (Lake Erie) and the upper Niagara River Kevin L. Kapuscinski • John M. Farrell • Michael A. Wilkinson Received: 16 July 2011 / Revised: 26 March 2012 / Accepted: 31 March 2012 / Published online: 19 April 2012 Ó Springer Science+Business Media B.V. 2012 Abstract Feeding patterns and population structure and supplemented their diet with algae and fish in of the non-native rudd Scardinius erythrophthalmus spring and fall. Feeding intensity was positively (Linnaeus) were examined to understand their ecology correlated with water temperature, but significantly in Buffalo Harbor and the Niagara River. We hypoth- reduced during spawning. Rudd condition and growth esized that (1) the diet of rudds would be omnivorous, were greater than estimates from other populations, but contain greater proportions of macrophytes in suggesting increases in abundance and range expan- summer months, (2) feeding intensity would increase sion are possible. Furthermore, reproduction was with water temperature, and (3) condition and growth successful at lotic sites but very poor at sites without would be similar to other populations. We collected measureable flow, contrary to the paradigm of optimal rudds with a variety of gears in 2009 to test these rudd habitat. Research is needed to understand how hypotheses, and used data from 2007 to 2010 seining herbivory by abundant rudd populations affects native surveys to determine if the relative abundance of aquatic communities. young-of-the-year rudd differed among sites with different flow conditions. -

(Rutilus, Teleostei, Cyprinidae) Molecular Phylogenetics and Evolut
ARTICLE IN PRESS Molecular Phylogenetics and Evolution xxx (2008) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Short Communication Molecular systematics, phylogeny and biogeography of roaches (Rutilus, Teleostei, Cyprinidae) V. Ketmaier a,*, P.G. Bianco b, J.-D. Durand c a Unit of Evolutionary Biology/Systematic Zoology, Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Karl-Liebknecht-Strasse 24-25, Haus 25, D-14476 Potsdam, Germany b Dipartimento di Zoologia, Università di Napoli ‘‘Federico II”, V. Mezzocannone 8, I-80134 Naples, Italy c IRD UR 070 RAP route des hydrocarbures, BP 1386, Bel Air, Dakar, Sénégal article info Article history: Received 7 March 2008 Revised 15 July 2008 Accepted 16 July 2008 Available online xxxx 1. Introduction two alternative hypotheses (Zardoya and Doadrio, 1999; Durand et al., 2000, 2002a,b, 2003; Ketmaier et al., 1998, 2003, 2004; Cyprinid species diversity is not evenly distributed across Eur- Tsigenopoulos et al., 2003 and references therein). Although many ope. Central Europe hosts a homogeneous ichthyofauna, while of these studies have invoked the Lago Mare phase to explain many taxa are endemic to relatively narrow Southern European patterns of divergence, evidence supporting it as the most likely areas. This led to the recognition of 13 ichthyogeographic districts scenario is not always unambiguous. around the Mediterranean Sea (Fig. 1), each of which characterized Here, we used roaches (genus Rutilus) to infer speciation pat- by its own assemblage of endemic species (Bianco, 1990). Two bio- terns of primary freshwater fishes in the Eastern peri-Mediterra- geographic hypotheses have been proposed to explain the evolu- nean area. -

AHNELT H. 2008. Bestimmungsschlüssel Für Die In
Ahnelt H. 2008 Bestimmungsschlüssel 1 BESTIMMUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE IN ÖSTERREICH VORKOMMENDEN FISCHE HARALD AHNELT Department für Theoretische Biologie, Fakultät für Lebenswissenschaften, Universität Wien, Althanstrasse 14, 1090 Wien [email protected] Online: 10 September 2008 Zitiervorschlag: Ahnelt H. 2008 Bestimmungsschlüssel für die in Österreich vorkommenden Fische. http://homepage.univie.ac.at/harald.ahnelt/Harald_Ahnelts_Homepage/Publications.html [Download-Datum] Bestimmungsschlüssel heimischer Fische Dieser Bestimmungsschlüssel ist für die Fischarten Österreichs ausgelegt. Merkmale und Merkmalskombinationen können daher bei Anwendung auf Fische anderer Länder zu nicht korrekten Ergebnissen führen. Identification key for Austrian freshwater fishes This identification key should only be used for fishes from Austrian freshwaters. This key will possibly not work for fishes from other European countries. Nobody is perfect – schon gar nicht ein Bestimmungsschlüssel. Ein Bestimmungsschlüssel baut auf charakteristischen Merkmalen auf, er vereinfacht und kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Auch dieser Bestimmungsschlüssel ist nur ein Versuch ein komplexes System in einen übersichtliche Form zu bringen. Die Natur sieht aber oft anders aus. Die Bandbreite an Merkmalen ist bei vielen Arten groß. Manche Populationen sind an unterschiedliche Umweltbedingungen angepasst und bilden unterscheidbare ökologische Formen. Andere Populationen sind isoliert und einige davon sind systematisch noch ungenügend erforscht. Möglicherweise taucht ja in Österreich noch die eine oder andere neue Art auf. Sollte es einmal nicht passen, oder wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat, ersuche ich um Information - [email protected] oder unter obiger Adresse. Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen sind willkommen. Ahnelt H. 2008 Bestimmungsschlüssel 2 Einleitung 1858 erschien das Buch „Die Süßwasserfische der Österreichischen Monarchie mit Rücksicht auf die angrenzenden Länder“, verfasst von den Österreichern Johann Jakob Heckel und Rudolf Kner. -

Rutilus Rutilus Linnaeus, 1758. Rutilo EXÓTICA
Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España ESPECIE Rutilus rutilus Linnaeus, 1758. Rutilo EXÓTICA ºo'" o< Q DESCRIPCIÓN Es una especie de talla media que no suele sobrepasar los 40 cm de longitud total aunque se co nocen individuos que han alcanzado los 50 cm de longitud y cerca de los 2 kg de peso. Su cuerpo es alto y comprimido lateralmente, con una cabeza pequeña que representa el 25% de la longitud del cuerpo. La aleta dorsal presenta de 9-11 radios blandos y es alta y de perfil cóncavo. La aleta anal es larga con 9-11 radios blandos. Las escamas son grandes y su número en la línea lateral es de 40-45. Sin dientes mandibulares o maxilares los dientes faríngeos se disponen en una fila en nú mero de 5-5. El número de cromosomas es 2n=50, en algunas poblaciónes es 2n=52. Clase: Actinopterygii Orden: Cypriniformes Familia: Cyprinidae Sinonimias: Cyprinus rutilus Linnaeus, 1758. Leuciscus rutilus (Linnaeus, 1758). Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Cyprinus ruttilus Linnaeus, 1758. Cyprinus ruhellio Leske, 1774. Cyprinus simus Hermann, 1804. Cyprinus lacustris Pallas, 1814. Cy prinus jaculus ]urine, 1825. Leuciscus decipiens Agassiz, 1835. Leuciscus prasinus Agassiz, 1835. Cyprinus fulvus Vallot, 1837. Cyprinus xanthopterus Vallot, 1837. Rutilus heckelii (Nordmann, 1840). Leuciscus heckelii Nordmann, 1840. Leucos ce nisophius Bonaparte, 1841. Gardonus pigulus Bonaparte, 1841. Leuciscus rutiloides Selys-Longchamps, 1842. Leuciscus sely sii Selys-Longchamps, 1842. Leuciscus lividus Heckel, 1843. Leuciscus pausingeri Heckel, 1843. Leucos pigulus Bonaparte, 1844. Leucos cenisophius Bonaparte, 1845. Leuciscus jurinii Dybowski, 1862. Leuciscus rutilus daugawensis Dybowski, 1862. -

58 1 Shelton.Pdf
The Open Access Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh As from January 2010 The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (IJA) will be published exclusively as an on-line Open Access (OA) quarterly accessible by all AquacultureHub (http://www.aquaculturehub.org) members and registered individuals and institutions. Please visit our website (http://siamb.org.il) for free registration form, further information and instructions. This transformation from a subscription printed version to an on-line OA journal, aims at supporting the concept that scientific peer-reviewed publications should be made available to all, including those with limited resources. The OA IJA does not enforce author or subscription fees and will endeavor to obtain alternative sources of income to support this policy for as long as possible. Editor-in-Chief Published under auspices of Dan Mires The Society of Israeli Aquaculture and Marine Biotechnology (SIAMB), Editorial Board University of Hawaii at Manoa Library Sheenan Harpaz Agricultural Research Organization and Beit Dagan, Israel University of Hawaii Aquaculture Zvi Yaron Dept. of Zoology Program in association with Tel Aviv University AquacultureHub Tel Aviv, Israel http://www.aquaculturehub.org Angelo Colorni National Center for Mariculture, IOLR Eilat, Israel Rina Chakrabarti Aqua Research Lab Dept. of Zoology University of Delhi Ingrid Lupatsch Swansea University Singleton Park, Swansea, UK Jaap van Rijn The Hebrew University Faculty of Agriculture Israel Spencer Malecha Dept. of Human Nutrition, Food and Animal Sciences University of Hawaii Daniel Golani The Hebrew University of Jerusalem Jerusalem, Israel Emilio Tibaldi Udine University Udine, Italy ISSN 0792 - 156X Israeli Journal of Aquaculture - BAMIGDEH. Copy Editor Ellen Rosenberg PUBLISHER: Israeli Journal of Aquaculture - BAMIGDEH - Kibbutz Ein Hamifratz, Mobile Post 25210, ISRAEL Phone: + 972 52 3965809 http://siamb.org.il The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 58(1), 2006, 3-28. -

Biodiversity Assessment for Georgia
Biodiversity Assessment for Georgia Task Order under the Biodiversity & Sustainable Forestry IQC (BIOFOR) USAID C ONTRACT NUMBER: LAG-I-00-99-00014-00 SUBMITTED TO: USAID WASHINGTON E&E BUREAU, ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES DIVISION SUBMITTED BY: CHEMONICS INTERNATIONAL INC. WASHINGTON, D.C. FEBRUARY 2000 TABLE OF CONTENTS SECTION I INTRODUCTION I-1 SECTION II STATUS OF BIODIVERSITY II-1 A. Overview II-1 B. Main Landscape Zones II-2 C. Species Diversity II-4 SECTION III STATUS OF BIODIVERSITY CONSERVATION III-1 A. Protected Areas III-1 B. Conservation Outside Protected Areas III-2 SECTION IV STRATEGIC AND POLICY FRAMEWORK IV-1 A. Policy Framework IV-1 B. Legislative Framework IV-1 C. Institutional Framework IV-4 D. Internationally Supported Projects IV-7 SECTION V SUMMARY OF FINDINGS V-1 SECTION VI RECOMMENDATIONS FOR IMPROVED BIODIVERSITY CONSERVATION VI-1 SECTION VII USAID/GEORGIA VII-1 A. Impact of the Program VII-1 B. Recommendations for USAID/Georgia VII-2 ANNEX A SECTIONS 117 AND 119 OF THE FOREIGN ASSISTANCE ACT A-1 ANNEX B SCOPE OF WORK B-1 ANNEX C LIST OF PERSONS CONTACTED C-1 ANNEX D LISTS OF RARE AND ENDANGERED SPECIES OF GEORGIA D-1 ANNEX E MAP OF LANDSCAPE ZONES (BIOMES) OF GEORGIA E-1 ANNEX F MAP OF PROTECTED AREAS OF GEORGIA F-1 ANNEX G PROTECTED AREAS IN GEORGIA G-1 ANNEX H GEORGIA PROTECTED AREAS DEVELOPMENT PROJECT DESIGN SUMMARY H-1 ANNEX I AGROBIODIVERSITY CONSERVATION IN GEORGIA (FROM GEF PDF GRANT PROPOSAL) I-1 SECTION I Introduction This biodiversity assessment for the Republic of Georgia has three interlinked objectives: · Summarizes the status of biodiversity and its conservation in Georgia; analyzes threats, identifies opportunities, and makes recommendations for the improved conservation of biodiversity. -
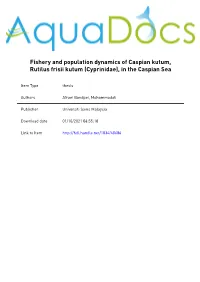
Fishery and Population Dynamics of Caspian Kutum, Rutilus Frisii Kutum (Cyprinidae), in the Caspian Sea
Fishery and population dynamics of Caspian kutum, Rutilus frisii kutum (Cyprinidae), in the Caspian Sea Item Type thesis Authors Afraei Bandpei, Mohammadali Publisher Universiti Sains Malaysia Download date 01/10/2021 06:55:18 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/40686 FISHERY AND POPULATION DYNAMICS OF CASPIAN KUTUM, Rutilus frisii kutum (CYPRINIDAE), IN THE CASPIAN SEA by MOHAMMADALI AFRAEI BANDPEI Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy October 2010 ACKNOWLEDGEMENT All praises to Allah Almighty whose countless blessings enabled me to complete this thesis. The Iranian Fisheries Research Organization (IFRO) and Agriculture Training Research Organization (ATRO) supported this study. The materials were obtained from a my province project entitle “Age, growth, feeding items, and reproductive of Rutilus frisii kutum in the Caspian Sea‟‟ performed with cooperation at the Caspian Sea Ecological Research Center in Sari, Inlandwaters Aquaculture Research Center in Guilan, and Inlandwaters Aquatic Stock Research Center in Golestan provinces. Thanks are due to the previous and now managers of the Agriculture Training Research Organization (ATRO) Dr. Khalghani and Dr. Pourhemat and to the head of the Iranian Fisheries Research Oraganization (IFRO) Dr. Motalebi, for financial support. I am very grateful to my supervisor, Prof. Mashhor Mansor who always gives me constructive advices, guidance, encouragement, critical reading, and moral support during the research of my thesis, thank you so much. My former co-supervisor, Dr. Khoo Kay Huat, thank you for your help especially on fish physiology and ecology. I would like to thanks my co-supervisors, associate Prof. Dr. Shahrul Anuar Mohd Sah and Dr. -

View/Download
SILURIFORMES (part 10) · 1 The ETYFish Project © Christopher Scharpf and Kenneth J. Lazara COMMENTS: v. 25.0 - 13 July 2021 Order SILURIFORMES (part 10 of 11) Family ASPREDINIDAE Banjo Catfishes 13 genera · 50 species Subfamily Pseudobunocephalinae Pseudobunocephalus Friel 2008 pseudo-, false or deceptive, referring to fact that members of this genus have previously been mistaken for juveniles of various species of Bunocephalus Pseudobunocephalus amazonicus (Mees 1989) -icus, belonging to: Amazon River, referring to distribution in the middle Amazon basin (including Rio Madeira) of Bolivia and Brazil Pseudobunocephalus bifidus (Eigenmann 1942) forked, referring to bifid postmental barbels Pseudobunocephalus iheringii (Boulenger 1891) in honor of German-Brazilian zoologist Hermann von Ihering (1850-1930), who helped collect type Pseudobunocephalus lundbergi Friel 2008 in honor of John G. Lundberg (b. 1942), Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Friel’s Ph.D. advisor, for numerous contributions to neotropical ichthyology and the systematics of siluriform and gymnotiform fishes Pseudobunocephalus quadriradiatus (Mees 1989) quadri-, four; radiatus, rayed, referring to four-rayed pectoral fin rather than the usual five Pseudobunocephalus rugosus (Eigenmann & Kennedy 1903) rugose or wrinkled, referring to “very conspicuous” warts all over the skin Pseudobunocephalus timbira Leão, Carvalho, Reis & Wosiacki 2019 named for the Timbira indigenous groups who live in the area (lower Tocantins and Mearim river basins in Maranhão, Pará and -
Museum of Comparative Zoölogy
SENATE. No. 252 ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES OF THE MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY, AT HARVARD COLLEGE, IN CAMBRIDGE: TOGETHER WITH THE REPORT OF THE DIRECTOR FOR 1872. BOSTON: WRIGHT & POTTER, STATE PRINTERS, 19 Province Street. 1 8 73. CmnmomDcaltl) of itlassadjiisctts. Boston, Mass., June 4, 1873. To the Hon. George B. Loring, President of the Senate. Sir .-—The Trustees of the Museum of Comparative Zoology have the honor to present to the Legislature the Annual Report of the Director, for the past year, marked [A]. The paper marked [B] contains a list of the Trustees, offi- cers and committees for 1873. Respectfully submitted, for the Trustees, MARTIN BRIMMER, Secretary. 4 COMPARATIVE ZO-OLOGY. [June, [A.] REPORT OF THE DIRECTOR OF THE MUSEUM OE COMPARATIVE ZOOLOGY, For the Year 1872. It gives me the greatest pleasure to state that my absence, though extended to nearly a year, has not in the slightest degree interfered with the progress of the Museum. Mr. Cary, the Superintendent, has directed the business of our Institution with so much ability, forethought and diligence, anticipating and providing for the needs of each working department, that there have been no unnecessary delays or interruptions. His special Report contains the details of his administration. The scientific officers of the Museum have shown the utmost zeal and fidelity, carrying on the work of the separate laboratories so efficiently that I can truly say the results of the year have far exceeded my most sanguine expectations. There is one inference to be drawn from this statement which is of great importance, though few perhaps can value it as highly as Ido myself.