Ein Dorf in Westghana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
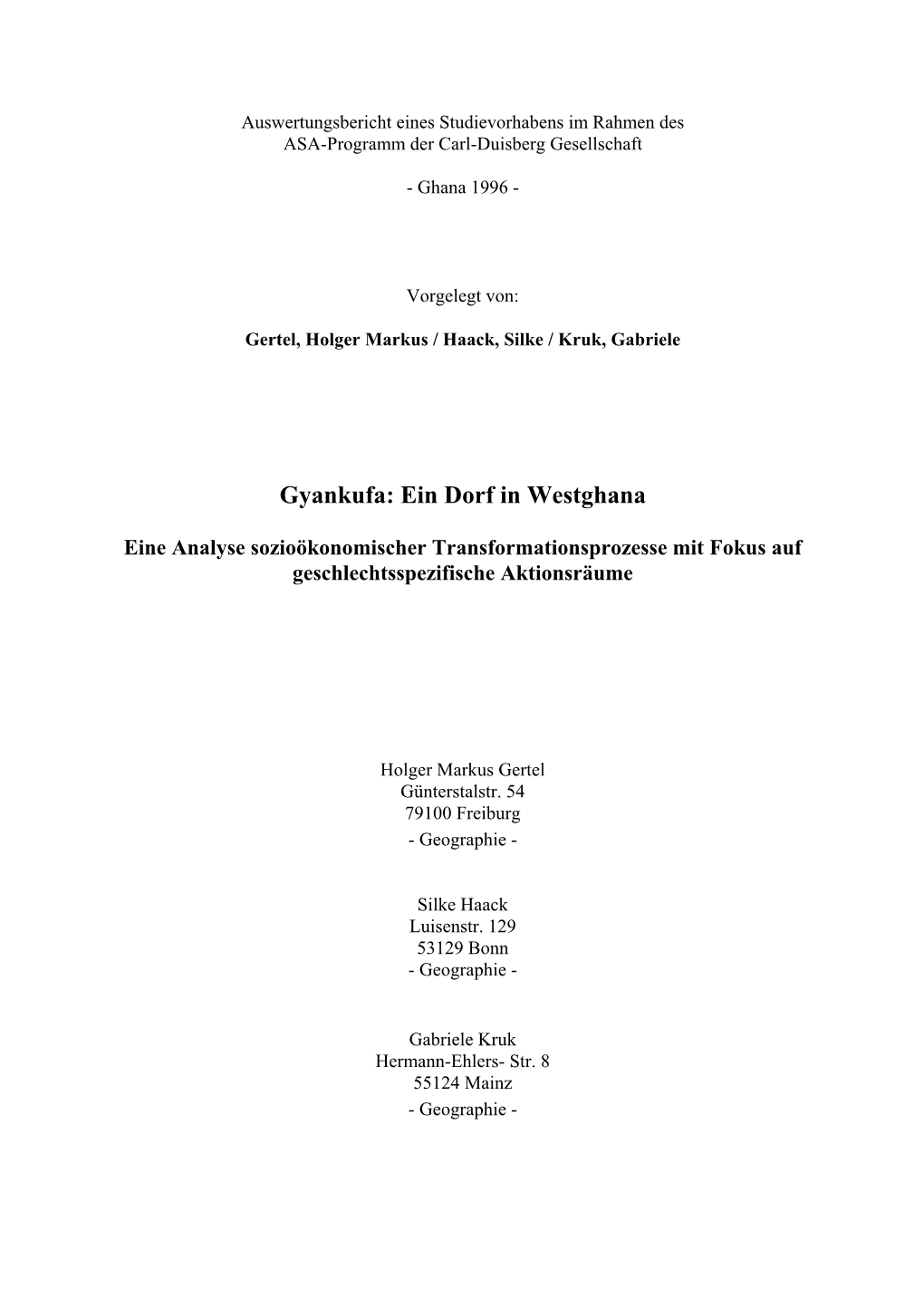
Load more
Recommended publications
-

Dormaa Municipal Assembly
REPUBLIC OF GHANA THE COMPOSITE BUDGET OF THE DORMAA MUNICIPAL ASSEMBLY FOR THE 2013 FISCAL YEAR Dormaa Municipal Assembly Page 1 For Copies of this MMDA’s Composite Budget, please contact the address below: The Coordinating Director, Dormaa Municipal Assembly Brong Ahafo Region This 2013 Composite Budget is also available on the internet at: www.mofep.gov.gh or www.ghanadistricts.com Dormaa Municipal Assembly Page 2 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................ 6 CURRENT SITUATION ANALYSIS ..................................................................... 7 PHYSICAL CHARACTERISTICS ------------------------------------------------------------------------ 7 LOCATION AND SIZE ----------------------------------------------------------------------------------- 7 TOPOGRAPHY AND DRAINAGE ------------------------------------------------------------------------- 7 CLIMATE AND VEGETATION ---------------------------------------------------------------------------- 8 GEOLOGY AND SOILS ---------------------------------------------------------------------------------- 9 NATURAL RESOURCES --------------------------------------------------------------------------------- 10 POPULATION SIZE AND GROWTH RATE ------------------------------------------------------------- 11 SETTLEMENT PATTERN -------------------------------------------------------------------------------- 12 LABOUR FORCE ---------------------------------------------------------------------------------------- -

Exports, Employment and Incomes in West Africa – January 2011
EXPORTS, EMPLOYMENT AND INCOMES IN WEST AFRICA – JANUARY 2011 EXPORTS, EMPLOYMENT AND INCOMES IN WEST AFRICA WEST AFRICA TRADE HUB TECHNICAL REPORT NO. 39 January 2011 Acknowledgments The author wishes to express gratitude to the numerous individuals in the countries that participated in this study who donated hours of their time to answer questions. This report could not have been produced without the support of USAID‘s West Africa Trade Hub under the direction of Vanessa Adams. The able assistance and devotion of Kafui Djonou was instrumental in coordination of field activities; Jane Owiredu-Yeboah administered the contracts; and, Nathan Van Dusen reviewed drafts of the study. Dr. Jeffrey Cochrane of USAID‘s Economic Growth team provided clarity of purpose and ensured its fit with USAID‘s broader development agenda. The University of Ghana was a critical partner as were volunteers of the U.S. Peace Corps in Burkina Faso, Ghana and Mali. DISCLAIMER The author‘s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. 2 EXPORTS, EMPLOYMENT AND INCOMES IN WEST AFRICA – JANUARY 2011 Contents Acknowledgments ................................................................................................................. 2 Contents ................................................................................................................. 3 Figures ................................................................................................................ -

Public Procurement Authority. Draft Entity Categorization List
PUBLIC PROCUREMENT AUTHORITY. DRAFT ENTITY CATEGORIZATION LIST A Special Constitutional Bodies Bank of Ghana Council of State Judicial Service Parliament B Independent Constitutional Bodies Commission on Human Rights and Administrative Justice Electoral Commission Ghana Audit Service Lands Commission Local Government Service Secretariat National Commission for Civic Education National Development Planning Commission National Media Commission Office of the Head of Civil Service Public Service Commission Veterans Association of Ghana Ministries Ministry for the Interior Ministry of Chieftaincy and Traditional Affairs Ministry of Communications Ministry of Defence Ministry of Education Ministry of Employment and Labour Relations Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation Ministry of Finance Ministry Of Fisheries And Aquaculture Development Ministry of Food & Agriculture Ministry Of Foreign Affairs And Regional Integration Ministry of Gender, Children and Social protection Ministry of Health Ministry of Justice & Attorney General Ministry of Lands and Natural Resources Ministry of Local Government and Rural Development Ministry of Petroleum Ministry of Power PUBLIC PROCUREMENT AUTHORITY. DRAFT ENTITY CATEGORIZATION LIST Ministry of Roads and Highways Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts Ministry of Trade and Industry Ministry of Transport Ministry of Water Resources, Works & Housing Ministry Of Youth And Sports Office of the President Office of President Regional Co-ordinating Council Ashanti - Regional Co-ordinating -

Jaman South District Assembly
REPUBLIC OF GHANA THE COMPOSITE BUDGET OF THE JAMAN SOUTH DISTRICT ASSEMBLY FOR THE 2013 FISCAL YEAR Jaman South District Assembly Page 1 For Copies of this MMDA’s Composite Budget, please contact the address below: The Coordinating Director, Jaman South District Assembly Brong Ahafo Region This 2013 Composite Budget is also available on the internet at: www.mofep.gov.gh or www.ghanadistricts.com Jaman South District Assembly Page 2 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ............................................................................................ 6 BACKGROUND ............................................................................................... 7 Establishment ................................................................................................................................. 7 District Assembly Structure ..................................................................................................... 7 Sub-district structures ............................................................................................................... 8 Vision ................................................................................................................................................... 8 Mission Statement ........................................................................................................................ 8 Area of Coverage ........................................................................................................................... 9 Location and size ......................................................................................... -

The Gyaman of Ghana and Côte D'ivoire In
Vol. 5(7), pp. 177-189, November, 2013 DOI: 10.5897/JASD12.049 Journal of African Studies and ISSN 2141 -2189 ©2013 Academic Journals Development http://www.academicjournlas.org/JASD Full Length Research Paper The people the boundary could not divide: The Gyaman of Ghana and Côte D’ivoire in historical perspective Agyemang, Joseph Kwadwo1 and Ofosu-Mensah, Ababio Emmanuel2* 1Institute of African Studies, P.O. Box LG 73, University of Ghana, Legon, Accra-Ghana. 2Department of History, P.O. Box LG 12 University of Ghana, Legon, Accra-Ghana. Accepted 19 September, 2013 This article aims at constructing the history of the Gyaman state before colonial rule. It is the first in a series of three papers to be published in the Journal of African Studies and Development. The current paper shall interrogate the pre-colonial political structures that culminated in the formation of the Gyaman state. It also discusses the socio-politico-economic activities of the Gyaman people before colonial domination by both the British and the French. The discussion of the early history of Gyaman and its constitution is important as it sets the background for understanding the Gyaman people and their history of resilience and also sets the background for understanding subsequent modern issues confronting this great West African traditional state. Key words: Gyaman, Ghana, La Côte d’Ivoire, traditional, state. INTRODUCTION A version of their traditional account states that the fifteenth century. Traditions tell us that after the death of Gyaman people left Akwamu in the first decade of the the fifth Hemang ruler, succession disputes compelled a seventeenth century and lived in Suntreso, now a suburb section of the community led by Otumfo Asare to migrate of Kumasi as Dormaa people. -

Parental Involvement in the Education of Children With
www.udsspace.uds.edu.gh UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES, TAMALE PARENTAL INVOLVEMENT IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE JAMAN NORTH DISTRICT OF GHANA SEIDU JUSTICE ADAMS 2018 www.udsspace.uds.edu.gh UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES, TAMALE PARENTAL INVOLVEMENT IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE JAMAN NORTH DISTRICT OF GHANA BY SEIDU JUSTICE ADAMS (UDS/MTD/0011/13) THIS THESIS IS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL FOUNDATIONS, FACULTY OF EDUCATION IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE AWARD OF A MASTER OF PHILOSOPHY DEGREE IN TRAINING AND DEVELOPMENT JUNE, 2018 www.udsspace.uds.edu.gh DECLARATION Student I hereby declare that this dissertation/thesis is the result of my own original work and that no part of it has been presented for another degree in this university or elsewhere: Candidate’s Signature ……………………… Date………………… Name: Seidu Justice Adams (Index No. UDS/MTD/0011/13) Supervisor I hereby declare that the preparation and presentation of the dissertation/thesis was supervised in accordance with guidelines on supervision of dissertation/thesis laid down by the University for Development Studies. Supervisor’s Signature:……………………….. Date………………… Name DR. ABDUL-RAZAK KUYINI ALHASSAN ii www.udsspace.uds.edu.gh ABSTRACT This study explored parental involvement in the education of the child with disabilities (CWD) in Jaman North District of the Brong-Ahafo Region of Ghana. Specifically, the study investigated parents’ expectations of the CWD in school, parents’ involvement in decision making process in the schools of CWD, parents’ contributions and collaborations between parents and teachers to enhance learning outcome of the CWD in schools. -

PETER KWASI SARPONG THESIS 2011.Pdf
AN ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF CASHEW PRODUCTION TO LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT, A CASE STUDY OF THE BRONG AHAFO REGION BY PETER KWASI SARPONG B. A (HONS.) A Thesis submitted to the School of Graduate Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE in Development Policy and Planning, College of Architecture and Planning SEPTEMBER, 2011 DECLARATION I hereby declare that this work is my own work towards the Master of Science degree and that to the best of my knowledge, it contains no material previously published by another person nor material which has been accepted for the award of any other degree of the University, except where due acknowledgement has been made in the text. Peter Kwasi Sarpong (PG1861807) …………………… ………………….. (Student Name & ID) Signature Date Certified by: Dr. K. O. Agyeman …………………...... ……………................ (Supervisor) Signature Date Certified by: Dr. Imoro Braimah ……………………… .……………………… Head, Department of Planning Signature Date ii ABSTRACT Effective poverty reduction in Ghana is underpinned by sustainable local economic growth and development. It is for this reason that the Government of Ghana aims to ensure local ownership of development interventions. One way of ensuring local economic development is through the promotion of non-traditional agricultural commodities such as cashew. With the Brong Ahafo Region‟s comparative advantage in the production of cashew, the industry has gained currency with several farmers engaged by it. Following this the study sought to assess the contribution of the cashew industry to the local economic development towards poverty reduction. With data from both primary and secondary sources, the study identified that first; the cashew industry has provided employment to about 8,233 people in Jaman North, Tain, Wenchi and Kintampo districts. -

Greater Accra Region
NATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY LIST OF AUTHORISED VHF-FM RADIO STATIONS IN GHANA AS AT SECOND QUARTER, 2012 Last updated on the 25th June, 2012 1 NATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY LIST OF FM STATIONS IN THE COUNTRY AS AT SECOND QUARTER, 2012 NO. NAME OF TOTAL NO. PUBLIC COMMUN CAMPUS COMMER TOTAL TOTAL REGIONS AUTHORIS ITY CIAL NO. IN NO. NOT ED OPERATI IN ON OPERATI ON 1. Greater Accra 44 5 5 2 32 38 6 2. Ashanti 37 3 0 2 32 34 3 3. Brong Ahafo 40 3 5 0 32 30 10 4. Western 40 5 2 1 32 34 6 5. Central 25 2 7 3 13 22 3 6. Eastern 27 2 5 1 19 22 5 7. Volta 23 3 3 1 16 15 8 8. Northern 23 7 4 0 12 19 4 9. Upper East 9 1 3 1 4 8 1 10. Upper West 8 3 5 0 0 6 2 Total 276 34 39 11 192 228 48 Last updated on the 25th June, 2012 2 GREATER ACCRA REGION S/N Name and Address of Date of Assigned On Air Not Location (Town Type of Station Company Authorisation Frequency on Air /City) 1. MASCOTT MULTI- 13 – 12 – 95 87.9MHz On Air Accra Commercial FM SERVICES LIMITED. (ATLANTIS RADIO) Box PMB CT 106, Accra Tel: 0302 7011212/233308 Fax:0302 230871 Email: 2. SKY BROADCASTING 14 – 04 - 97 88.7MHz On Air Accra Commercial FM COMPANY LTD. (SUNNY FM) Box CT 3850, Accra Tel : 0302-225716/9 Fax :0302-221981 Email :[email protected] 3. -

Illness and Curing in Berekum, Ghana
ILLNESS AND CURING IN BEREKUM, GHANA KOFI BISMARK EFFAH B.A. (HONS.), UNIVERSITY OF GHANA, LEGON, 1986 THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in the ,Department of SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 0 KOFI BISMARK EFFAH 1991 SIMON FRASER UNIVERSITY August 1991 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. APPROVAL Name: KOFI BISMARK EFFAH Degree: MASTER OF ARTS Title of thesis: ILLNESS AND CURING IN BEREKUM, GHANA Examining Committee: Chair: DR. J. WHITWORTH DR&M%'AYES ' EXTERNAL EXAMINER DEPARTMENT OF GEOGRAPHY SIMON FRASER UNIVERSITY . , PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, project or extended essay (the ti tie of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the , library of any orher university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. 1 further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for financial gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesis/Project/Extended Essay Illness and Curing in Berekum, Ghana Author: - I ' (s iYgnature) Kofi Bismark Effah (name) July 30, 1991 (date) ABSTRACT The thesis examines the ways in which illness is conceived, explained and confronted in Berekum, Ghana. -
Jaman South District
JAMAN SOUTH DISTRICT Copyright (c) 2014 Ghana Statistical Service ii PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENT No meaningful developmental activity can be undertaken without taking into account the characteristics of the population for whom the activity is targeted. The size of the population and its spatial distribution, growth and change over time, in addition to its socio-economic characteristics are all important in development planning. A population census is the most important source of data on the size, composition, growth and distribution of a country’s population at the national and sub-national levels. Data from the 2010 Population and Housing Census (PHC) will serve as reference for equitable distribution of national resources and government services, including the allocation of government funds among various regions, districts and other sub-national populations to education, health and other social services. The Ghana Statistical Service (GSS) is delighted to provide data users, especially the Metropolitan, Municipal and District Assemblies, with district-level analytical reports based on the 2010 PHC data to facilitate their planning and decision-making. The District Analytical Report for the Jaman South District is one of the 216 district census reports aimed at making data available to planners and decision makers at the district level. In addition to presenting the district profile, the report discusses the social and economic dimensions of demographic variables and their implications for policy formulation, planning and interventions. The conclusions and recommendations drawn from the district report are expected to serve as a basis for improving the quality of life of Ghanaians through evidence- based decision-making, monitoring and evaluation of developmental goals and intervention programmes. -

Greater Accra Region
NATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY LIST OF AUTHORISED VHF-FM RADIO STATIONS IN GHANA AS AT FIRST QUARTER, 2013 Last updated on the 31ST March, 2013 1 NATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY LIST OF FM STATIONS IN THE COUNTRY AS AT FIRST QUARTER, 2013 NO. NAME OF TOTAL NO. PUBLIC COMMUN CAMPUS COMMER TOTAL TOTAL REGIONS AUTHORIS ITY CIAL NO. IN NO. NOT ED OPERATI IN ON OPERATI ON 1. Greater Accra 47 5 6 3 33 42 5 2. Ashanti 46 3 3 2 38 37 3 3. Brong Ahafo 43 3 5 0 35 30 13 4. Western 47 6 4 1 36 34 13 5. Central 26 2 7 3 14 22 4 6. Eastern 29 2 5 1 21 23 6 7. Volta 27 3 4 1 19 16 11 8. Northern 26 7 7 0 12 20 6 9. Upper East 12 2 3 1 6 9 3 10. Upper West 13 3 7 0 3 7 6 Total 316 36 51 12 217 240 76 Last updated on the 31ST March, 2013 2 GREATER ACCRA REGION S/N Name and Address of Date of Assigned On Air Not Location (Town Type of Station Company Authorisation Frequency on Air /City) 1. MASCOTT MULTI- 13 – 12 – 95 87.9MHz On Air Accra Commercial FM SERVICES LIMITED. (ATLANTIS RADIO) Box PMB CT 106, Accra Tel: 0302 7011212/233308 Fax:0302 230871 Email: 2. SKY BROADCASTING 14 – 04 - 97 88.7MHz On Air Accra Commercial FM COMPANY LTD. (SUNNY FM) Box CT 3850, Accra Tel : 0302-225716/9 Fax :0302-221981 Email :[email protected] 3. -

Natural Resources Systems Programme Project Report1
NATURAL RESOURCES SYSTEMS PROGRAMME PROJECT REPORT1 DFID Project Number R8258 Report Title Informing the policy process: Decentralisation and environmental democracy in Ghana. Scientific report. Annex A of the Final Technical Report of project R8258. Report Authors Brown, D. and Amanor, K. Organisation ODI and Institute of African Studies, University of Ghana. Date 2006 NRSP Production System Forest Agriculture Interface 1 This document is an output from projects funded by the UK Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID. Final Technical Report R8258 Annex A 1. INTRODUCTION ...................................................................................................... 1 The Kintampo Districts....................................................................................................... 3 Land tenure and land administration................................................................................... 7 Decentralisation .................................................................................................................. 9 Research Methodology ..................................................................................................... 10 The role of information............................................................................................. 14 Action research ......................................................................................................... 17 The organisation of