John Anthony Thwaites (1909-1981)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aus Datenschutz- Bzw. Urheberrechtlichen Gründen Erfolgt Die Publikation Mit Anonymisierung Von Namen Und Ohne Abbildungen
Provenienzbericht zu Pablo Picasso, „Tête de femme, de profil“, 40,9 x 37,5 cm (Lostart-ID: 533083) Version nach Review v. 20.03.2018 ǀ Projekt Provenienzrecherche Gurlitt (Stand: 17.09.2017) Aus datenschutz- bzw. urheberrechtlichen Gründen erfolgt die Publikation mit Anonymisierung von Namen und ohne Abbildungen. © A. W. © A. W. Abschlussbericht zu Lostart-ID: 533083 - Pablo Picasso: Tête de femme, de profil Ev-Isabel Raue 1. Daten Künstler Pablo Picasso (1881-1973) Titel Tête de femme, de profil (vgl. WVZ) Alternativer Titel Frauenkopf im Profil (vgl. Ausst.kat. Barcelona/Bern 1992) Maße 40,9 x 37,5 cm (Blattgröße) [vgl. Zustandsprotokolle] Technik Kaltnadelradierung [?] [Papierart ?] Wasserzeichen / Signatur / Datierung der Druckplatte 1905 Befund der Blattvorderseite Beschriftung: a) Unten links handschriftlich in Bleistift [?]: „G. 7.“ [Beschriftung bezieht sich vermutlich auf das WVZ von Bernhard Geiser bzw. von Geiser/Baer.] b) Unten rechts handschriftlich in Bleistift [?]: „350.- „ Seite 1 von 17 Provenienzbericht zu Pablo Picasso, „Tête de femme, de profil“, 40,9 x 37,5 cm (Lostart-ID: 533083) Version nach Review v. 20.03.2018 ǀ Projekt Provenienzrecherche Gurlitt (Stand: 17.09.2017) [Verkaufspreis der Kunsthandlung Aug. Klipstein vorm. Gutekunst & Klipstein, Bern] c) Unten rechts Prägestempel: „L. Fort Imprimeur Paris“ Rückseitenbefund Beschriftung: a) Unten links in Bleistift: „B/32“ [umrahmt] b) Unten links in Bleistift: „350.-“ [Verkaufspreis der Kunsthandlung Aug. Klipstein vorm. Gutekunst & Klipstein, Bern] c) Unten links in Bleistift: „180_83“ d) Mitte in Bleistift: „05937“ [Bestands-Nr. der Kunsthandlung Aug. Klipstein vorm. Gutekunst & Klipstein, Bern] Werkverzeichnisse (WVZ) a) Bloch 1968, S. 21, Kat.-Nr. 6. b) Geiser/Baer 1990, Bd. -

Sediment – Mitteilung Zur Geschichte Des Kunsthandels, Heft 7: Ganz Am Anfang – Richter, Polke, Lueg Und Kuttner, 2004, P
Günter Herzog: How It All Began, in: Sediment – Mitteilung zur Geschichte des Kunsthandels, Heft 7: Ganz am Anfang – Richter, Polke, Lueg und Kuttner, 2004, p. 33-41. “I remember very well how close our friendship was then. But also how hard it sometimes was. At the time I wasn’t so conscious of the fact. To us the way we spoke to each other was perfectly natural. In hindsight I’m amazed that it was so brutal.”1 Gerhard Richter Two of the four friends managed to hold out (with a little help from their friends) and today are two of the internationally most highly regarded contemporary artists, namely, Gerhard Richter and Sigmar Polke. The third doubted his own artistic capabilities (again with a little help from his friends), changed sides and turned into one of the most significant and influential gallerists for Minimal, Conceptual and Land Art in Europe, namely, Konrad Fischer who took his mother’s maiden name as an artist, “so as to avoid any possible mix-ups with the common name of Fischer”.2 The fourth quite consciously in 1967 decided (with a little help from his friends) to dedicate himself to his young family of wife and two children and the obligations this entailed, namely, Manfred Kuttner, who exchanged his (all too free) freelance artist’s existence for the fetters of an assured income in the advertising studio of the Hilden Ducolux Paint Factory. The story of this 4-way (just as short as it was intense) friendship, which burst on the scene in 1962 and gradually broke up after 1965, began with a short prelude in Dresden in the year 1957. -

Annorak6 Engl.Pdf
a u u o RAK 6 RAK 6 RAK o u u a a u u o RAK Report from the Rhenish Archive for Artists’ Legacies Issue 6 Bonn 2018 5 Editorial European Heritage – Artistic Heritage as a Cultural Asset 14 Welcome: Rein Wolfs Director of the Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany) 18 Greeting: Jürgen Wilhelm Chairman of the Landschaftsversammlung Rheinland (Rhineland Regional Assembly), Germany 20 Opening lecture: Aleida Assmann University of Konstanz, Germany On the Materiality and Methodology of Legacy Archives for Artists 30 Daniel Schütz, Rheinisches Archiv für Künstlernachlässe (Rhenish Archive for Artists’ Legacies), Bonn, Germany 38 Marie-Luise Heske, Stiftung für Konkrete Kunst und Design (Foundation for Concrete Art and Design), Ingolstadt, Germany 42 Amy Marshall Furness, Art Gallery of Ontario, Toronto, Canada European and international networks 50 Tiziana Caianiello, ZERO foundation, Düsseldorf, Germany 56 Edith Krebs, European-art.net, Zürich, Switzerland 58 Volker Kaukoreit, KOOP-LITERA international, Vienna, Austria 64 Thomas Gaehtgens, Getty Research Institute, Los Angeles, USA European Perspectives for Artist’s Legacies 74 Desdemona Ventroni, Institute for Advanced Studies, Lucca, Italy 80 Monika Mayer, Österreichische Galerie Belvedere (Austrian Belvedere Gallery), Vienna, Austria 84 Michael Schmid, Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA), Zürich, Switzerland 92 Adrian Glew, Tate, London, United Kingdom 96 Frank van de Schoor, Curator, Nimwegen, Netherlands 100 Jeanette Zwingenberger, Art Critic and Curator, Paris, France 108 Didier Schulmann, Centre Pompidou, Paris, France Prospects 112 Frank Michael Zeidler, Deutscher Künstlerbund (German Artist’s Association) 120 Gora Jain, Bundesverband Künstlernachlässe (German Association of Artistic Heritage) 124 Inventory list 130 Imprint European Heritage, Discussion panel. -
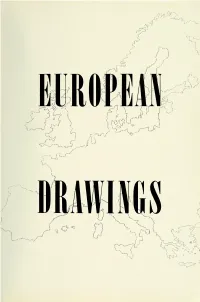
EUROPEAN DRAWINGS Follows a Similarly Conceived
Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Solomon R. Guggenheim Museum Library and Archives http://www.archive.org/details/europeandrawingsOOallo EUROPEAN DRAWINGS THE SOLOMON It. GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK Published by The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1966 All Rights Reserved Library of Congress Card Catalogue Number: 66-17460 Printed in The Netherlands THE SOLOMON K. Cl'GGKNHEIM FOUNDATION 'I'KrsTKKS IIARRV F. GUGGENHEIM, PRESIDENT ALBERT E. TII1EI.K, VICE PRESIDEN" II. II. ARNASON. VICE PRESIDENT, ART ADMINISTRATION PETER O. LAWSON-JOHNSTON, VICE PRESIDENT, BUSINESS ADMINISTRATION ELEANOR, COUNTESS CASTLE STEWART DANA DRAPER A. CIIAUNCEY SEWLIN MRS. HENRY OBRE DANIEL CATTON RICH MICHAEL F. WETTACH MEDLEY <;. B. WHELPLEY CARL ZIGROSSER A series of drawing shows, no less than three, were held at The Solomon R. Guggenheim Museum since 1962. They have proved their relevance to the museum's exhibition program and their appeal for the public. EUROPEAN DRAWINGS follows a similarly conceived American installment presented here in 1964. Neither of the two selections was made to point to continental attributes and the decision between "American" and "European" is therefore an arbitrary one that allowed for convenient concentration within a limitable geographic entity. Lawrence Alloway, the Museum's curator, has chosen both shows. The current selection, which like its predecessor will be presented in museums and art centers throughout the United States and Canada, features 37 artists from 13 countries. Thomas M. Messer, Director ACKNOWLEDGEMENTS I am grateful to Arne Ekstrom, Robert Fraser, Alexander Iolas, Mr. and Mrs. John Lefebre, Pierre Matisse, and Arturo Schwarz for theirpersonal help in the preparation of this exhibition. -

Yayoi Kusama: Biography and Cultural Confrontation, 1945–1969
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works Dissertations, Theses, and Capstone Projects CUNY Graduate Center 2012 Yayoi Kusama: Biography and Cultural Confrontation, 1945–1969 Midori Yamamura The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/4328 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] YAYOI KUSAMA: BIOGRAPHY AND CULTURAL CONFRONTATION, 1945-1969 by MIDORI YAMAMURA A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Art History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2012 ©2012 MIDORI YAMAMURA All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Art History in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Anna C. Chave Date Chair of Examining Committee Kevin Murphy Date Executive Officer Mona Hadler Claire Bishop Julie Nelson Davis Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii Abstract YAYOI KUSAMA: BIOGRAPHY AND CULTURAL CONFRONTATION, 1945-1969 by Midori Yamamura Adviser: Professor Anna C. Chave Yayoi Kusama (b.1929) was among the first Japanese artists to rise to international prominence after World War II. She emerged when wartime modern nation-state formations and national identity in the former Axis Alliance countries quickly lost ground to U.S.-led Allied control, enforcing a U.S.-centered model of democracy and capitalism. -

Hanne Darboven's Computer
Hanne Darboven. Month III (March ), 1974. © 2016 Artists Rights Society (ARS), New York/VG Bild-Kunst, Bonn. Digital image © The Museum of Modern Art, licensed by SCAL A/Art Resource, NY. 36 doi:10.1162/GREY_a_00207 Downloaded from http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/GREY_a_00207 by guest on 29 September 2021 “Writing Calculations, Calculating Writing”: Hanne Darboven’s Computer Art VICTORIA SALINGER Within the past decade, scholars of new media and digital art have shown renewed interest in the computer art of the 1960s as part of the lineage or prehistory of contemporary new media practices. Before that, computer art was at best a side note in art-historical discussions of the art and technology movement. Recent work by, among others, Grant Taylor, Paul Hertz, Peter Weibel, and Edward Shanken has begun to point to the impor - tance of computer art to a consideration of postwar art history and of the linkages between computer art and conceptual art in the late 1960s. 1 Both, so the argument goes, rely on a set of rules or procedures, a process that is governed by, respectively, an algorithm or an idea. Both share an interest in information. Yet, many of the comparisons drawn between conceptual art and computer art offer flat overgeneralizations of one or both movements, eliding differences in practice and ways of think - ing about the work within each movement in order to allow broad comparisons to be drawn between the two. Frequently, the single reference point for conceptual art is the writing of Sol LeWitt, though he himself acknowledges that his way of conceiving his practice was just that—his own, not a universal mandate. -

Richard Serra Born 1938 in San Francisco, California
This document was updated March 4, 2021. For reference only and not for purposes of publication. For more information, please contact the gallery. Richard Serra Born 1938 in San Francisco, California. Lives and works in New York and Nova Scotia, Canada. EDUCATION 1961 B.A., University of California, San Diego 1962 B.F.A., Yale University, New Haven 1964 M.F.A., Yale Univesity, New Haven SOLO EXHIBITIONS 2020 Richard Serra: Works on Paper, Berggruen Gallery, San Francisco (February 20-June 2020) 2019 Richard Serra | Finally Finished, David Klein Gallery, Birmingham, Michigan (November 2- December 21, 2019) Richard Serra: Composites, Gemini G.E.L. at Joni Moisant Weyl, New York (October 17, 2019- February 1, 2020) Richard Serra Drawings, Paul Coulon, London (September 26-November 15, 2019) Richard Serra: Forged Rounds, Gagosian Gallery (24th Street), New York (September 17- December 7, 2019) Richard Serra: Reverse Curve, Gagosian Gallery (21st Street), New York (September 17, 2019- February 1, 2020) Richard Serra: Triptychs and Diptychs, Gagosian Gallery (Madison Avenue), New York (September 16-November 2, 2019) Richard Serra: Equals, Hiram Butler Gallery, Houston (March 5-April 27, 2019) Richard Serra: 1985-1996, Krakow Witkin Gallery, Boston (January 5-February 9, 2019) 2018 Richard Serra: Equals, Gemini G.E.L. at Joni Moisant Weyl, New York (September 22- November 3, 2018) Richard Serra Drawings, David Zwirner, Hong Kong (May 23-June 30, 2018) Richard Serra: Rifts, Gagosian Gallery (Grosvenor Hill), London (April 6-May 25, 2018) Richard -
Triptych for an Ideal Museum. Hollein, Beuys and Cladders
71 William Firebrace 3 Paradise on Erft Andrew Crompton 27 How To Say Nothing With Sincerity Thomas Weaver 30 In Conversation with Kevin Roche Piers Gough 48 Deus ex Moline Hamed Khosravi 50 The Multiple Lives of Gabriel Guevrekian Nicholas Olsberg 64 Two Continuous Monuments Andres Kurg 68 Tallinn in Technicolour Cristóbal Amunátegui 75 Circles, Circuits, Cycles Adrian Forty 90 The Euston Folly Eva Branscome 92 Triptych for an Ideal Museum Charles Rice 104 Heatwave, or The Megastructure as Eden Chris Blencowe & Judith Levine 113 Peripheral Odyssey Andri Gerber 121 A Life Less Ordinary Thomas Daniell 129 In Conversation with Hiroshi Hara Pier Vittorio Aureli 147 Do You Remember Counterrevolution? Niall Hobhouse & Tina Di Carlo 166 Come for Porchetta 168 Contributors 71 aa Files The contents of aa Files are derived from the activities Architectural Association of the Architectural Association School of Architecture. 36 Bedford Square Founded in 1847, the aa is the uk’s only independent London wc1b 3es school of architecture, offering undergraduate, t +44 (0)20 7887 4000 postgraduate and research degrees in architecture and f +44 (0)20 7414 0782 related fields. In addition, the Architectural Association aaschool.ac.uk is an international membership organisation, open to anyone with an interest in architecture. Publisher The Architectural Association For Further Information Visit aaschool.ac.uk Editorial Board or contact the Admissions Office Mark Cousins aa School of Architecture George L Legendre 36 Bedford Square Joanna Merwood-Salisbury -

The Sun Is ZERO” Light and Color As Principles 7 of Structural Order
“The Sun Is ZERO” Light and Color as Principles 7 of Structural Order Dirk Pörschmann ZERO was from the outset an open space of opportunity, and we were speculating with the visionary form of purity, beauty, and silence.1 Günther Uecker In the late 1950s and early 1960s, ZERO was one of the most active and best networked art movements among the neo-avant- gardes. With enormous artistic impetus, Lucio Fontana, Yves Klein, Piero Manzoni, Jean Tinguely, Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker, Hermann Goepfert, Almir Mavignier, Chris- tian Megert, Henk Peeters, Jan. J. Schoonhoven, Jesús Rafael Soto, Daniel Spoerri, and Herman de Vries – to name just a few of the dozens of artists involved with ZERO – extended the avant-garde efforts of the early 20th century. Distinguish- ing itself from Tachism, ZERO started in the cities Düsseldorf, Milan, Antwerp, Paris, and Arnheim and developed into a Eu- ropean movement that was able to build on the foundation of the achievements of Art Informel (dynamics in execution and the elimination of the painting’s boundaries) and establish new aspects of media and technique such as monochromatism, serial structures, light, and fire as direct artistic and elementary media for the production of images and virtual and real kinetics as artis- tic methods. ZERO was an open movement in the nature of a 1 Günther Uecker, Der leere Mensch (1965), in: Günther Uecker, Schriften. Gedichte, Projektbeschreibungen, Reflexionen, ed. by Stephan von Wiese, Saint Gall 1979, p. 108. 177 Dirk Pörschmann Fig. 7.1: Cover ZERO magazine, No. 1, 1958. project. Like-minded artists exhibited and worked together and published in their own publications (Fig. -

Polke/Richter Richter/Polke Polke/Richter Richter/Polke
polke/richter richter/polke polke/richter richter/polke Essays by Robert Brown Faith Chisholm Dietmar Elger Jill Lloyd Axel Hinrich Murken and Crista Murken-Altrogge Kenny Schachter contents Published in Great Britain 7 Foreword by Christie’s International Francis Outred Media Division Jubilee House, 213 Oxford Street 13 Bed, Bath & Beyond London, W1D 2LG Kenny Schachter This catalogue was published on the occasion 17 galerie h of the exhibition Dietmar Elger polke/richter richter/polke Curated by 29 galerie h 1966 polke/richter Darren Leak and catalogue text Kenny Schachter Sigmar Polke and Gerhard Richter Christie’s Mayfair, London 103 New Bond Street 59 Reflections on Gerhard Richter’s London, W1S 1ST Paintings of Human Subjects 25th April – 7th July 2014 Axel Hinrich Murken and Enquiries: Crista Murken-Altrogge Darren Leak [email protected] T +44 ( 0) 207 389 2025 71 Richter/Polke: Nihilism and Alchemy Jacob Uecker [email protected] Faith Chisholm T +44 ( 0) 207 389 2400 Design by 99 Gerhard Richter: Micha Weidmann Studio Photorealist and Abstract Painting Christie’s photography by Jill Lloyd Steve Ward Cover: Sigmar Polke 135 ‘Kunst Macht Frei’– and Gerhard Richter at The Art of Sigmar Polke galerie h, Hanover, 1966 Robert Brown Courtesy Gerhard Richter Archive © Gerhard Richter, 2014 167 Exhibited Works 7 foreword/francis outred ‘We cannot depend on good paintings being However these artists chose this moment to begin made one day: we need to take the matter into a complete and utter deconstruction of painting, our own hands! to strip it back to its bare bones and rebuild what If someone wants to become a painter, he could be conceived as the ‘possibilities in painting’. -

Galerie Schmela Records, 1923-2006, Bulk 1957-1992
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt6z09s3jn Online items available Finding aid for the Galerie Schmela records, 1923-2006, bulk 1957-1992 Isabella Zuralski Finding aid for the Galerie 2007.M.17 1 Schmela records, 1923-2006, bulk 1957-1992 Descriptive Summary Title: Galerie Schmela records Date (inclusive): 1923-2006, bulk 1957-1992 Number: 2007.M.17 Creator/Collector: Alfred Schmela Galerie Physical Description: 102.63 Linear Feet(175 boxes, 26 flatfile folders) Repository: The Getty Research Institute Special Collections 1200 Getty Center Drive, Suite 1100 Los Angeles 90049-1688 [email protected] URL: http://hdl.handle.net/10020/askref (310) 440-7390 Abstract: Galerie Schmela was one of the most important art galleries in Germany in the postwar period. Through a prescient program of exhibitions, founder Alfred Schmela introduced and promoted innovative European and American artists, such as Joseph Beuys, Arman, Gerhard Richter, the group ZERO (Otto Piene, Günther Uecker, Heinz Mack), Hans Haacke, Christo, Lucio Fontana, Robert Indiana, Yves Klein, Gordon Matta-Clark, Jean Tinguely, Richard Tuttle, and numerous others. Mainly concentrated on the 1950s through the 1970s, the Galerie Schmela records include: correspondence with artists and clients; gallery financial records; vintage photographic documentation of installations, gallery openings, and artworks; and extensive files of printed ephemera, posters, and press clippings. Request Materials: Request access to the physical materials described in this inventory through the catalog record for this collection. Click here for the access policy . Language: Collection material is predominantly in German, with some material in English or French Biographical / Historical Note When German art dealer Alfred Schmela opened a gallery devoted to contemporary art in Düsseldorf in 1957, the moment was propitious. -

Trading Between Architecture and Art Editors Wouter Davidts Susan Holden Ashley Paine
Trading between Architecture and Art Editors Wouter Davidts Susan Holden Ashley Paine With contributions by Angelique Campens Guy Léon Châtel Wouter Davidts Mark Dorrian Susan Holden John Körmeling Maarten Liefooghe Mark Linder John Macarthur Philip Metten Sarah Oppenheimer Ashley Paine Léa-Catherine Szacka Annalise Varghese Stefaan Vervoort Stephen Walker Rosemary Willink Valiz Trading between Architecture and Art Strategies and Practices of Exchange Studies in Art and Architecture Contents 9 The Terms of Trade of Architecture and Art Wouter Davidts, Susan Holden, Ashley Paine 17 Art/Architecture/Concept Mark Dorrian 27 Pardo’s Plumbing Relational Art and Architec tural Pavilions John Macarthur 40 Open John Körmeling 51 Assemble’s Turner Prize Utility and Creativity in the Cultural Economy Susan Holden 65 Jacques Moeschal, Signal Angelique Campens 75 Failed and Fantastic Frederick J. Kiesler’s Imaging Practices Mark Linder 86 Projects 2013–2015 Philip Metten 97 Warren & Mosley: Within and Beyond Rogue Game Stephen Walker 109 The Follies of Conceptual Architecture at Osaka’s Expo ’90 Biwako Otsu Folly, Bolles+Wilson Annalise Varghese 121 Massimo Scolari’s Ali and the Institutional Reframing of the Venice Biennale Léa-Catherine Szacka 133 Rooms and Clouds Gerhard Richter and Architecture Guy Léon Châtel and Wouter Davidts 145 ‘Breuer Revisited’ Creating Value at The Met Breuer Rosemary Willink 158 us 10,139,046 b2 Sarah Oppenheimer 181 Spencer Finch’s Windows Authenticity and the Reconstructed Interior Ashley Paine 193 Mies en Abyme Architecture and Institutional Critique in Ludger Gerdes' Bau-Bild Krefeld, Gartenfragment Stefaan Vervoort 207 On the Art/Architecture of Reframing an Industrial Site Rotor’s ‘Grindbakken’ Exhibition Maarten Liefooghe 221 About the Authors 229 Index 235 Acknowledgments Rooms and Clouds G e r h a r d R i c h t e r a n d Architecture Guy Léon Châtel and Wouter Davidts 1 Gerhard Richter, ‘From a I look for the object and the picture: not for painting or letter to Benjamin H.D.