Charles Gounod Als Opern
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's the Phantom of the Opera
Ouachita Baptist University Scholarly Commons @ Ouachita Honors Theses Carl Goodson Honors Program 2004 Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's The Phantom of the Opera Joy A. Mills Ouachita Baptist University Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses Part of the French and Francophone Literature Commons, Other Theatre and Performance Studies Commons, and the Translation Studies Commons Recommended Citation Mills, Joy A., "Allusions and Historical Models in Gaston Leroux's The Phantom of the Opera" (2004). Honors Theses. 83. https://scholarlycommons.obu.edu/honors_theses/83 This Thesis is brought to you for free and open access by the Carl Goodson Honors Program at Scholarly Commons @ Ouachita. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of Scholarly Commons @ Ouachita. For more information, please contact [email protected]. Gaston Leroux's 1911 novel, The Phantom of the Opera, has a considerable number of allusions, some of which are accessible to modern American audiences, like references to Romeo and Juilet. Many of the references, however, are very specific to the operatic world or to other somewhat obscure fields. Knowledge of these allusions would greatly enhance the experience of readers of the novel, and would also contribute to their ability to interpret it. Thus my thesis aims to be helpful to those who read The Phantom of the Opera by providing a set of notes, as it were, to explain the allusions, with an emphasis on the extended allusion of the Palais Garnier and the historical models for the heroine, Christine Daae. Notes on Translations At the time of this writing, three English translations are commercially available of The Phantom of the Opera. -

The Reception of Herculanum in the Contemporary Press
The reception of Herculanum in the contemporary press Gunther Braam How can the success of an opera in its own time be examined and studied? Quite simply, by working out the number of performances and the total amount of receipts generated, then by creating – and assess - ing – the most extensive dossier possible of the reviews which appeared in the contemporary press. herculanum : from playbill to box office With regard to the number of performances, the Journal de l’Opéra , today held in the Bibliothèque Nationale de France, is fortunately at our dis - posal. Nevertheless, this needs to be analysed carefully, not overlooking the fact that the presence of an opera in the repertory might well result from reasons other than artistic ones, such as the departure of a direct- or, those connected with the singers entrusted with the leading roles, the destruction of scenery (often as a result of fires), for political reasons or for all kinds of other possibilities. Examples which could be mentioned include Tannhäuser by Wagner (1861), or – why not also – the less well- known La Nonne sanglante by Gounod (1854): far from being unsuccess - ful in terms of audience levels, these two operas were withdrawn after three performances for Tannhäuser , and eleven for La Nonne sanglant e; the average receipts for the two operas were respectively 8,890 and 6,140 francs (in comparison, the receipts for a performance of Les Huguenots 77 félicien david: herculanum in 1859, typically ranged between 6,000 and 7,000 francs). How does Herculanum compare to other -

Charles Gounod
1864 VERSION CHARLES GOUNOD FAUST Aljaž Farasin • Carlo Colombara • Marjukka Tepponen Lucio Gallo • Diana Haller • Ivana Srbljan • Waltteri Torikka Croatian National Theatre in Rijeka Opera Orchestra and Choir Ville Matvejeff Act I 24:56 $ Scene 6: Récitatif: Je voudrais bien 1:32 1 Introduction 6:39 (Marguerite) 2 Scene 1: Rien!… En vain j’interroge – % Scene 6: Chanson du Roi de Thulé: Chorus: Ah! Paresseuse fille 8:27 Ile était un roi de Thulé 6:16 (Faust, Maidens, Labourers) (Marguerite) 3 Récitatif: Mais ce Dieu 1:09 ^ Air des bijoux: Charles (Faust) Ah! Je ris de me voir 3:57 4 Scene 2: Duo: Me voici! 8:41 (Marguerite) GOUNOD (Méphistophélès, Faust) & Scene 7: Scène: Seigneur Dieu... – (1818–1893) Scene 8: Dame Marthe Schwerlein 2:57 Act II 27:15 (Marthe, Marguerite, Méphistophélès, Faust) 5 Scene 1: Chœur: Vin ou bière 4:45 * Scene 8: Quatuor: (Students, Wagner, Soldiers, Citizens, Prenez mon bras un moment! 7:22 Faust Maidens, Matrons) (Faust, Marguerite, Méphistophélès, Marthe) 6 Scene 2: Scène: O sainte médaille – ( Scene 10: Scène: Il était temps! 1:47 Opera in five acts (1858) (London version, 1864) Récitatif: Ah! Voici Valentin – (Méphistophélès) Libretto by Jules Barbier (1825–1901) and Michel Carré (1822–1872) Invocation: Avant de quitter ces lieux – ) Scene 11: Duo: Il se fait tard – Scene 3: Pardon! 6:47 Scene 12: Scene: Tête folle! – Additional text by Onésime Pradère (1825–1891) (Valentin, Wagner, Siébel, Students, Méphistophélès) Scene 13: Il m’aime 13:53 Sung in French 7 Ronde du Veau d’or: (Marguerite, Faust, Méphistophélès) Le veau d’or est toujours debout! 1:56 (Méphistophélès, Siébel, Wagner, Chorus) Act IV 46:13 Faust .............................................................................................. -

La Fille Du Régiment
LELELELE BUGUE BUGUEBUGUEBUGUE Salle Eugène Le Roy Réservation : Maison de la Presse Le Bugue 05 53 07 22 83 Gaetano Donizetti LA FILLE DU RÉGIMENT Orpheline, Marie was taken in by Sergeant Sulpice, who employs him as a cantinière in his regiment. Crazy in love with Marie, the young peasant Tonio engages in the battalion to see her every day. When the Marquise of Berkenfield reveals the true identity of Mary, who is her daughter, the young woman could be separated forever from Tonio. Acclaimed by the lyric press, South African soprano Pretty Yende returns to the stage of the Met opposite the tenor Javier Camarena for an opera of great vocal virtuosity under the baton of Enrique Mazzola. The alchemist Donizetti's expertise once again acts with this unique blend of melancholy and joy. Tenor Javier Camarena and soprano Pretty Yende team up for a feast of bel canto vocal fireworks—including the show-stopping tenor aria “Ah! Mes amis … Pour mon âme,” with its nine high Cs. Alessandro Corbelli and Maurizio Muraro trade off as the comic Sergeant Sulpice, with mezzo-soprano Stephanie Blythe as the outlandish Marquise of Berkenfield. And in an exciting piece of casting, stage and screen icon Kathleen Turner makes her Met debut in the speaking role of the Duchess of Krakenthorp. Enrique Mazzola conducts. Conductor Marie Marquise Enrique Pretty Stéphanie Mazzola Yende Blythe soprano Mezzo soprano Duchess Tonio Sulpice Kathleen Javier Maurizio Turner Camarena Muraro actress tenor Bass Production : Laurent Pelly DATE : 2nd March 2019 Time : 6.25pm Opera en 2 acts by Giacomo Puccini LA FILLE DU RÉGIMENT World Premiere : Opéra Comique, Paris, 1840. -

Fiche AC Gounod.Qxd
Les fiches pédagogiques - Compositeur CHARLES GOUNOD(1818 - 1893)hhhhhhhhhhhhhhhhhhh Il naît à Paris le 17 juin 1818. Issu d’une famille d’artistes (père peintre et mère pro- fesseur de piano) il est attiré assez jeune vers ces matières. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1835 , il décide de devenir musicien malgré les réticences de sa mère. A partir de 1838, il poursuit des études au conservatoire et obtient le premier Grand prix de Rome l’année suivante. Accompagné d’Hector le Fuel (architecte), il arrive à Rome le 27 janvier 1840 où la Villa Médicis est dirigée par Jean-Auguste- Dominique Ingres. Il se lie avec la sœur de Félix Mendelssohn qui lui fait découvrir les romantiques allemands. Il écrit ses premières mélodies en 1842, notamment sa Messe de Rome et un Requiem. En 1843, après un détour par Vienne, Berlin ou en- core Leipzig, il est de retour à Paris et dirige la musique à l’église des Missions étrangères jusqu’en 1848, date à laquelle cesse sa vocation religieuse. Soutenu par l’influente Pauline Viardot, il obtient une commande de l’Opéra de Paris : Sapho. La création de l’opéra le 16 avril 1851 ne fait pas grand bruit et sa reprise à Londres le 8 août est catastrophique. En revanche ses mélodies et sa musique chorale ren- contre un certain succès. Le 20 avril 1852, Gounod épouse Anna Zimmerman et à la mort de son beau-père, s'installe dans une magnifique demeure à St Cloud. En 1858, sa mère disparait alors que le succès à l'opéra arrive avec Le Médecin malgré lui (1858) et Faust (1859) où il se montre d'une sensualité délicate et émouvante et où il révèle un sens théatral évident. -

Read Book \\ Polyeucte: Opera En Quatre Actes (Classic Reprint
3XHIZ4JT0C # Polyeucte: Opera En Quatre Actes (Classic Reprint) (Paperback) eBook Polyeucte: Opera En Quatre A ctes (Classic Reprint) (Paperback) By Jules Barbier To get Polyeucte: Opera En Quatre Actes (Classic Reprint) (Paperback) eBook, remember to refer to the web link beneath and save the file or have access to additional information that are highly relevant to POLYEUCTE: OPERA EN QUATRE ACTES (CLASSIC REPRINT) (PAPERBACK) book. Our web service was introduced with a want to serve as a total on the internet digital catalogue that provides usage of large number of PDF book assortment. You will probably find many kinds of e-guide and other literatures from the paperwork data base. Specific well-liked subjects that distribute on our catalog are trending books, solution key, test test question and solution, guideline sample, exercise manual, test sample, user manual, owners guidance, support instruction, restoration manual, and many others. READ ONLINE [ 3.23 MB ] Reviews The ebook is straightforward in study better to fully grasp. It is actually loaded with knowledge and wisdom I am just delighted to tell you that here is the best pdf i have read through during my very own lifestyle and may be he greatest ebook for at any time. -- Dr. Karelle Glover Totally one of the better publication I have actually read through. It really is rally fascinating throgh studying time period. Its been printed in an extremely simple way and is particularly just following i finished reading through this ebook in which basically modified me, modify the way i think. -- Mrs. Maudie Weimann 0PUAYYAMFX > Polyeucte: Opera En Quatre Actes (Classic Reprint) (Paperback) PDF Related PDFs Games with Books : 28 of the Best Childrens Books and How to Use Them to Help Your Child Learn - From Preschool to Third Grade [PDF] Follow the web link listed below to download "Games with Books : 28 of the Best Childrens Books and How to Use Them to Help Your Child Learn - From Preschool to Third Grade" PDF file. -

Famous Composers and Their Music
iiii! J^ / Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Brigham Young University http://www.archive.org/details/famouscomposerst05thom HAROLD BLEBLffiR^^ PROVO. UTAH DANIEL FRANCOIS ESPRIT AUBER From an engraving by C. Deblois, 7867. 41 .'^4/ rii'iiMia-"- '^'', Itamous COMPOSERS AND THEIR MUSIC EXTRA ILLUSTPATED EDITION o/' 1901 Edited by Theodore Thomas John Knowlej Paine (^ Karl Klauser ^^ n .em^fssfi BOSTON M'^ J B MILLET COMPANY m V'f l'o w i-s -< & Copyright, 1891 — 1894— 1901, By J. B. Millet Company. DANIEL FRANCOIS ESPRIT AUBER LIFE aiore peaceful, happy and making for himself a reputation in the fashionable regular, nay, even monotonous, or world. He was looked upon as an agreeable pianist one more devoid of incident than and a graceful composer, with sparkling and original Auber's, has never fallen to the ideas. He pleased the ladies by his irreproachable lot of any musician. Uniformly gallantry and the sterner sex by his wit and vivacity. harmonious, with but an occasional musical dis- During this early period of his life Auber produced sonance, the symphony of his life led up to its a number of lietier, serenade duets, and pieces of dramatic climax when the dying composer lay sur- drawing-room music, including a trio for the piano, rounded by the turmoil and carnage of the Paris violin and violoncello, which was considered charm- Commune. Such is the picture we draw of the ing by the indulgent and easy-going audience who existence of this French composer, in whose garden heard it. Encouraged by this success, he wrote a of life there grew only roses without thorns ; whose more imp^i/rtant work, a concerto for violins with long and glorious career as a composer ended only orchestra, which was executed by the celebrated with his life ; who felt that he had not lived long Mazas at one of the Conservatoire concerts. -
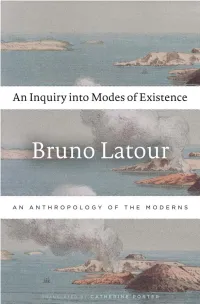
An Inquiry Into Modes of Existence
An Inquiry into Modes of Existence An Inquiry into Modes of Existence An Anthropology of the Moderns · bruno latour · Translated by Catherine Porter Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England 2013 Copyright © 2013 by the President and Fellows of Harvard College All rights reserved Printed in the United States of America The book was originally published as Enquête sur les modes d'existence: Une anthropologie des Modernes, copyright © Éditions La Découverte, Paris, 2012. The research has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (fp7/2007-2013) erc Grant ‘ideas’ 2010 n° 269567 Typesetting and layout: Donato Ricci This book was set in: Novel Mono Pro; Novel Sans Pro; Novel Pro (christoph dunst | büro dunst) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Latour, Bruno. [Enquête sur les modes d'existence. English] An inquiry into modes of existence : an anthropology of the moderns / Bruno Latour ; translated by Catherine Porter. pages cm “The book was originally published as Enquête sur les modes d'existence : une anthropologie des Modernes.” isbn 978-0-674-72499-0 (alk. paper) 1. Civilization, Modern—Philosophy. 2. Philosophical anthropology. I. Title. cb358.l27813 2013 128—dc23 2012050894 “Si scires donum Dei.” ·Contents· • To the Reader: User’s Manual for the Ongoing Collective Inquiry . .xix Acknowledgments . xxiii Overview . xxv • ·Introduction· Trusting Institutions Again? . 1 A shocking question addressed to a climatologist (02) that obliges us to distinguish values from the ac- counts practitioners give of them (06). Between modernizing and ecologizing, we have to choose (08) by proposing a different system of coordinates (10). -

Temps Fort Bicentenaire De La Naissance De Gounod (1818 – 2018)
TEMPS FORT BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GOUNOD (1818 – 2018) Parmi les célébrations nationales 2018 les plus importantes, le bicentenaire de la naissance de Charles Gounod est mis en valeur à Saint-Raphaël en raison du séjour de ce dernier dans la cité balnéaire en 1865, pendant lequel il composa l’opéra « Roméo et Juliette », pièce majeure de son œuvre. La Médiathèque et le Conservatoire rendent hommage à ce grand musicien tout au long des mois de novembre et décembre 2018 à travers une exposition, des auditions, un concert à la Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire, des conférences et une mise en valeur des ressources de la Médiathèque. L’occasion également d’évoquer la vie intellectuelle et artistique de cette époque à Saint-Raphaël liée à l’essor de la ville. Livres Livres généraux sur la musique et l’opéra : Massin, Brigitte et Jean (dir.) – Histoire de la musique occidentale Ed. Fayard, 1985 Cette histoire précisément délimitée dans le temps et l'espace, traite de l'évolution de la musique en Europe et en Amérique depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours. Un chapitre complet sur « La musique française : Offenbach, Gounod, Bizet. 780.9 MAS Dermoncourt, Bertrand (dir.) – L’univers de l’opéra : œuvres, scènes, compositeurs, interprètes Ed. Laffont, coll. Bouquins, 2012 Les quelques 2000 entrées sont consacrées aux principales œuvres du répertoire, aux différents genres de l'art lyrique, à ceux qui font l'opéra, aux pays, villes et festivals qui accueillent des représentations, aux termes techniques, aux grandes synthèses historiques, mythologiques et sociologiques. 782.1 DER Batta, Andras – Opéra : compositeurs, œuvres interprètes Ed. -

Faust-Education-Pack.Pdf
Faust Music by Charles Gounod Libretto by Jules Barbier English Translation by Ruth Martin & Thomas Martin adapted by SCO Doctor Faust is alone. The promise of love and the return of his youth is enough to convince Faust to make a deal with the devil, Méphistophélès As Méphistophélès’ plan unravels, Faust is led down an increasingly darker path that will lead to love, death, greed and madness. Contents Introduction… 4 Faust by Gounod…5 - What is Opera?... 5 - Who was Gounod?... 6 - Who was Goethe?...6 - Who are SCO?... 7 The Story of Faust…8 - Plot summary…8 Key Characters of Faust…10 Creative view for Faust… 11 - Challenges of Touring …11 - Design of Faust…12 Cast of Faust Interviews… 13 Lesson Plans…14 - Music…14 - Drama…16 Tour Dates… 18 Introduction In September 1846 Verdi started work on a project to turn Johann Wolfgang von Goethe’s play Faust: Part 1 into an opera. The play tells the story of a doctor who is seduced by the devil with the promise of youth and love, and tracks his tragic fall into greed, lust and bloody violence. Gounod was seduced by the play’s dramatic plot, its elements of the supernatural, and the potential for creating a spectacular theatrical experience. Working with “… Musical ideas sprang to the poet Jules Barbier from a version of Goethe’s play by Michael Carré called ”Faust et Marguerite”, my mind like butterflies, and Gounod created a five act opera in French that was all I had to do was to stretch first performed in Paris in 1859. -

The Seven Last Words of Christ
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2013 The seven last words of Christ : a comparison of three French romantic musical settings by Gounod, Franck, and Dubois Vaughn Roste Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Roste, Vaughn, "The es ven last words of Christ : a comparison of three French romantic musical settings by Gounod, Franck, and Dubois" (2013). LSU Doctoral Dissertations. 3987. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3987 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. THE SEVEN LAST WORDS OF CHRIST: A COMPARISON OF THREE FRENCH ROMANTIC MUSICAL SETTINGS BY GOUNOD, FRANCK, AND DUBOIS A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music by Vaughn Roste B.A., Augustana University College, 1997 B.B.A, Canadian Lutheran Bible Institute, 1997 M.Mus., University of Alberta, 2003 May 2013 ii DEDICATION Writing a dissertation is a project not completed by one person but by several. I need to thank my family—Mom, Dad, Erica, Ben, Finn, and Anders—for their love and undying support through this convoluted and seemingly never-ending process. -

Palazzetto Bru Zane -Ciclo Gounod
La sua musica è divina tanto quanto la sua persona è nobile e distinta. Gounod è giustamente considerato l’apostolo di un romanticismo lirico, sensuale e seduttivo. Dal rapito stupore dell’«aria dei gioielli» del Faust CICLO Gounod ha un al candore pastorale di Mireille passando per la voluttuosità della scena del giardino in Roméo et Juliette, il compositore ha saputo cogliere immenso avvenire. e tradurre in musica i palpiti dell’anima umana vittima dell’amore, CHARLES Pauline Viardot sia esso folgorante o contrastato. Ma Gounod non fu solo il cantore del desiderio: l’obiettivo del ciclo che il Palazzetto Bru Zane gli dedica è appunto mostrarne tutti i diversi aspetti. E dunque, composizioni GOUNOD, poco note (il Concerto per pianoforte con pedaliera, la trascrizione da Mozart per coro a cappella) affiancheranno un evento quale la prima creazione in tempi moderni della sua ultima opera lirica, Le Tribut (1818-1893) de Zamora; al contempo, verrà rivolto uno sguardo nuovo a brani più famosi, in particolare la prima versione del Faust con testi parlati, DALLA CHIESA interpretata con strumenti d’epoca. ALL'OPERA In occasione del bicentenario della nascita del compositore, il Palazzetto Bru Zane si propone di far conoscere meglio un musicista che non fu soltanto l’autore del Faust e di Roméo et Juliette. 17 La sua musica è divina tanto quanto la sua persona è nobile e distinta. Gounod è giustamente considerato l’apostolo di un romanticismo lirico, sensuale e seduttivo. Dal rapito stupore dell’«aria dei gioielli» del Faust CICLO Gounod ha un al candore pastorale di Mireille passando per la voluttuosità della scena del giardino in Roméo et Juliette, il compositore ha saputo cogliere immenso avvenire.