Die Dienststelle Dr. Mühlmann. Organisierter Kunstraub in Den
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hitler Und Bayern Beobachtungen Zu Ihrem Verhältnis
V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE SITZUNGSBERICHTE · JAHRGANG 2004, HEFT 4 Erstversand WALTER ZIEGLER Hitler und Bayern Beobachtungen zu ihrem Verhältnis Vorgetragen in der Sitzung vom 6. Februar 2004 MÜNCHEN 2004 VERLAG DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN In Kommission beim Verlag C. H. Beck München V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 ISSN 0342-5991 ISBN 3 7696 1628 6 © Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 2004 Gesamtherstellung: Druckerei C. H. Beck Nördlingen Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 Inhalt 1. Zur Methode ............................... 8 2. Hitlers Aufstieg in Bayern ...................... 16 3. Im Regime ................................ 33 4. Verhältnis zu den bayerischen Traditionen ........... 73 5. Veränderungen im Krieg ....................... 94 Bildnachweis ................................. 107 V V V V V V V V Druckerei C. H . Beck V V V V Medien mit Zukunft V Ziegler, Phil.-hist. Klasse 04/04 V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V .....................................VVVVVVVVVVVVVVVVVVV Erstversand, 20.07.2004 Abb. 1: Ein bayerischer Kanzler? Reichskanzler Adolf Hitler bei seiner Wahlrede am 24. -

Report to the Public on the Work of the 2019 Proceedings of the Symposium Held on November 15, 2019
Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation Report to the public on the work of the 2019 Proceedings of the symposium held on November 15, 2019 Speech by French President Jacques Chirac, on July 16, 1995, at the commemoration of the Vel’ d’Hiv’ roundup (July 16, 1942) Excerpts « In the life of a nation, there are times that leave painful memories and damage people’s conception of their country. It is difficult to evoke these moments because we can never find the proper words to describe their horror or to express the grief of those who experienced their tragedy. They will carry forever, in their souls and in their flesh, the memory of these days of tears and shame. [… ] On that day, France, land of the Enlightenment, of Human Rights, of welcome and asylum, committed the irreparable. Breaking its word, it handed those who were under its protection over to their executioners. [… ] Our debt to them is inalienable. [… ] In passing on the history of the Jewish people, of its sufferings and of the camps. In bearing witness again and again. In recognizing the errors of the past, and the errors committed by the State. In concealing nothing about the dark hours of our history, we are simply standing up for a vision of humanity, of human liberty and dignity. We are thus struggling against the forces of darkness, which are constantly at work. [… ] Let us learn the lessons of history. Let us refuse to be passive onlookers, or accomplices, of unacceptable acts. -

Karl Brandt, Philipp Bouhler, Viktor Brack, and Leonardo Conti
Western Illinois Historical Review © 2015 Vol. VII, Spring 2015 ISSN 2153-1714 The Administration of Death: Karl Brandt, Philipp Bouhler, Viktor Brack, and Leonardo Conti Zacharey Crawford Abstract This essay provides a new perspective on the administrative structures of the Nazi euthanasia programs of 1939-1942. The focus is on the four key individuals involved in the planning and execution of the program: Dr. Karl Brandt, Viktor Brack, Philipp Bouhler, and Dr. Leonardo Conti. The most lethal phase of the Holocaust commenced with the German invasion of the Soviet Union in the summer of 1941. Beginning in December of that year, scores of victims were systematically gassed in Nazi extermination camps, but the methods used in the destruction of the European Jews had been developed and tested much earlier. The euthanasia program (Operation T4) that had been carried out by the Nazis between late 1938 and August 1941 laid the ground for the killing methods used in the Holocaust.1 It was the Nazis’ goal to create a racially defined Volksgemeinschaft or people’s community that excluded all individuals and 1 The most important studies on this topic are Michael Burleigh, Death and Deliverance: ‘Euthanasia’ in Germany 1900-1945 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994); Götz Aly, Peter Chroust, and Christian Pross, Cleansing the Fatherland: Nazi Medicine and Racial Hygiene (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1994); Henry Friedlander, The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995), 59 groups who did not fit Nazi criteria of racial purity and superiority.2 While Jews were the Nazis’ main target, other groups were also excluded, for instance Sinti and Roma and so-called “aliens to the community.”3 Children and adults with physical and mental disabilities that were deemed to be “unworthy of life” became victims of the euthanasia program. -
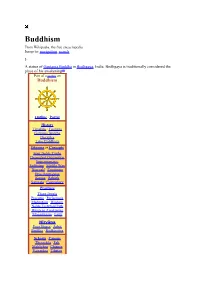
Buddhism from Wikipedia, the Free Encyclopedia Jump To: Navigation, Search
Buddhism From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search A statue of Gautama Buddha in Bodhgaya, India. Bodhgaya is traditionally considered the place of his awakening[1] Part of a series on Buddhism Outline · Portal History Timeline · Councils Gautama Buddha Disciples Later Buddhists Dharma or Concepts Four Noble Truths Dependent Origination Impermanence Suffering · Middle Way Non-self · Emptiness Five Aggregates Karma · Rebirth Samsara · Cosmology Practices Three Jewels Precepts · Perfections Meditation · Wisdom Noble Eightfold Path Wings to Awakening Monasticism · Laity Nirvāṇa Four Stages · Arhat Buddha · Bodhisattva Schools · Canons Theravāda · Pali Mahāyāna · Chinese Vajrayāna · Tibetan Countries and Regions Related topics Comparative studies Cultural elements Criticism v • d • e Buddhism (Pali/Sanskrit: बौद धमर Buddh Dharma) is a religion and philosophy encompassing a variety of traditions, beliefs and practices, largely based on teachings attributed to Siddhartha Gautama, commonly known as the Buddha (Pāli/Sanskrit "the awakened one"). The Buddha lived and taught in the northeastern Indian subcontinent some time between the 6th and 4th centuries BCE.[2] He is recognized by adherents as an awakened teacher who shared his insights to help sentient beings end suffering (or dukkha), achieve nirvana, and escape what is seen as a cycle of suffering and rebirth. Two major branches of Buddhism are recognized: Theravada ("The School of the Elders") and Mahayana ("The Great Vehicle"). Theravada—the oldest surviving branch—has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia, and Mahayana is found throughout East Asia and includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Tibetan Buddhism, Shingon, Tendai and Shinnyo-en. In some classifications Vajrayana, a subcategory of Mahayana, is recognized as a third branch. -

1 the End of Global Capital Flows During the Great Depression
The End of Global Capital Flows During the Great Depression Harold James, Princeton University International capital markets froze up during the Great Depression, and the capital movements that did take place in the aftermath of the depression were regarded as destabilizing “hot money” flows. Previous debt crises in the nineteenth century era of globalization had resulted in the penalization of the problem area for substantial periods of time (decades), but capital flows from the major centers had resumed to new areas quite quickly. What distinguished the Great Depression was: - that several areas of the world were hit simultaneously in a general crisis - that the crisis undermined the financial structure of the major financial centers - that the response to the crisis in many countries involved the suspension of debt service and an imposition of capital controls - that lending countries regarded the volatility of capital flows as an economic problem but also as a security issue - that in consequence the climate of opinion shifted to a belief that capital flows were the major source of the destabilization. 1. The General Crisis 1 The First World War was clearly a major shock to the international economic order: the gold standard was suspended, there were major debtor defaults (the Russian Empire), and countries adopted highly inflationary war finance. But capital flows resumed quickly after the war, as they had after nineteenth century debt crises. Many U.K. and U.S. investors thought the depreciated currencies of central Europe attractive, and bet on recoveries (foolishly, as it turned out). After the currency stabilizations of the mid-1920s, capital flows were not deterred by continuing political uncertainty and instability, or by the priority of reparations payments (which later came to play a role in the creditors’ panic).1 This looks like similar behavior to that of the classic gold standard era, where crises were followed by a suspicion of certain areas, but not a turning away from all international engagement. -

Of Thè Nazi Elite
of thè Nazi Elite -v\ . t -. '• ' • > PI \(>l IN' Contents List of Illustrations XÌÌÌ Acknowledgements XVÌ Preface xvii Abbreviations xxì Part I Interrogations: an Introduction 1 Outlaw Country 3 The Criminals 25 The Charges 43 Asking thè Questions 57 The Absentees: Hitler, Himmler, Bormann 93 Selective Amnesia? The Case of Hess 115 The Helpful Speer 129 The Unrepentant Goerìng MI The Limits of Responsibility: Strategies of Denial 155 Confessing to Genocìde 175 *I hope they hang ali': Final Retribution 201 Part II Interrogations: thè Transcripts 209 Note on thè Transcripts 211 x Contents Perspectives on thè Fuehrer 213 Document 1 thè driving force' [Albert Speer] 215 Document2 Hitler's Women [Karl Brandt] 258 Document3 The New Feudalism [Hans Lammers] 272 Document 4 Hitler thè Warlord [Alfred Jodl] 276 'The world's worst criminal': Goering in thè Third Reich 285 Document 5 A Souvenir from Monte Cassino [Hermann Goering] 288 Document 6 The Commander-in-Chief [Hermann Goering] 296 Document 7 Conquest by Telephone [Hermann Goering] 307 Document 7b Vote 'No' if you dare [Albert Goering] 312 Waging War 315 Document 8 Ribbentrop, Hitler and War [ Joachim von Ribbentrop] 318 Document 9 Hitler's 'chess game of power politics' [Albert Speer] 323 Document 10 OKW at War [Wilhelm Keitel] 335 Genocide 353 Document li The Fuehrer Order [Dieter Wisliceny] 355 Document 12 A Morbid Accounting [Dieter Wisliceny] 361 Document 13 'incredible things at Auschwitz' 371 [Ernst von Gottstein and Eugen Horak] Document 14 A Doctor at Dachau [Franz Blaha] 374 Document -

Deutsche Finanzinteressen an Den Vereinigten Staaten Und Den Nieder- Landen Im Ersten Weltkrieg*
Aufsatz Marc Frey Deutsche Finanzinteressen an den Vereinigten Staaten und den Nieder- landen im Ersten Weltkrieg* Wohl kein Bereich der Forschung zur Geschichte Deutschlands im Ersten Weltkrieg ist so unterrepräsentiert wie die Analyse der deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen in den Jahren 1914—1918. Darstellungen der deutschen Kriegswirtschaft betonen die wachsende Rohstoff- und Nahrungsmittelknappheit, deren Ausmaß kaum noch lösbare Anforderun- gen an die deutsche Wirtschaft stellten1. Besonders die aus dem anglo-amerikanischen Raum stammende Forschung zum Wirtschaftskrieg übte nachhaltigen Einfluß auf das Ver- ständnis der deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen im Krieg aus. Danach gelang es Groß- britannien, Deutschland mit Hilfe der Blockade bald nach Kriegsausbruch vom Weltmarkt zu verdrängen und den Handel mit dem Ausland im weiteren Verlauf des Krieges ganz zum Erliegen zu bringen2. Schon vor zwanzig Jahren zog Gerd Hardach in seiner inter- nationalen Wirtschaftsgeschichte des Ersten Weltkriegs den Erfolg der alliierten Wirtschafts- blockade gegen Deutschland in Zweifel und verwies auf die Rolle der Neutralen als be- deutende Handelspartner Deutschlands3. Bis heute wurden seine Thesen weder aufgenom: men noch einer genauen Uberprüfung unterzogen. So stellte auch die neuere Forschung zu verschiedenen Aspekten der deutschen Kriegswirtschaft die Wirkung der alliierten Blockade gerade im Hinblick auf die deutschen Außenwirtschaftsbeziehungen nicht in Frage4. Angesichts der großen Bedeutung der neutralen Staaten für die deutsche Kriegs- wirtschaft ist es jedoch erstaunlich, daß die Wirtschafts- und Finanzbeziehungen Deutsch- lands zu Dänemark, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und den Ver- einigten Staaten von der Forschung bislang unberücksichtigt blieben. Studien, die sich mit * Ich möchte mich bei Herrn Prof. Dr. Jürgen Heideking, Frau Dr. Ragnhild Fiebig-v. Hase und Frau Dr. -

United Nations T7ar Crimes Commission
UNITED NATIONS T7AR CRIMES COMMISSION. (Research Office) F A R CRIMES NEWS DIGEST. »: The above title replaces that of Press News Sunnary used in the early nuribers o f this series. For internal circulation CONTENTS. SUMMARY OF EVENTS. PAGE. EUROPE* ... ... *.. •*. ... ... ... 1. THE FAR EAST... ... ••« ... ... ... ... 8. APPENDIX: Mr. Elwyn Jones* article on Kessolring. 9. PURL: https://www.legal-tools.org/doc/5adfc2/ Richer Recaptured, (see No. XXViil, p.1 of this Digest) The Times reported (2.6,47) from Vienna that S.S. General Franz RICHTER, former Nazi Mayor of Vienna, had been reoaptured by tho Austrian police. Ho escaped from tho Vienna municipal prison six woeks ago. Trial of Dr. Hanoi, An Agency moseagc reported (27.5-47) that at tho tidal before the Vlennosc People's Ccurt of Dr. Rudolf HANEL, charged with membership of the Nazi Party before the anschluss, evidenca was given that, dospitu3 himembership, he had given groat help to tho Austrian underground. It was testified that, thanks to infonnation given by Dr. HANEL, it had boon possible to sabotage preparations boing made for tho manufacture of flying bombs, thus dolaying tho beginning of thoir manufacture by as much as nine months. Former Nazi Leador sentenced. The Timos reported (25.5*47) that Johann BRAUN, a former Nazi loador, who set up his own court during tho last days of tho war and hanged five of his enemies, mostly anti-Nazis, was sentenced,on the previous day,to death by tho Vienna People!s Court. Two of his accomplices, Josof V/ENING2R and Johann \7ALIHER, were also sen-) tenood to death. -

Mannheimer: an Important Art Collector Reappraised
Mannheimer: an important art collector reappraised History of ownership from 1920-1952: From Mannheimer to Hitler; recuperation and dispersion in Dutch museums, based on archival documents.1 Main Collection: Rijksmuseum, Amsterdam Kees Kaldenbach (author) Email [email protected] This Word version, 12 November, 2014, 9320 words See http://kalden.home.xs4all.nl/mann/Mannheimer-article.html See the Online Menu of related Mannheimer articles. In the years following World War II, more than 1400 art objects formerly belonging to the German-born banker Fritz Mannheimer (1890-1939) came into the possession of Dutch museums, especially the Amsterdam Rijksmuseum. Highlights of this remarkable collection include top-quality paintings by Rembrandt, Crivelli, Frans van Mieris, and Jan van der Heyden; German applied art objects of the highest quality; master drawings by Fragonard, Watteau, and Boucher; sculptures by Houdon and Falconet; best-of-kind furniture by Röntgen and classic French furniture makers; a world-class array of Meissen porcelain; exquisite silver and gold art objects, ornate snuff boxes and much else. Like many collections belonging to Jews who lived in countries occupied by the Nazis, the Mannheimer art objects were coveted by Adolf Hitler, Hermann Göring, and associated figures from the time of the German invasion of the Netherlands in May 1940. The subsequent ownership history of these extraordinary works of art, both during and after the war, sheds light on the conflicts, greed, breaches of the law, and lingering consequences of that dark and troubled era in world 1 history. The Amsterdam Rijksmuseum had indeed been most enriched in 1952 by receiving the lion’s share of the Mannheimer estate. -

War Crimes Records Pp.77-83 National Archives Collection of World War II War Crimes Records (RG 238)
1 First Supplement to the Appendix U.S. and Allied Efforts To Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by Germany During World War II Finding Aid to Records at the National Archives at College Park Prepared by Dr. Greg Bradsher National Archives and Records Administration College Park, Maryland October 1997 2 Table of Contents pp.2-3 Table of Contents p.4 Preface Military Records pp.5-13 Records of the Office of Strategic Services (RG 226) pp.13-15 Records of the Office of the Secretary of War (RG 107) pp.15-22 Records of the War Department General and Special Staffs (RG 165) pp.22-74 Records of the United States Occupation Headquarters, World War II (RG 260) pp.22-72 Records of the Office of the Military Governor, United States OMGUS pp.72-74 Records of the U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section of Headquarters, U.S. Forces in Austria Captured Records pp.75-77 National Archives Collection of Foreign Seized Records (RG 242) War Crimes Records pp.77-83 National Archives Collection of World War II War Crimes Records (RG 238) Civilian Agency Records pp.84-88 General Records of the Department of State (RG 59) pp.84-86 Central File Records pp.86-88 Decentralized Office of “Lot Files” pp.88-179 Records of the Foreign Service Posts of the Department of State (RG 84) pp.88-89 Argentina pp.89-93 Austria pp.94-95 France pp.95-106 Germany pp.106-111 Great Britain pp.111-114 Hungary pp.114-117 Italy pp.117-124 Portugal pp.125-129 Spain pp.129-135 Sweden pp.135-178 Switzerland 3 pp.178-179 Turkey pp.179-223 Records of the American Commission for the Protectection and Salvage of Artistic and Historic Monumnts in War Areas (RG 239) pp.223-243 Records of the Foreign Economic Administration (RG 169) pp.243-244 Records of the High Commissioner for Germany (RG 466) pp.244-246 Records of the U.S. -

ERR Archival Guide, Appendix 1
A1-1 RECONSTRUCTING THE RECORD OF NAZI CULTURAL PLUNDER A GUIDE TO THE DISPERSED ARCHIVES OF THE EINSATZSTAB REICHSLEITER ROSENBERG (ERR) AND THE POSTWAR RETRIEVAL OF ERR LOOT Expanded and Updated Edition Patricia Kennedy Grimsted APPENDIX 1: FRENCH AND BELGIAN JEWISH ART COLLECTIONS PROCESSED BY THE ERR IN THE JEU DE PAUME, 1940–1944: CORRELATION TABLES FOR ARCHIVAL SOURCES (November 2019) Published online with generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), in association with the International Institute of Social History (IISH) © Copyright 2019, Patricia Kennedy Grimsted A1-2 Appendix 1 supplements specifically: Chapter 1: Belgium (December 2016) Chapter 2: France (January 2020) Chapter 3: Germany (November 2019) Chapter 10: United States of America (March 2015) The updated Introduction to the ERR Archival Guide along with these and other revised chapters are now available at: https://www.errproject.org/guide.php. Appendix 1 Following the Introduction, six tables cover the various art collections processed in the ERR in the Jeu de Paume: Table 1: Private Named French Jewish Collections Processed by the ERR in the Jeu de Paume Table 2: Private Named Belgian Jewish Collections Processed by the ERR in the Jeu de Paume Table 3: Collections of Objects Seized by the Möbel-Aktion in France Table 4: Collections of Objects Seized by the Möbel-Aktion and by the Brüssel Treuhandgesellschaft (BTG) in Belgium Table 5: ERR Special Collections (other than those belonging to individuals) Table 6: Other -

Claims Resolution Tribunal
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Award to Claimant Kommanditgesellschaft Mendelssohn & Co. i. L., represented by von Trott zu Solz Lammek to Claimant [REDACTED 1] and to Claimant [REDACTED 2] in re Account of Mendelssohn & Co. i. L. Claim Numbers: 501771/RS, 205199/RS, 785948/RS1 Award Amount: 162,500.00 Swiss Francs This Certified Award is based upon the claim of Kommanditgesellschaft Mendelssohn & Co. in Liquidation, ( Claimant M. & Co. i. L. ) to the account of Kommanditgesellschaft Mendelssohn & Co. i. L., the claim of [REDACTED 2], née [REDACTED], ( Claimant [REDACTED 2] ) to the account of Fritz Mannheimer,2 and the claim of [REDACTED 1] ( Claimant [REDACTED 1] ) (together the Claimants ) to the account of Dr. Fritz Mannheimer.3 This Award is to the unpublished account of Mendelssohn & Co. i. L. (the Account Owner ) at the Basel branch of the [REDACTED] (the Bank ). 1 Claimant [REDACTED 1] did not submit a Claim Form to the CRT. However, in 1999 he submitted an Initial Questionnaire ( IQ ), numbered ENG 0621 107, to the Court in the United States. Although this IQ was not a Claim Form, the Court, in an Order signed on 30 July 2001, ordered that those Initial Questionnaires which can be processed as claim forms be treated as timely claims. Order Concerning Use of Initial Questionnaire Responses as Claim Forms in the Claims Resolution Process for Deposited Assets (July 30, 2001). The IQ was forwarded to the CRT and has been assigned claim number 785948. 2 The CRT did not locate an account belonging to Fritz Mannheimer in the Account History Database prepared pursuant to the investigation of the Independent Committee of Eminent Persons ( ICEP or ICEP Investigation ), which identified accounts probably or possibly belonging to Victims of Nazi Persecution, as defined in the Rules Governing the Claims Resolution Process, as amended (the Rules ).