Jahresbericht 2010 Der Informatik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Safecop D2.1 State-Of-The-Art on Safety Assurance Rev. 1
Ref. Ares(2016)5712035 - 02/10/2016 Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication D2.1 JU GA# 692529 Report type Deliverable D2.1 Report name State-of-the-art on safety assurance Dissemination level PU Report status: Final Version number: 1.0 Date of preparation: 2016-09-30 Contributors Maelardalens Hoegskolan, Sweden DNV GL, Norway Intecs SPA, Italy Safety Integrity AB, Sweden Aitek Societa' per Azioni, Italy Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Italy Danmarks tekniske universitet, Denmark Universita Degli Studi Dell'Aquila, Italy Qamcom Research and Technology AB, Sweden Kungliga Tekniska Hoegskolan, Sweden © The SafeCOP Consortium 2 D2.1 JU GA# 692529 Revision history 0.1 2016-09-09 First draft 0.2 2016-09-20 First review 0.3 2016-09-27 Updated draft 0.4 2016-09-28 Final review among the partners 1.0 2016-09-30 Final release © The SafeCOP Consortium 3 D2.1 JU GA# 692529 Table of contents 1 Introduction ................................................................................. 7 1.1 Background ................................................................................... 7 1.2 Content, Aims and Relevance of this Report for the SafeCOP project 8 1.3 Overview of the Report ................................................................. 8 2 Safety management philosophies ................................................ 10 2.1 ISO 31000 – Risk management ................................................ 10 2.2 Barrier management ............................................................... 12 2.3 Technology -
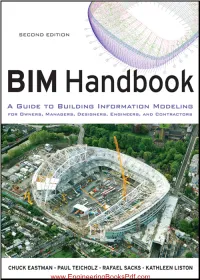
BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors
www.EngineeringBooksPdf.com www.EngineeringBooksPdf.com BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors Second Edition Chuck Eastman Paul Teicholz Rafael Sacks Kathleen Liston John Wiley & Sons, Inc. ffirs.indd i 3/8/11 10:53:45 PM www.EngineeringBooksPdf.com This book is printed on acid-free paper. ϱ Copyright © 2011 by John Wiley & Sons, Inc.. All rights reserved Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Published simultaneously in Canada No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600, or on the web at www.copyright.com. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008, or online at www.wiley.com/go/permissions. Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and the author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifi cally disclaim any implied warranties of merchantability or fi tness for a particular purpose. -

Parastoo Ebrahimzadeh Pirshahid
Evaluating interoperability of ISO 15926 implementation: A case study of IFSWorld Company in the use of data interoperability between computer systems Master of Science Thesis in Software Engineering and Technology PARASTOO EBRAHIMZADEH PIRSHAHID Chalmers University of Technology University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering Göteborg, Sweden, June 2013 The Author grants to Chalmers University of Technology and University of Gothenburg the non-exclusive right to publish the Work electronically and in a non-commercial purpose make it accessible on the Internet. The Author warrants that he/she is the author to the Work, and warrants that the Work does not contain text, pictures or other material that violates copyright law. The Author shall, when transferring the rights of the Work to a third party (for example a publisher or a company), acknowledge the third party about this agreement. If the Author has signed a copyright agreement with a third party regarding the Work, the Author warrants hereby that he/she has obtained any necessary permission from this third party to let Chalmers University of Technology and University of Gothenburg store the Work electronically and make it accessible on the Internet. Evaluating interoperability of ISO 15926 implementation: A case study of IFSWorld Company in the use of data interoperability between computer systems PARASTOO EBRAHIMZADEH PIRSHAHID © PARASTOO EBRAHIMZADEH PIRSHAHID, June 2013. Examiner: Sven-Arne Andréasson Chalmers University of Technology University of Gothenburg Department of Computer Science and Engineering SE-412 96 Göteborg Sweden Telephone + 46 (0)31-772 1000 Cover: Different parts of ISO 15926 standard. The standard is like a natural language which allows everyone to have conversation and exchange information, Department of Computer Science and Engineering Göteborg, Sweden June 2013. -

15926 Editor Version 1.4
.15926 Editor Version 1.4 Volume 1 Getting Started Welcome to the .15926 Editor. This free software is distributed by TechInvestLab.ru “as is” without any warranties or obligations, for testing purposes. Use it and enjoy at your own risk. Please send bug reports, usage and licensing questions or suggestions to [email protected] . February 23, 2013 .15926 Editor v1.4 Volume 1. Getting Started TechInvestLab.ru Volume 1. Getting Started Contents License ...............................................................................................................................................4 1. Introduction .....................................................................................................................................5 2. Installing and running the program ....................................................................................................6 3. Glossary ..........................................................................................................................................7 4. User interface ..................................................................................................................................9 4.1. Interface overview .....................................................................................................................9 4.2. Keyboard shortcut list .............................................................................................................. 10 4.3. Main menu ............................................................................................................................. -

Master's Degree Thesis
Master’s degree thesis LOG950 Logistics Virtual warehousing in offshore oil and gas platforms’ supply chain Kiril Kukareko Number of pages including this page: 76 Molde, 05 January, 2013 Mandatory statement Each student is responsible for complying with rules and regulations that relate to examinations and to academic work in general. The purpose of the mandatory statement is to make students aware of their responsibility and the consequences of cheating. Failure to complete the statement does not excuse students from their responsibility. Please complete the mandatory statement by placing a mark in each box for statements 1-6 below. 1. I/we herby declare that my/our paper/assignment is my/our own work, and that I/we have not used other sources or received other help than is mentioned in the paper/assignment. 2. I/we herby declare that this paper Mark each 1. Has not been used in any other exam at another box: department/university/university college 1. 2. Is not referring to the work of others without acknowledgement 2. 3. Is not referring to my/our previous work without acknowledgement 3. 4. Has acknowledged all sources of literature in the text and in the list of references 4. 5. Is not a copy, duplicate or transcript of other work 5. I am/we are aware that any breach of the above will be considered as cheating, and may result in annulment of the 3. examinaion and exclusion from all universities and university colleges in Norway for up to one year, according to the Act relating to Norwegian Universities and University Colleges, section 4-7 and 4-8 and Examination regulations section 14 and 15. -

Asset Information for FMEA-Based Maintenance
Asset information for FMEA-based maintenance Jan Braaksma Published by: University of Groningen Groningen The Netherlands Printed by: Ipskamp Drukkers B.V. ISBN: 978-90-367-5806-2 (book) 978-90-367-5807-9 (e-book) © 2012, Jan Braaksma RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Asset information for FMEA-based maintenance Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. E. Sterken, in het openbaar te verdedigen op donderdag 15 november 2012 om 12.45 uur door Anne Johannes Jan Braaksma geboren op 25 februari 1980 te Leeuwarden Promotores: Prof. dr. ir. J.C. Wortmann Prof. dr. ir. G.J.C. Gaalman Copromotor: Dr. ir. W. Klingenberg Beoordelingscommissie: Prof. dr. B. Iung Prof. dr. H. van Landeghem Prof. dr. R. Teunter ISBN: 978-90-367-5806-2 (book) 978-90-367-5807-9 (e-book) Contents 1 Introduction 1 1.1 Motivation of the study .......................................................................... 1 1.2 Feedback is essential for FMEA-based maintenance ........................... 4 1.3 Industrial setting .................................................................................... 5 1.4 Research aim .......................................................................................... 6 1.5 Research objectives ................................................................................ 7 1.6 Thesis outline ......................................................................................... 9 2 Failure Mode and Effects Analysis in -

CIB 2011-W78-W102-Paper Example
AN APPROACH TO MODELLING GEOMETRIC OBJECTS WITH THE ISO 15926 STANDARD Geiza M. Hamazaki da Silva, Dsc / Reaseach Director, [email protected] †‡ Gabriel B. Monteiro Lopes, Bsc. / Head of Project, [email protected]† †Tecgraf-PUC-Rio- Computer Graphics Technology Laboratory ‡ UNIRIO- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ABSTRACT No matter in which area they are applied, information technologies are used to increase the productivity of companies that use different computer systems from different suppliers. Most of time, data are stored in proprietary format. This fact creates difficulties for the integration and interoperation between the computer systems, forcing companies to invest money to simply mitigate this problem. Specifically in the field of Oil & Gas, the ISO 15926 standard (Industrial automation systems and integration – Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities) proposes a standard for integration, sharing, exchange and delivery of data between computer systems based on the standardization of data formats and on an ontology approach to represent common industry classes and relations. Due to the structure and the large number of terms defined at the ISO 15926 standard, the complexity to model objects using that library is high. This work presents a methodology to model geometric objects following structure of the standard, harmonizing Parts 2, 3, 4 and 7 of ISO15926. The writers take into account the need for complete abstraction between geometry and business data, as well as the requirement for a federated architecture for managing process plant project item symbology. Keywords: Geometry, Ontology, Semantic Web, Interoperability, Oil & Gas 1. -
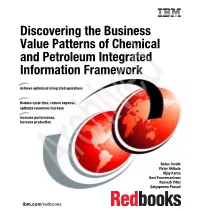
Discovering the Business Value Patterns of C&P
Front cover Discovering the Business Value Patterns of Chemical and Petroleum Integrated Information Framework Achieve optimized integrated operations Reduce cycle time, reduce expense, optimize resources increase Increase performance, increase production Rufus Credle Victor Akibola Vijay Karna Devi Panneerselvam Remesh Pillai Satyaprema Prasad ibm.com/redbooks International Technical Support Organization Discovering the Business Value Patterns of Chemical and Petroleum Integrated Information Framework August 2009 SG24-7735-00 Note: Before using this information and the product it supports, read the information in “Notices” on page v. First Edition (August 2009) This edition applies to IBM WebSphere Business Modeler v6.2, IBM WebSphere Integration Developer v6.2, IBM WebSphere Process Server v6.2, Chemical and Petroleum Integrated Information Framework v1.3, WebSphere Application Server v7.0, IBM WebSphere Enterprise Service Bus v6.2, WebSphere Message Broker v6.1, and WebSphere Partner Gateway v6.2. © Copyright International Business Machines Corporation 2009. All rights reserved. Note to U.S. Government Users Restricted Rights -- Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. Contents Notices . v Trademarks . vi Preface . vii The team that wrote this book . vii Become a published author . ix Comments welcome. x Chapter 1. Introduction. 1 Chapter 2. Introduction to the chemical and petroleum industry. 11 2.1 Fundamentals of the petroleum industry . 12 2.2 Industry segment. 14 2.3 Fundamentals of chemical industry. 17 2.3.1 Product segmentation . 17 Chapter 3. Business challenges . 19 3.1 Productivity challenges . 23 3.2 Aging workforce challenges . 24 3.3 Data management challenges. 24 3.4 Information management challenges . -
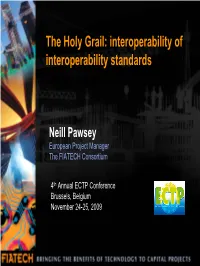
The Holy Grail: Interoperability of Interoperability Standards
The Holy Grail: interoperability of interoperability standards Neill Pawsey European Project Manager The FIATECH Consortium 4th Annual ECTP Conference Brussels, Belgium November 24-25, 2009 First, a word about FIATECH… FIATECH … … is an industry-led consortium that provides global leadership in identifying and accelerating the development, demonstration and deployment of fully integrated and automated technologies to deliver highest business value throughout the life cycle of all types of capital projects. …has developed a “Roadmap for Capital Projects” to ensure right technologies are developed in the order that delivers highest business value across all phases and processes of the capital project life cycle. FIATECH is a Consortium… FIATECH…Delivers! Life Cycle Data Management (LCDM) ¾ Industry-led, Capital Projects Technology Roadmap collaborative, AEX not-for-profit, RD&D 8 Smart Chips Reports consortium Catalogue of Emerging Construction Technologies Decision Sequence and Influence Diagrams for ¾ Mission: accelerate project planning deployment of BIM for Precast Concrete Report integration and Leveraging Technology to Increase Construction automation Productivity Report technology Automated Design Workflow Mappings Operational Facility Roadmap Directory ¾ Mechanism: Tools for streamlining the building regulatory Focused process implementation Electronic Valve Cross-reference Catalogue – Projects GVCC Report - Developing Core Technology Competencies ¾ Guide: Capital Report - attracting the next generation to industry -

Strategic Roadmaps and Implementation Actions for ICT in Construction
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/245587162 Strategic Roadmaps and Implementation Actions for ICT in Construction Article · September 2006 CITATIONS READS 10 164 4 authors, including: Abdul Samad Kazi Bob Martens VTT Technical Research Centre of Finland TU Wien 100 PUBLICATIONS 381 CITATIONS 185 PUBLICATIONS 339 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Alain Zarli R2M Solution 116 PUBLICATIONS 609 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: REFINET View project eCAADe View project All content following this page was uploaded by Alain Zarli on 04 August 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. Strategic Roadmaps and Implementation Actions for ICT in Construction Value-driven business processes ICT enabled Industrialised business models Proro production ee ce ss s i s rri rprp ee Knowledge tt Thematic tt Digital sharing nn Roadmaps cc models EE uu dd P roro Pr P rojje P Collaboration ect Intelligent support constructions Interoperability Strat-CON Strategic Actions for Realising the Vision of ICT in Construction www.strat-con.org Dr. Abdul Samad (Sami) Kazi & Matti Hannus, VTT, Finland Dr. Alain Zarli, CSTB, France Dr. Bob Martens TU – Wien, Austria Copyright © 2007 Strat-CON Some rights reserved. This publication is released under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivativeWorks license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/). Under this license, you are free to copy, distribute, and perform the work presented in this book under the following conditions: you must give the original author(s) credit for the work; you may not use it for commercial purposes; you may not alter, transform, or build upon this work.