Jahresthema: "Verben Des Glaubens"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tifh CHORALE CANTATAS
BACH'S TREATMIET OF TBE CHORALi IN TIfh CHORALE CANTATAS ThSIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State College in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By Floyd Henry quist, B.A. Denton, Texas August, 1950 N. T. S. C. LIBRARY CONTENTS Page LIST OF ILLUSTRATIONS. ...... .... v PIEFACE . vii Chapter I. ITRODUCTION..............1 II. TECHURCH CANTATA.............T S Origin of the Cantata The Cantata in Germany Heinrich Sch-Utz Other Early German Composers Bach and the Chorale Cantata The Cantata in the Worship Service III. TEEHE CHORAI.E . * , . * * . , . , *. * * ,.., 19 Origin and Evolution The Reformation, Confessional and Pietistic Periods of German Hymnody Reformation and its Influence In the Church In Musical Composition IV. TREATENT OF THED J1SIC OF THE CHORAIJS . * 44 Bach's Aesthetics and Philosophy Bach's Musical Language and Pictorialism V. TYPES OF CHORAJETREATENT. 66 Chorale Fantasia Simple Chorale Embellished Chorale Extended Chorale Unison Chorale Aria Chorale Dialogue Chorale iii CONTENTS (Cont. ) Chapter Page VI. TREATMENT OF THE WORDS OF ThE CHORALES . 103 Introduction Treatment of the Texts in the Chorale Cantatas CONCLUSION . .. ................ 142 APPENDICES * . .143 Alphabetical List of the Chorale Cantatas Numerical List of the Chorale Cantatas Bach Cantatas According to the Liturgical Year A Chronological Outline of Chorale Sources The Magnificat Recorded Chorale Cantatas BIBLIOGRAPHY . 161 iv LIST OF ILLUSTRATIO1S Figure Page 1. Illustration of the wave motive from Cantata No. 10e # * * # s * a * # . 0 . 0 . 53 2. Illustration of the angel motive in Cantata No. 122, - - . 55 3. Illustration of the motive of beating wings, from Cantata No. -

September 20 Cantata Bulletin
Welcome to Grace Lutheran Church We are glad that you have joined us for this afternoon’s Bach Cantata Vespers. For those who have trouble hearing, sound enhancement units are available in the back of the church and may be obtained from an usher. Please silence all cell phones and pagers. Recording or photography of any kind during the service is strictly forbidden. This afternoon’s Bach Cantata Vespers is generously underwritten by the Sukup Family Foundation. 2 The Seventeenth Sunday after Pentecost September 20, 2015 + 3:45 p.m. EVENING PRAYER PRELUDE Prelude in B Minor, BWV 544a Johann Sebastian Bach (1685–1750) Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641 J. S. Bach Fugue in B Minor, BWV 544b J. S. Bach Martin Jean, organ We stand, facing the candle as we sing. SERVICE OF LIGHT 3 4 + SALMODY + We sit. P PSALM 141 Women sing parts marked 1. Men sing parts marked 2. All sing parts marked C. 5 Silence for meditation is observed, then: PSALM PRAYER L Let the incense of our repentant prayer ascend before you, O Lord, and let your lovingkindness descend upon us, that with purified minds we may sing your praises with the Church on earth and the whole heavenly host, and may glorify you forever and ever. C Amen. MOTET: Quaerite primum regnum Dei Sethus Calvisius (1556–1615) Quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejus: Strive first for the kingdom of God and his righteousness: et haec omnia adjicientur vobis, alleluia. and all these things will be given to you as well. -
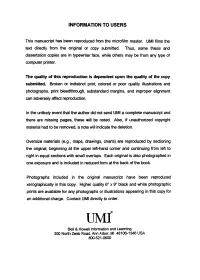
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning a t the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMÏ Bell & Howell Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 NOTE TO USERS This reproduction Is the best copy available UMI UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE FRANZ LISZT’S SOLO PIANO MUSIC FROM HIS ROMAN PERIOD, 1862-1868 A Document SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts By DALE JOHN WHEELER Norman, Oklahoma 1999 UMI Number: 9941855 Copyright 1999 by Wheeler, Dale John All rights reserved. -
Lieder, Lexikon, Ergänzende Dateien
Otto Holzapfel, Liedverzeichnis [Hildesheim: Olms, 2006], CD-ROM-Update = Januar 2021. Dateien: Lieder, Lexikon, ergänzende Dateien. Alle Rechte vorbehalten, nicht zum Verkauf; kann kostenlos interessierten KollegInnen und Institutionen überlassen werden. Update jeweils beim Verfasser (Freiburg i.Br.; ottoholzapfel[at]yahoo.de) und im Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern (Bruckmühl); © gemeinsames Copyright für die vorliegende Zusammenstellung insgesamt Otto Holzapfel und / oder Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern (VMA). - Abkürzungen, wichtige Stichwörter und Liedverweise, ausgeschriebene Literaturhinweise sind mit # plus Begriff [ohne Abstand] auffindbar (bei der Literatur in der Regel jeweils an der ersten Stelle, zusätzlich in der ausführlichen Datei „Einleitung und Bibliographie“); * = Melodie; vgl. = Sekundärliteratur [Weiteres siehe „Einleitung“]. - An der Behebung leider möglicher Fehler arbeitet der Verfasser; für Korrekturen bin ich dankbar. – Ausgewählte Textstellen sind Zitate, Angaben zu einer ‚Fundstelle‘ mit möglicherweise jeweils eigenem Copyright, das zu beachten ist. Das gilt auch für die Abbildungen („Bildzitat“); die entspr. Quellen sind angegeben. - Dieses Liedverzeichnis entsprach mit allen fett gedruckten Eintragungen einem „Findbuch“ des ehem. „Deutschen Volksliedarchivs“ (DVA) in Freiburg i.Br. nach dem Stand von 2005 (ergänzt mit Quellen aus dem VMA); wichtige Ergänzungen (bzw. vom Verf. nicht allein mit den Liedtypenmappen des DVA bearbeitet) sind fett kursiv (siehe zu: „A, a, a, Adam...“ [Quellen…]). -

HILLE-POST Mitteilungen Für Die Freunde Des Dichters
HILLE-POST Mitteilungen für die Freunde des Dichters Nieheim-Erwitzen Januar 2017 50. Folge Peter Hille Gisela Aneder: Gobelin mit Porträt Peter Hilles (1987), Hille-Haus Mitteilungsblatt der Peter-Hille-Gesellschaft e.V. Inhalt MICHAEL KIENECKER 3 Rückblick 2016 und Vorschau 2017 PROTOKOLL DER GENERALVERSAMMLUNG 7 vom 10. September 2016 DR. CHRISTIANE BAUMANN (MAGDEBURG) 11 Frühe Texte Hilles im Kontext von Publizistik und Literatur des Frühnaturalismus (1871-1885) DR. PIERRE G. POUTHIER 25 Ein „höhenwärts wirbelnder Segen“ Peter Hilles poetische Gebete HINWEISE AUF NEUE PUBLIKATIONEN 46 © Peter-Hille-Gesellschaft e. V. Nieheim 2017 Redaktion: Dr. Michael Kienecker – Vorsitzender der Peter-Hille-Gesellschaft e.V. Carmen Jansen 2 Rückblick 2016 und Vorschau 2017 Zum Neuen Jahr 2017 Liebe Hille-Freunde, ein in vielen Hinsichten bedrückendes, mit Blick auf die menschenverachtenden Kriege und Terroranschläge geradezu erschütterndes Jahr liegt hinter uns. Wie weit entfernt scheinen viele Menschen von Peter Hilles – zugegeben sehr optimistischem – Wunsch zu sein, dass die Menschen einst verstehen mögen, „rein Mensch zu sein, rein Mensch um der Fülle der Schönheit willen, die in diesem Stande ruht.“ (Der letzte Alpdruck). An der Schwelle des neuen Jahres bleibt uns nur die Hoffnung, dass die globalen Ent- wicklungen wieder beruhigter und mit tieferem Respekt vor der Würde des Menschen verlaufen. Ihnen persönlich wünsche ich für den weiteren Verlauf des noch jungen Jahres 2017 vor allem Gesundheit, Freude und Erfolg! Rückschau 1. In der Zeit vom 5.-8. Mai 2016 fand – erstmals nach vielen Jahren – wieder eine Lite- raturfahrt der Hille-Gesellschaft statt: Mit insgesamt 33 Teilnehmern ging es über die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel nach Berlin. -

Bach's Chorals
BACH'S CHORALS PART I THE HYMNS AND HYMN MELODIES OF THE " PASSIONS" AND ORATORIOS "A httle volume on the sources of the Chorales, the utility of which is out of all proportion to its modest bulk." --Mr Ernest Newman m the Birmingham Post. "An invaluable work of reference."--Guardian. "A great mass of interesting information, collected from all available sources, and brought together for the first time in this convenient form."--Yorkshzre Post. "This useful work of reference."--Muszcal Times. "The result of an extenswe amount of research and erudltion."--Standard. "A careful piece of musical archaeological enquiry, done with thoroughness and care."--Scotsman. "A scholarly pmce of work."--Oxford ll[agazine. "An invaluable volume of reference, and as such it will qmckly become a standard work."--Music Student. "A perfect storehouse of informatmn.'_--gusical News. PART II! THE CHORALS OF THE ORGAN WORKS (In the Press) BACH'S CHORALS CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS C. F. CLAY, MANAGER 1London: FETTER LANE, E.C. ]E_itfl3tt_gIj: ioo PRINCES STREET i_¢_ _or_: G P. PUTNAM'S SONS _ombat_, _;alrutta _n_ _tlra_;: MACMILLAN AND CO., LTV. • _m_te: J. M. DENT AND SONS, LTD. _ak_0: THE MARUZEN-KABUSHIKI-KAISHA All rlKhls reserved / BACH'S CHORALSj J BY CHARLES SANFORD TERRY PART II THE HYMNS AND HYMN MELODIES OF THE CANTATAS AND MOTETTS Cambridge : at the University Press I917 r_12 i PREFATORY NOTE N melodiesPart I of ofthisthework" Passions"the Hymnsand andOratoriosHymn have been dealt with. In the present volume those of the Cantatas and Motetts are considered. The Hymn melodies of the Organ Works are reserved for Part [I I. -

Zum Choralschaffen Im Thüringer Raum Das Gesangbuch Der Evangelischen Kirche Ist Eine Sammlung Geistlicher Lieder Aus Rund 500 Jah- Ren
Siegfried Freitag Zum Choralschaffen im Thüringer Raum Das Gesangbuch der evangelischen Kirche ist eine Sammlung geistlicher Lieder aus rund 500 Jah- ren. In den unterschiedlichen Ausgaben handelt es sich um bis zu 700 oder auch mehr Lieder, die zur Gestaltung des Gottesdienstes zur Verfügung stehen. Der Gemeindegesang ist ein Ergebnis der Reformation. Mit Martin Luther erhielt er den gleichberechtigten Platz neben Predigt und Gebet. Das geistliche Lied, das im Gottesdienst choraliter, d. h. gesungen, ohne Instrumentalbegleitung, dargeboten wurde, erhielt Jahrzehnte nach Luther schlichtweg die Bezeichnung „Choral“. Neben dem vielfältigen Gebrauch stellt das Gesangbuch ein einmaliges kulturhistorisches Dokument dar. Um dem anfänglichen Mangel an Liedern für den neugestalteten Gottesdienst zu begegnen, hat Luther selbst Lieder geschaffen. So entstanden 1523 die Lieder „Ein neues Lied wir heben an“ und „Nun freut euch, lieben Christen g‘mein“. In den nächsten Jahren folgten „Ach Gott im Himmel sieh darein“, „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“, „Jesus Christus, unser Heiland“, „Ein feste Burg ist unser Gott“ und andere. Für eine breite Durchsetzung des Gemeindegesangs aber war das noch zu wenig. So schrieb er Ende 1523 in einem Brief an seinen Mitstreiter Georg Spalatin: „Meine Absicht ist es, nach dem Beispiel der Propheten und der alten Väter der Kirche deutsche Psalmen für das Volk zu schaffen, das heißt, geistliche Lieder, damit das Wort Gottes auch durch den Gesang unter den Leuten gegenwärtig ist.“ Es sollen, wie es weiter heißt, Gesänge sein „entsprechend der Fassungskraft des Volkes“ und es sollen „schöne und zugleich wohlge- setzte Worte gesungen werden“. Luthers For- derung gipfelt in den Worten: „Daher suchen wir überall nach Dichtern.“ In diesem Bestreben regt er den Druck erster Liederbücher an. -

Evangelical Lutheran Hymnary Handbook — Biographies and Sources —
Evangelical Lutheran Hymnary Handbook — Biographies and Sources — Most of the articles in this online handbook are from Library of Christian Hymns by John Dahle, a resource book on The Lutheran Hymnary (1913) and from Handbook to The Lutheran Hymnal (1942) which accompanied The Lutheran Hymnal (1941). Our information tells us that these books are both in the public domain. However, the arrangement of the material in these pages is copyright by the ELS Worship Committee. Please feel free to copy and distribute public domain material from these pages for non-profit, non-commercial use. A few short articles have been taken from other sources, indicating their copyright. They are here under the fair use provision for copyrighted material. If we have inadvertently posted your copyrighted material, please contact us and it will be removed. _________________________________________________________________ 150 Psalms of David, Edinburgh, 1615 363. DUNDEE A Student’s Hymnal, 1923 setting: 103. ES FLOG EIN KLEINS WALDVÖGELEIN Aaberg, Jens Christian, 1877-1970 Aaberg, author of Hymns and Hymnwriters of Denmark, 1945, and editor of Favored Hymns and Songs, 1961, translated some eighty hymns and songs from Danish and served on the committees which compiled the American Lutheran Hymnal, 1930; the Hymnal for Church and Home, 1927; the Junior Hymnal for Church and Home, 1932; and the revised Hymnal for Church and Home, 1928. Born November 8, 1877, in Moberg on the West coast of Denmark, he came to the United States in 1901. He went to Minneapolis, Minnesota, to join his brother who was then studying for the ministry at Augsburg College and Seminary.