Institut Für Mathematik Der Universität Augsburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

& Electrical Engineering
COMPUTER ARCUTECTURFL Gordon Bell Vice President, Engineering Digital Equipment Corporation & Professor of Computer Science & Electrical Engineering Carnegie-Mellon University (on leave) Abstract Minimal cost computer designs ( i.e. minicomputers) are predicated on using technological cost-performance improvements which occur at an annual rate of 25-305. New applications are thereby feasible with the decreasing costs. A significant number of minicomputers are manufactured in which the cost is constant (or rising), thereby providing more performance (capabilities). The higher performance machines "taket1 their characteristics from the larger, general purpose camputers (e.g. floating point arith- metic, multiprocessors, cache memories and memory management) . The origin and evolution of the minicomputer will be discussed with regard to technology and applications. 7 17178 THR PDP-I? FAMILY AND VAX-Ill780 FOR A LARGE VIRTUAL ADDRESS Gordon Bell Vice President, Engineering Digital Equipment Corporation & Professor of Computer Science & Electrical Engineering Carnegie-Mellon University (on leave) Abstract In the eight years the PDP-11 has been on the market, more than 50,000 units in ten different models have been sold. Although one of the system design goals was a broad range of models, the actual range of 500 to 1 (in price and memory size) has exceeded the design goal. The PDP-11 was designed and first implemented to be a mall minicomputer. Its first extension was to a bigger physical address, memory segmentation for multiprogramming and for higher performance. This part of the talk will briefly reflect the experience in the design process, comment on its success from the point of view of the goals, and its use of technology. -

Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information
Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information April 1986 NTIS order #PB87-100301 Recommended Citation: U.S. Congress, Office of Technology Assessment, lntellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information, OTA-CIT-302 (Washington, DC: U.S. Govern- ment Printing office, April 1986). Library of Congress Catalog Card Number 86-600522 For sale by the Superintendent of Documents U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402 Foreword This report examines the impact of recent and anticipated advances in com- munication and information technologies on the intellectual property system. It focuses primarily on the Federal copyright system, and on the continuing effec- tiveness of copyright law as a policy tool in the light of technologies such as audio- and videorecorders, computer programs, electronic databases, and telecommuni- cations networks. To obtain a comprehensive view, the study examined the intel- lectual property system from a number of perspectives: the constitutional basis of intellectual property policy; the system’s goals, laws, and economics; the crea- tive environment; problems of enforcement; the international context; and the Fed- eral role in administering intellectual property rights. OTA found that technological developments are affecting all aspects of the intellectual property system. Moreover, because we are only beginning to move into the era of electronic information, the full impact of new technologies will not become fully apparent for some time. Fundamental changes are occurring in in- formation technologies that will antiquate many of the policy mechanisms now in force, and bring new intellectual property problems requiring new solutions. Thus, even if Congress acts now in response to current problems, it will need to be prepared to act again within the next decade. -

Andrew J. and Erna Viterbi Family Archives, 1905-20070335
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt7199r7h1 Online items available Finding Aid for the Andrew J. and Erna Viterbi Family Archives, 1905-20070335 A Guide to the Collection Finding aid prepared by Michael Hooks, Viterbi Family Archivist The Andrew and Erna Viterbi School of Engineering, University of Southern California (USC) First Edition USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California, 90089-0189 213-740-5900 [email protected] 2008 University Archives of the University of Southern California Finding Aid for the Andrew J. and Erna 0335 1 Viterbi Family Archives, 1905-20070335 Title: Andrew J. and Erna Viterbi Family Archives Date (inclusive): 1905-2007 Collection number: 0335 creator: Viterbi, Erna Finci creator: Viterbi, Andrew J. Physical Description: 20.0 Linear feet47 document cases, 1 small box, 1 oversize box35000 digital objects Location: University Archives row A Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California, 90089-0189 Language of Material: English Language of Material: The bulk of the materials are written in English, however other languages are represented as well. These additional languages include Chinese, French, German, Hebrew, Italian, and Japanese. Conditions Governing Access note There are materials within the archives that are marked confidential or proprietary, or that contain information that is obviously confidential. Examples of the latter include letters of references and recommendations for employment, promotions, and awards; nominations for awards and honors; resumes of colleagues of Dr. Viterbi; and grade reports of students in Dr. Viterbi's classes at the University of California, Los Angeles, and the University of California, San Diego. -

Ieee Alexander Graham Bell Medal Recipients
IEEE ALEXANDER GRAHAM BELL MEDAL RECIPIENTS 2021 NICHOLAS M. MCKEOWN “For contributions to internet router (FIEEE)—Professor of Electrical architecture and software-defined Engineering and Computer networking.” Science, Stanford University, Stanford, California, USA 2020 RAJIV LAROIA “For contributions to cellular wireless data Founder & CTO, Light systems.” Company, Far Hills, New Jersey, USA 2019 TERESA HUAI-YING MENG “For technical contributions to and Professor Emeritus, Reif leadership in the development of wireless Weaver Dennis Professor in semiconductor technology.” Electrical Engineering and Professor of Computer Science, Stanford, California, USA 2018 NAMBIRAJAN SESHADRI “For contributions to the theory and Former Chief Technology practice of wireless communications.” Officer, Broadcom Corporation, Irvine, California, USA 2017 H. VINCENT POOR “For fundamental contributions to signal Michael Henry Strater processing and its application to digital University Professor of Electrical communications.” Engineering, Princeton University, Princeton, NJ, USA 2016 ROBERTO PADOVANI “For innovations enabling efficient, Executive Vice President and wideband, wireless access to the Internet, Fellow, Qualcomm that is central to all third-generation Technologies, San Diego, CA, cellular networks.” USA 2015 FRANK KELLY “For creating principled mathematical Professor, University of foundations for the design and analysis of Cambridge, Cambridgeshire, congestion control, routing, and blocking in United Kingdom modern communication networks.” 2014 -
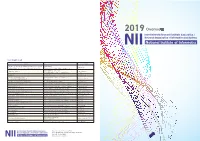
2019Overview
2019 Overview Contact List Content Contacts Contact Information KakenhiKakenhi (P.18).(P.18). CollaborativeCollaborative ResearchResearch PromotionPromotion (P.20)/(P.20)/ Industry-Government-Industry-Government- PlanningPlanning Division,Division, [email protected]@nii.ac.jp AcademiaAcademia CollaborationCollaboration (P.22)/(P.22)/ AcademicAcademic GuidanceGuidance byby ResearchersResearchers (P.23)(P.23) Ofce for Social Collaboration, Collaboration Support Team PlanningPlanning Division,Division, OfceOfce tortor SocialSocial IntellectualIntellectual PropertyProperty (P.21)(P.21) [email protected][email protected] Collaboration, Big Project and Intellectual Property Team TopSETopSE (P.23)(P.23) GRACE Center [email protected]@topse.jp InternationalInternational ExchangeExchange (MOU)(MOU) (P.24)/(P.24)/ PlanningPlanning Division,Division, InternationalInternational AffairsAffairs andand EducationEducation [email protected]@nii.ac.jp (NII(NII InternationalInternational InternshipInternship Program)Program) (P.25)(P.25) SupportSupport TeamTeam InternationalInternational ExchangeExchange (NII(NII ShonanShonan Meeting)Meeting) (P.26)(P.26) NII Shonan Meeting Administrative Ofce [email protected]@nii.ac.jp InternationalInternational ExchangeExchange (DAAD/JFLI)(DAAD/JFLI) (P.27)(P.27) PlanningPlanning Division,Division, InternationalInternational AffairsAffairs andand EducationEducation SupportSupport TeamTeam [email protected]@nii.ac.jp Graduate Education (P.28) PlanningPlanning Division,Division, -

School of Engineering the University of Tokyo
School of Engineering The University of Tokyo 東京大学 工学系研究科・工学部概要 2019 Contents 1.Message from the Dean ���� 1 2.Chronology ����������������������� 2 3.Organization ���������������������� 3 4.Number of Faculty and Staff Members �������������������������� 17 5.Numbers of Students ��������� 18 6.International Exchange ������ 21 7.Research Activities ����������� 25 8.Finances ��������������������������� 28 9.Public Relations and Information ���������������������������������������� 29 1.Message from the Dean Engineering includes an extensive academic system that reaches from issues of basic science to challenges spanning overall science and technology as well as the whole of society. Today's society has been realized by advances in science and technology. Yet, the challenges of modern society are complicated, and involve many fields. For example, issues such as energy, environment, resources, water, food and so on are entwined and have complex aspects. Therefore, using technology to control one system too often holds undesired consequences for other systems. Currently, innovation is required in a variety of fields. The School of Engineering at the University of Tokyo consists of 18 graduate departments, 16 undergraduate departments, and 10 affiliated facilities (2 institutes, 8 centers), has over 500 faculty members and is engaged in education and research around the clock. Around 2,000 undergraduate degree students, 2,000 master's degree students and 1,000 doctoral degree students study engineering and conduct research. The School of Engineering consists of diverse and varied fields ranging from those that lead the development and deepening of basic science, to those that strengthen industry and lead innovation, in addition to those that open up new multidisciplinary, cross-disciplinary, and interdisciplinary fields. -

XX CNE-LIPSOR 001225.Pdf
Copyright 1989 by J.F. Coates, Inc. All Rights Reserved Library of Congress Catalog Number: 88- 82961 -I -S-BN: 0-912338-66-0 (Clothbound) : ISBN: 0-912338?9 (Microfiche) A World Future Society Book Published by: Lomond Publications, Inc. P.O. Box 88 Mt. Airy, Maryland 21771 and The World Future Society 4916 St. Elmo Avenue Bethesda, Maryland 20814 TABLE OF CONTENTS FoREwoRn ........................................... vil PREFACE ..............................................xi PART ONE ROLE OF TIiE FUTURIST Chapter 1 The Futurist and the Corporation ..................2 Chapter 2 Characteristics of the Selected Futurists ............. 9 Chapter 3 What Futurists Believe: Comparisons Among 17 ......19 Chapter 4 Strengths, Weaknesses and Gaps in Current Futures Thinking .....................45 PART TWO FUTURIST PROFILES Chapter 5 Roy Amara ..................................59 Chapter 6 Robert U. Ayres ..............................71 Chapter 7 Daniel Bell .................................. 87 Chapter 8 Kenneth E. Boulding ..........................103 Chapter 9 Arthur C. Clarke .............................115 Chapter 10 Peter Drucker ...............................127 Chapter 11 Victor C. Ferkiss .............................143 Chapter 12 Barry B. Hughes ............................. 155 Chapter 13 Alexander King ..............................167 Chapter 14 Richard D. Lamm ............................181 Chapter 15 Michael Marien ............................. 195 Chapter 16 Dennis L. Meadows ...........................207 Chapter 17 James -
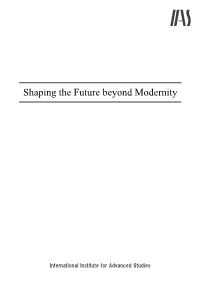
Shaping the Future Beyond Modernity
Shaping the Future beyond Modernity International Institute for Advanced Studies Shaping the Future beyond Modernity International Institute for Advanced Studies (IIAS) International Institute for Advanced Studies (IIAS) was founded in Keihanna Science City in 1984 as an institute for "conduct research for the future and happiness of mankind". Thirty years later, in 2014, we returned to this original spirit, and discussed intensively "What are the big issues in the world of the 21st century, and what are the issues to be addressed immediately at International Institute for Advanced Studies?". Now, to contribute to solving the serious problems facing the drastically changing global society in the near future, we have set up a core program to tackle the following issues in 2015. A: Transforming Science and Technology in the 21st Century - value, system and practice - (Principal Investigator: Tateo Arimoto, Vice Director, International Institute for Advanced Studies) B: Sustainability of Human Survival - Rebuilding of Value Axis towards 2100 - (Principal Investigator: Takamitsu Sawa, Research Advisor, International Institute for Advanced Studies) C: Towards Peaceful Co-living in a World of Diversity (Principal Investigator: Ryuichi Ida, Vice Director, International Institute for Advanced Studies) D: 30 Year Concept for the Keihanna Science City (Principal Investigator: Hiroshi Matsumoto, Vice Director, International Institute for Advanced Studies) To solve various issues in the global society, how should academic studies, science and technology, society, economy, humanity, and near-future cities be? Can we, human beings, continue to survive on the Earth with the ways of life and values as we are? We hereby publish a report on the results of our attempts to transcend countries, organizations, and fields, and have discussions by people of various positions, to find a new direction towards the future of human beings and the Earth. -

No.2 2001 National Institute of Informatics News National Institute
ISSN 1346-8332 No.2 2001 National Institute of Informatics National Institute of Informatics News No.2 Prof. Yasuharu Suematsu, who was the former president of Kochi University of Technology and Tokyo Institute of Technology (Titech), was appointed as the Director General in April 1, 2001. Prof. Suematsu received Doctor degree from Electrical Engineering Department of Titech in 1960. He became a professor and a dean of Engineering Department of Titech (1986 - 1988). He served as the President of Titech from 1989 to 1993 and as the President of Kochi University of Technology from 1997 to March 2001. His research area is optical communications and he has done pioneering work in long-wavelength single mode optical fiber transmission, semiconductor lasers, integrated optics, and optical transmission lines. He served as the President of the Institute of Electronics, Information, and Communication Engineers from 1992 to 1993. He was a chairperson of the Council for University Foundation and School Cooperation of the Ministry of Education, Science, Sports and Culture (up to 2001). He is a vice chairperson of Japanese National Committee for UNESCO, a chairperson of the science division of the Council for Science and Technology, a member of the Science Council of Japan, etc. Thus, he is actively engaged in the field of science and technology, and higher education. In his relationship with NII, he was a member of Board of Councilors of National Center for Science Information Systems(NACSIS) from 1990, which was the former NII. He participated in a committee for establishing and organizing NII as a vice chairperson of "Preparatory Committee of Establishing Core Information Research Institute". -
![Proceedings ICASSP'86. IEEE-IECJ-ASJ International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing [Front Matter]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9554/proceedings-icassp86-ieee-iecj-asj-international-conference-on-acoustics-speech-and-signal-processing-front-matter-10389554.webp)
Proceedings ICASSP'86. IEEE-IECJ-ASJ International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing [Front Matter]
O PROCEEDINGS APRIL 7, 8, 9, 10, 11, 1986 KEIO PLAZA INTER-CONTINENTAL HOTEL TOKYO, JAPAN Sponsored by THE IEEE ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING SOCIETY, THE INSTITUTE OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERS OF JAPAN, and THE ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN Volume 1 of 4 IEEE-IECEJ-ASJ INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING IEftI IIAflIUAIl O)O The 1986 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), sponsored jointly by the IEEE Acoustics, Speech, and Signal Processing Society, the Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan, and the Acoustical Society of Japan, is the eleventh in a series of international conferences devoted to ex- perimental and theoretical aspects of signal processing, speech, and acoustics. Conferences of this scope are possible only because of the continuing interest and support of the Society membership, expressed both by their submission of papers of high quality and by their attendance at the Conference. The ICASSP Conference Committee is grateful to all of the authors and session chairpersons for contributing to the success of the Conference. ICASSP 86 CONFERENCE COMMITTEE GENERAL CHAIRMAN PUBLICITY PUBLICATIONS Hiroya FUJISAKI Yasuo KATO Shizuo HIKI University of Tokyo NEC Corporation Tohoku University Department of Electronic C& Systems Research Laboratories Research Center for Applied Engineering Kawasaki, 213 Japan Information Sciences Bunkyo-ku, Tokyo, 113 Japan (044) 855-1 111 Sendai, 980 Japan (03) 812-2111 (0222) 27-6200 Gary E. KOPEC Schlumberger Palo Alto Research VICE CHAIRMEN Palo Alto, CA 94304, U.S.A. GENERAL AFFAIRS Ken'iti KIDO (415) 496-4606 Katsuhiko SHIRAI Tohoku University Waseda University Research Center for Applied Department of Electrical Engineering Information Sciences FINANCE Shinjuku-ku, Tokyo, 160 Japan Sendai, 980 Japan Akira KUREMATSU (03) 209-321 1 (0222) 27-6200 KDD R & 0 Laboratories Chiyoda-ku, Tokyo, 100 Japan Ryoichi MATSUDA (03) 211-4321 NTT Electrical Communications U.S. -

POLITICAL ECONOMY Responding to Globalization.Pdf
Responding to Globalization The new challenges and opportunities created by the spread of globalization have reshaped both institutional and individual responses to this phenomenon. This comprehensive analysis of the way in which governments and firms have responded to globalization examines closely the options available to both, and the historical and institutional contexts to the strategic decisions made. Responding to Globalization draws together a panel of international experts in a conceptually rigorous examination of the profound impact of globalization. Subjects covered include: • The international monetary system after the euro • The response of the Japanese software industry to globalization • The dynamics of globalization strategy in South Korea • Australian integration into the global economy • The impact on China and Russia in their move towards a market economy • Institutional transitions in Yugoslavia and Bulgaria • Latin American corporate strategies This rigorous survey focuses on political, ideational and economic factors lying behind these responses to globalization. It is essential reading for all those interested in globalization, international business and international political economy. Aseem Prakash is Assistant Professor, Department of Strategic Management and Public Policy at the School of Business and Public Management; Department of Political Science; The Elliott School of International Affairs, The George Washington University. He is the author of Greening the Firm: The Politics of Corporate Environmentalism and co-editor of both Globalization and Governance and Coping with Globalization. Jeffrey A.Hart is Professor of Political Science at Indiana University, Bloomington. His publications include The New International Economic Order, Rival Capitalists, Globalization and Governance (co-edited with Aseem Prakash) and Coping with Globalization (co-edited with Aseem Prakash). -

High Performance Computing and Networking
High-Performance Computing and Networking for Science September 1989 NTIS order #PB90-131228 Recommended Citation: U.S. Congress, Office of ‘Technology Assessment, High Performance Computing and Networkig for Science-Background Paper, OTA-BP-CIT-59 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, September 1989). Library of Congress Catalog Card Number 89-600758 For sale by the Superintendent of Documents U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402-9325 (Order form can be found in the back of this report.) Foreword Information technology is fundamental to today’s research and development: high performance computers for solving complex problems; high-speed data communication networks for exchanging scientific and engineering information; very large electronic archives for storing scientific and technical data; and new display technologies for visualizing the results of analyses. This background paper explores key issues concerning the Federal role in supporting national high performance computing facilities and in developing a national research and education network. It is the first publication from our assessment, Information Technology and Research, which was requested by the House Committee on Science and Technology and the Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. OTA gratefully acknowledges the contributions of the many experts, within and outside the government, who served as panelists, workshop participants, contractors, reviewers, detailees, and advisers for this document. As with all OTA reports, however, the content is solely the responsibility of OTA and does not necessarily constitute the consensus or endorsement of the advisory panel, workshop participants, or the Technology Assessment Board. - Director . w Performance Computing and Networking for Science Advisory Panel John P.