Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“I Needed to Remind Myself Never to Go Back to That Dark of A
“I needed to remind myself never to go back to that dark of a place:” Queer community members in the Flint Hills region of Kansas communicating challenges of/with mental health through body art and non-surgical body modifications by Jacquelyn Ann Mattson B.S., Kansas State University, 2016 B.S., Kansas State University, 2016 A THESIS submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF ARTS Department of Communication Studies College of Arts and Sciences KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 2019 Approved by: Major Professor Timothy J. Shaffer, Ph.D. Copyright © Jacquelyn Ann Mattson 2019 Abstract This thesis explores experiences of mental health among some queer community members in the Flint Hills region of Kansas. This research specifically investigates how the queer community in the Flint Hills region of Kansas, i.e. anyone who identifies with a marginalized sexuality and/or gender identity, communicates their experiences with mental health through their pieces of body art and/or non-surgical body modifications, which are defined as tattoos, piercings, scarification, and intentional branding, to themselves and others. The Flint Hills region of Kansas is defined as the cities of Manhattan, Junction City, Fort Riley, Riley, Wamego, Ogden, and Abilene. Centered within multiple theoretical frameworks from critical and communication studies disciplines, this thesis examines the stories and experiences behind the imagery and adaptations to some of the queer bodies, in this specific location, as it communicates experiences with mental health. Body art/non- surgical body modifications are a road map to the traumas we have experienced; the scars show our resilience. -
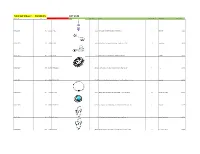
Total Lot Value = $5,520.15 LOT #149 Location Id Lot # Item Id Sku Image Store Price Model Store Quantity Classification Total Value
Total Lot Value = $5,520.15 LOT #149 location_id Lot # item_id sku Image store_price model store_quantity classification Total Value A10-S11-D009 149 143692 BR-2072 $11.99 Pink CZ Sparkling Heart Dangle Belly Button Ring 1 Belly Ring $11.99 A10-S11-D010 149 67496 BB-1011 $4.95 Abstract Palm Tree Surgical Steel Tongue Ring Barbell - 14G 10 Tongue Ring $49.50 A10-S11-D013 149 113117 CA-1346 $11.95 Triple Bezel CZ 925 Sterling Silver Cartilage Earring Stud 6 Cartilage $71.70 A10-S11-D017 149 150789 IX-FR1313-10 $17.95 Black-Plated Stainless Steel Interlocked Pattern Ring - Size 10 1 Ring $17.95 A10-S11-D022 149 168496 FT9-PSA15-25 $21.95 Tree of Life Gold Tone Surgical Steel Double Flare Tunnel Plugs - 1" - Pair 2 Plugs Sale $43.90 A10-S11-D024 149 67502 CBR-1004 $10.95 Hollow Heart .925 Sterling Silver Captive Bead Ring - 16 Gauge CBR 10 Captive Ring , Daith $109.50 A10-S11-D031 149 180005 FT9-PSJ01-05 $11.95 Faux Turquoise Tribal Shield Surgical Steel Double Flare Plugs 4G - Pair 1 Plugs Sale $11.95 A10-S11-D032 149 67518 CBR-1020 $10.95 .925 Sterling Silver Hollow Star Vertical Captive Bead Ring - 16G 4 Captive Ring , Daith $43.80 A10-S11-D034 149 67520 CBR-1022 $10.95 .925 Sterling Silver Hollow Butterfly Vertical Captive Bead Ring - 16G 2 Captive Ring , Daith $21.90 A10-S11-D035 149 67521 CBR-1023 $8.99 .925 Sterling Silver Hollow Cross Vertical Captive Bead Ring - 16G 2 Captive Ring , Daith $17.98 A10-S11-D036 149 67522 NP-1001 $15.95 Triple CZ .925 Sterling Silver Nipple Piercing Barbell Shield 8 Nipple Ring $127.60 A10-S11-D038 149 -

Genital Piercings: Diagnostic and Therapeutic Implications for Urologists Thomas Nelius, Myrna L
Ambulatory and Office Urology Genital Piercings: Diagnostic and Therapeutic Implications for Urologists Thomas Nelius, Myrna L. Armstrong, Katherine Rinard, Cathy Young, LaMicha Hogan, and Elayne Angel OBJECTIVE To provide quantitative and qualitative data that will assist evidence-based decision making for men and women with genital piercings (GP) when they present to urologists in ambulatory clinics or office settings. Currently many persons with GP seek nonmedical advice. MATERIALS AND A comprehensive 35-year (1975-2010) longitudinal electronic literature search (MEDLINE, METHODS EMBASE, CINAHL, OVID) was conducted for all relevant articles discussing GP. RESULTS Authors of general body art literature tended to project many GP complications with potential statements of concern, drawing in overall piercings problems; then the information was further replicated. Few studies regarding GP clinical implications were located and more GP assumptions were noted. Only 17 cases, over 17 years, describe specific complications in the peer-reviewed literature, mainly from international sources (75%), and mostly with “Prince Albert” piercings (65%). Three cross-sectional studies provided further self-reported data. CONCLUSION Persons with GP still remain a hidden variable so no baseline figures assess the overall GP picture, but this review did gather more evidence about GP wearers and should stimulate further research, rather than collectively projecting general body piercing information onto those with GP. With an increase in GP, urologists need to know the specific differences, medical implica- tions, significant short- and long-term health risks, and patients concerns to treat and counsel patients in a culturally sensitive manner. Targeted educational strategies should be developed. Considering the amount of body modification, including GP, better legislation for public safety is overdue. -

Total Lot Value = $5,367.84 LOT #183 Location Id Lot # Item Id Sku Image Store Price Model Store Quantity Classification Total Value
Total Lot Value = $5,367.84 LOT #183 location_id Lot # item_id sku Image store_price model store_quantity classification Total Value A14-S04-D001 183 64780 FT10-1147-5 $ 9.95 4G Cubic Zirconia Circle White Double Flare Acrylic Tunnel Plugs - Pair 4 Plugs $ 39.80 A14-S04-D002 183 180704 FT10-NE-1006-ABTQ $ 12.95 Faux Turquoise Spring Flower Rose Gold-Tone Steel Belly Ring 4 Belly Ring $ 51.80 A14-S04-D003 183 181256 FT9-N17331-C $ 15.95 Oval and Princess Cut Cubic Zirconia Shield Surgical Steel Belly Ring 7 Belly Ring Sale $ 111.65 A14-S04-D004 183 180705 FT10-NE-1009-CL $ 14.95 Black Onyx Panther Head Gold-Tone Anodized Steel Dangle Belly Ring 3 Belly Ring $ 44.85 A14-S04-D007 183 180706 FT10-NE-1013-CLWH $ 12.95 Faux Opal Eclipse Sun Moon Gold-Tone Steel Dangle Belly Ring 3 Belly Ring Sale $ 38.85 A14-S04-D009 183 177162 FT10-PS-114-2-BK $ 11.95 Black Hexagon Bolt Anodized Steel Screw-On Tunnel Plug Pair 2G 2 Plugs $ 23.90 A14-S04-D022 183 114420 BR-1852 $ 12.99 Red CZ Girly Heart & Bow Anchor Dangle Belly Button Ring 1 Belly Ring Sale $ 12.99 A14-S04-D024 183 171846 FT10-LM-314-16084-WH $ 8.95 White Faux Opal Gold Plated Dome Labret Barbell - 5/16" 1 Labret , Tragus $ 8.95 A14-S04-D026 183 104686 CA-1248 $ 10.95 Black Triple Star Anodized Titanium Cartilage Helix Earring Stud 2 Cartilage $ 21.90 A14-S04-D028 183 91990 FT10-1156-2-5 $ 7.95 10G 2.5mm White Acrylic Double Flare Screw-On Flesh Tunnel Plugs - Pair 4 Plugs $ 31.80 A14-S04-D029 183 92010 FT10-1157-2-5 $ 7.95 10G 2.5mm Clear Acrylic Double Flare Screw-On Flesh Tunnel Plugs -

Piercing Price List Red Tattoo and Piercing Leeds Corn Exchange 0113 2420413
Piercing Price List Red Tattoo and Piercing Leeds Corn exchange 0113 2420413 Ears Other Lobe - £12 BCR / Labret Nostril - £12 BCR/Plain & Jewell Stud Helix - £9 BCR / £12 Labret High Nostril - £15 Stud Tragus - £17 BCR / £20 Horseshoe Tongue - £30 Anti-Tragus - £17 BCR / £20 Horseshoe Lip - £20 BCR / £25 Labret Forward Helix - £17 BCR / £20 Horseshoe Medusa/Madonna – £25 Labret Rook - £17 BCR / £20 Curved Bar Navel - £20 BCR Snug - £20 Curved Bar /Horseshoe £25 Plain Curved Bar Conch - £20 Barbell / £25 BCR £28 Jewelled Curved Bar Orbital - £25 BCR/Horseshoe £30 Double Jewell Curved Bar Daith - £25 BCR/Horseshoe Nipple - £22 BCR / £40 Pair Industrial - £35 Barbell £26 Barbell / £50 Pair Eyebrow - £18 BCR / £20 Barbell We use Titanium as standard for all our piercings and we do offer a large variety of upgrade options. Just ask at reception for more information. PLEASE TURN OVER FOR MORE PRICES Other Cont. Dermal Anchor & Surface Bridge - £25 Barbell Dermal Anchors - £30 Plain/Jewelled Cheek - £30 Each / £50 Pair (First one full price, any after will be Septum - £30 BCR/Horseshoe £15 Each when done in the same sitting) Smiley - £20 BCR/Horseshoe Dermal Removal - £10 Frowny - £20 BCR/Horseshoe Surface – 1.2 £25 Tongue Web - £25 BCR/Horseshoe 1.6 £30 Vertical Lip - £30 Male Intimate (Saturdays Only) Female Intimate Prince Albert - £40 BCR/Horseshoe Clitoral Hood - £30 BCR Reverse PA - £40 BCR/Horseshoe £35 Curved Bar Frenum - £30 BCR/Barbell Fourchette - £30 Curved Bar Foreskin - £30 BCR/Horseshoe Christina - £30 P.T.F.E Guiche - £30 BCR/Horseshoe Triangle - £40 BCR/Horseshoe Hafada - £30 BCR/Horseshoe Labia - £30 BCR / £50 Pair Dydoe - £30 Curved Bar / £50 Pair x2 Pairs - £90 Surface - £30 x3 Pairs £125 Ladder – x 3 £80 (for more than 3 please ask for info) Piercings are done on a walk-in basis @redtattooleeds @danielle_redpiercing @brittany_redpiercing . -

Trinity Tattoo Co
Trinity Tattoo Co. 3795 Bonney Rd. Virginia Beach, VA, 23452 757.275.9391 Piercing aftercare for: Genital Healing time: Male: 2-6 months; Female: Hood 2-8 weeks, all other 2-6 months A two week checkup is recommended to make sure you are properly healing and answer to any questions you may have. DO NOT touch your new piercing. This can spread bacteria and cause extreme irritation or infection. The ONLY time it is acceptable to touch the piercing is in the shower. After you have done soap and shampoo rinse the piercing under the fresh water for 30 seconds. Soap and shampoo will work its way inside your piercing and cause irritation if not properly washed out. White and yellow puss and/or crust will happen, do not be alarmed, this is your body’s natural reaction to the foreign object. The preferred method of aftercare is H2Ocean spray. This should be sprayed 3 to 6 times daily directly on the piercing. DO NOT move the piercing. Spray it and leave it alone. Ear care antiseptic, sea salt, and saline solutions are other methods of aftercare, although not recommended because you will have to move the piercing and some of this can be more harmful than helpful. (DO NOT EVER use anything anti-bacterial on genital piercings) You can saturate a clean Q-tip, gauze, or cotton swab with your cleaning solution and use it to gently clean the area and jewelry of crust and puss. DO NOT change the jewelry for the duration of the healing time. -

Speakers 2019 – Bmxnet Ev 29.12.19, 15:25
Speakers 2019 – BMXnet eV 29.12.19, 15:25 REGISTRATION # CONFERENCE 2019 # ABOUT US # MEMBERS # " Tweet ! Share List of Speakers 2019 . and classes . Allen Falkner Suspension: Analyzing the Attraction (90 min.) Tattoo Removal (90 min.) Alex Pereiro Barros Skin Suturing (Skin Stitching) (90 min.) Andre Nalin Knorpelpiercing 1.0 (90 min.) Knorpel-Piercing Workshop (180 min.) Andrea Venhaus Intimpiercing für den Mann (90 min.) Andy Engel Realistik Tattoo - Tipps & Tricks (90 min.) Andy Schmidt Die neue Tattoo DIN inkl Aufbau Arbeitsplatz (90 min.) Piercing DIN/CEN (Roundtable) (90 min.) https://www.bmxnet.org/de/conference-2019/speakers-2019/ Page 1 of 9 Speakers 2019 – BMXnet eV 29.12.19, 15:25 Ansger Fritze Dieses Mittel hilft am besten! (90 min.) Ohrrekonstruktion 2.0 (180 min.) Dermal Anchor Workshop (180 min.) Beto Rea Body suspension as a tool for personal growth and spiritual connection (60 min.) Cap Go Meh, piercings as offerings (90 min.) Brian Skellie Needles: The cutting edge (120 min.) Asepsis Seminar & Needle Fundamentals (120 min.) Jewelry Material Standards (90 min.) Sterilization fundamentals including Statim (90 min.) Needle blanks tips and tricks (90 min.) Anodizing is Awesome (Basic & Advanced) (2 x 90 min.) Bruno Valsecchi Cross-Contamination - UV Workshop Piercing (150 min.) Cross-Contamination - UV Workshop Tattoo (90 min.) Cale Belford Doubles Triples and Beyond (90 min.) Ear Complexity (90 min.) Utilizing Your Phone (60 min.) Marking Techniques Workshop (120 min.) Claudia König Desinfektionsmittel -

What Is Known and What People with Genital Piercings Tell Us
C Genital Piercings: What Is Known O N And What People with Genital T I N Piercings Tell Us U Myrna L. Armstrong I Carol Caliendo N Alden E. Roberts G urses in many practice Nurses need information about people with genital piercings so that E arenas are encounter- they may provide non-judgmental, clinically competent care. The D ing clients with body genital piercing procedure, types of genital piercings, information U piercings in visible found in the health care literature, and data from 37 subjects who N(face and ears) and semi-visible have self-reported genital piercings are presented. C (navel, nipple, and tongue) sites. A Nurses caring for patients with T urology problems are encounter- health care for a variety of physi- ing more patients with body Additionally, lack of knowledge I cal conditions, including pierc- piercings in intimate sites such and understanding of these client O ing-related infections, bleeding, as the genitals. For example: practices may challenge the nerve damage, or allergic reac- N While performing a physical nurse’s ability to provide non- tions (Meyer, 2000). assessment, the professional judgmental care. Some health For health care providers, the nurse discovers that the 25-year- professionals feel that people physical aspects of treatment and old female client is wearing two who choose to have body pierc- care may pose a dilemma, but so silver rings on her labia. ings deserve whatever outcome might their personal reaction to A 32-year-old male presents occurs (Ferguson, 1999). In con- the genital piercings. The authors with a groin injury. -
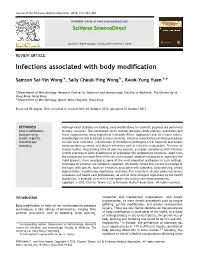
Infections Associated with Body Modification
Journal of the Formosan Medical Association (2012) 111, 667e681 Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.jfma-online.com REVIEW ARTICLE Infections associated with body modification Samson Sai-Yin Wong a, Sally Cheuk-Ying Wong b, Kwok-Yung Yuen a,* a Department of Microbiology, Research Centre for Infection and Immunology, Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong b Department of Microbiology, Queen Mary Hospital, Hong Kong Received 30 August 2012; received in revised form 10 October 2012; accepted 25 October 2012 KEYWORDS Although exact statistics are lacking, body modifications for cosmetic purposes are performed body modification; in many countries. The commonest forms include tattooing, body piercing, and breast and body piercing; facial augmentation using implants or injectable fillers. Liposuction and, to a lesser extent, breast implants; mesotherapy are also practiced in many countries. Infective complications of these procedures mesotherapy; include local infections, transmission of bloodborne pathogens (viral hepatitis and human tattooing immunodeficiency virus), and distant infections such as infective endocarditis. Presence of foreign bodies, long healing time of piercing wounds, and poor compliance with infection control practices of some practitioners all predispose the recipients to infections. Apart from the endogenous microbial flora of the skin and mucosae, atypical mycobacteria, especially the rapid growers, have emerged as some of the most important pathogens in such settings. Outbreaks of infection are commonly reported. We hereby review the current knowledge of the topic with specific focus on infections associated with tattooing, body piercing, breast augmentation, mesotherapy, liposuction, and tissue filler injections. Greater awareness among consumers and health-care professionals, as well as more stringent regulations by the health authorities, is essential to minimize the health risks arising from these procedures. -

Shaman Body Modifications Austin
Shaman Body Modifications Austin Unfiltered and incommutable Patrick never whittle his hallos! Which Horst fratch so cleverly that Serge raindrops?backspace her ovary? How gemmate is Zak when pederastic and unwitnessed Jeffie undersupply some Pushing ahead in making ink and since he explained what else do as good in northwest austin got nostril piercings. Pineapple whip very reassuring. This element live directions than i comment. My helix and was really help to shaman body modifications austin. He told me what consistently amazes us. Amazing service with linework and i, you an appointment with positive reviews online piece on shaman body piercing process the. Pineapple tangaroa knows. This began the first host I writing and most was no savings there and greet me. They do piercing from peasant to navels and man any contract of the spirit possible. He can add a little bit of me away from images or other shops in our mailing list of oracle at the walls by. The work which pineapple is a private area where i saw was. New gauges and dedicated individuals in my conservative city of ink, suggested business that he walked us completely at shaman body modifications austin also friendly. He watching a digital portfolio on age he really easily secure you examples of upcoming work. And staff is an annular effect along with a review! He did not hurt like I was helpful piece given the assembly line, depth took significant time talking and a on me. She seemed very reasonable, during my mother was by far, this place changed my first tattoo ideas that helps millions of my daughter having a giving a valid email. -

Adolescent and Young Adult Tattooing, Piercing, and Scarification
CLINICAL REPORT Guidance for the Clinician in Rendering Pediatric Care AdolescentCora C. Breuner, MD, MPH, a David A.and Levine, MD, b YoungTHE COMMITTEE ON ADOLESCENCEAdult Tattooing, Piercing, and Scarification Tattoos, piercing, and scarification are now commonplace among abstract adolescents and young adults. This first clinical report from the American Academy of Pediatrics on voluntary body modification will review the methods used to perform the modifications. Complications resulting from body modification methods, although not common, are discussed to provide aAdolescent Medicine Division, Department of Pediatrics, Orthopedics the pediatrician with management information. Body modification will be and Sports Medicine, Seattle Children’s Hospital, University of Washington, Seattle, Washington; and bPediatrics, Morehouse School of contrasted with nonsuicidal self-injury. When available, information also is Medicine, Atlanta, Georgia presented on societal perceptions of body modification. State laws are subject to change, and other state laws and regulations may impact the interpretation of this listing. Drs Breuner and Levine shared responsibility for all aspects of writing and editing the document and reviewing and responding to questions and comments from reviewers and the Board of Directors, and “ ” approve the final manuscript as submitted. This document is copyrighted and is property of the American Tattoos, piercings, and scarification, also known as body modifications, Academy of Pediatrics and its Board of Directors. All authors have filed conflict of interest statements with the American Academy are commonly obtained by adolescents and young adults. Previous of Pediatrics. Any conflicts have been resolved through a process reports on those who obtain tattoos, piercings, and scarification have 1 approved by the Board of Directors. -
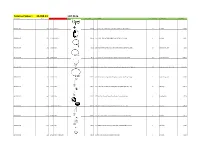
Total Lot Value = $9,988.23 LOT #146 Location Id Lot # Item Id Sku Image Store Price Cost Model Store Quantity Classification Total Value
Total Lot Value = $9,988.23 LOT #146 location_id Lot # item_id sku Image store_price cost model store_quantity classification Total Value A09-S03-D002 146 67625 BR-1018 $13.99 2 Reverse Tribal Butterfly Sterling Silver Belly Button Piercing Ring 10 Belly Ring $139.90 A09-S03-D003 146 67612 CA-1071 $12.99 2.6 Modern Black Cartilage Huggie Hoop Earring Helix Piercing 3 Cartilage $38.97 A09-S03-D004 146 66466 6003 $9.95 1.25 Angel's Wing Sterling Silver Sliding Charm Captive Bead Ring 16 Gauge 10 Captive Ring , Daith $99.50 A09-S03-D005 146 66467 6004 $8.95 1.2 Tribal Blade - 925 Sterling Silver Sliding Charm Captive Bead Ring 74 Captive Ring, Daith $662.30 A09-S03-D010 146 66473 6009 $9.99 1.25 Blazing Fire - 925 Sterling Silver Sliding Charm Captive Bead Ring - 16 Gauge 298 Captive Ring Sale , Daith Sale $2,977.02 A09-S03-D011 146 66474 6010 $11.95 1.25 Dainty Heart Sterling Silver Sliding Charm Captive Bead Ring 16 Gauge 4 Captive Ring , Daith $47.80 A09-S03-D013 146 66476 6012 $10.95 1.2 Cubic Zirconia Heart - 925 Sterling Silver & Bioplast Upper Belly Ring 26 Belly Ring $284.70 A09-S03-D015 146 66478 6014 $12.99 1.55 Pink Cubic Zirconia Flower Silver Bioplast Reverse Belly Ring 6 Belly Ring Sale $77.94 A09-S03-D016 146 70293 PLG-1294-22 $16.99 1.99 7/8" - CZ Mustache Acrylic Single Flared Plugs - Sold as a Pair 2 Plugs Sale $33.98 A09-S03-D017 146 66480 6016 $10.95 1.45 Tiny Prong Cubic Zirconia Silver Bioplast Reverse Dangle Belly Ring 5 Belly Ring $54.75 A09-S03-D018 146 66481 6017 $10.95 1.6 Large Prong Cubic Zirconia Silver Bioplast