Hans Johansen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INGLE-NOOK STABLES STEERING RADIOS, RADIO-PHONOGRAPHS Woodbridge Ave., Avenel, N
.,y?.x •*"• -.-""• RARITAK >_ • MOST PROGRESSIVE AND TOWNSHIP WITH THE SUBURBAN NEWSPAPER LARGEST IN GUARANTEED THIS AREA CIRCULATION "TKe Voice of the Raritan Bay District VOL. VI.—No. 5 FORDS, N. J., FRIDAY, APRIL 25, 1941 PRICE THREE GENTS LIONS' CLUB FIRE TRUCK RARITAN TO FIGHT BAN ACTIVITIES CHASERS HITTOWN ACTS TO SET UP ON WOODBRIDGE HIGHWIN PRAISE BY SWALESHOME DEFENSE FORCES B. Of E. Plan To Send 100 Sports Program To Follow Parade Civic Program Is Lauded Chief Launches Attack On Termites Gnawing Up Fords Home; 120 Men Over 30 To Be In- Pupils There This Year By District Governor Motorists Who Try To ducted As Volunteer Win Race To Blaze Target Of Lowery Memorial Day Services In Raritan At Session Tuesday Township Sought As Exterminator Auxiliary Police Annual May 30 Activities To Take Place On Commons ORDERS MEN TO TAKE Michael Elko Claims Avaricious Bugs Have Habitat DECLARES FACILITIES In Piscatawaytown; Dancing Also To Be Featured BOWLING TEAM GIVEN OFFENDERS' NUMBERS In Nearby Swamp Which Bailey Promised To Fill MAYOR ISSUES ORDERS ARE NOT SUFFICIENT PISCATAWAYTOWN—Tentative arrangements for COUNTY LOOP TROPHY WOODBRIDGE—In case the Township Committee IN LINE WITH N. J, LA! a program of activitiea on Memorial Day, including the an- Perth Amboy Driver First didn't have enough to worry about in regard to com- County Superintendent De- nual parade and memorial services, were announced yes- Plans Launched For Hold- To Feel Sting Of Drive; plaints about road conditions it has a new type of com- Need Of Keeping High- terday by the special committee of Raritan Engine Com- plaint to contend with in Fords. -

Iliiieiican%Mlsellm
Iliiieiican%Mlsellm PUBLISHED BY THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST AT 79TH STREET, NEW YORK 24, N.Y. NUMBER 1752 DECEMBER 28, 1955 Systematic Notes on Palearctic Birds. No. 17 Laniidae BY CHARLES VAURIE The following notes were made during a study of the present family for a proposed check list of the Palearctic region. Nine of the 14 species that occur in this region, or some of their races, are discussed: Lanius bucephalus, L. collurio, L. senator, L. vittatus (in which a new sub- species is described), L. schach, L. tephronotus, L. minor, L. excubitor, and Tchagra senegala. I am indebted and would like to express my ap- preciation to Mr. J. C. Greenway, Jr., of the Museum of Comparative Zoology for the loan of a critical type, and to Dr. D. Amadon for reading and criticizing the manuscript. Lanius bucephalus Bangs and Peters described a new race of this species from south- western Kansu in 1928 which they called salicarius. The new race is based on a single specimen and no additional one has apparently been collected or reported since. Through the courtesy of Mr. J. C. Greenway, Jr., I have been able to examine this specimen, which is an adult female in worn plumage collected in May. It represents a very distinct race dif- fering from female nominate bucephalus of which 30 specimens were examined by being, as stated by Bangs and Peters, much more exten- sively barred below, with the individual bars broader and blacker. The other differences cited by the authors of salicarius require comment. -

Consistency, Efficiency and Transparency in Investment Treaty Arbitration Report 2018 1 Preface1
DRAFT Consistency, efficiency and Consistency,Consistency,Consistency, efficiency andandand transparencytransparencytransparencytransparency ininin investmentinvestmentinvestmentinvestment treatytreatytreatytreaty arbitration arbitrationarbitrationarbitration OctoberOctober 20182018 OctoberNovember 2018 2018 A report by the IBA Arbitration Subcommittee on Investment Treaty Arbitration A report by the IBA Arbitration Subcommittee on Investment Treaty Arbitration AA report report by by the the IBA IBA ArbitrationArbitration SubcommitteeSubcommittee on InvestmentInvestment TreatyTreaty ArbitrationArbitration This is a draft version of the report. A final version, to undergo the full editorial process, will be published on the IBA Arbitration Committee’s project webpages in due course. Contents Preface 2 Summary of the 2016 Subcommittee report 3 Chapter 1: Consistency in investor-state arbitration 6 A solution to the status quo 7 An overhaul of the system? 23 Chapter 2: Efficiency in investor-state arbitration 36 Efficiency challenges before constitution of the tribunal (including settlement and alternative dispute resolution) 36 Efficiency challenges after constitution of the tribunal 49 Chapter 3: Transparency in international investment arbitration 53 Publication of arbitral awards, broadcasting of hearings and document production 54 Conclusion 64 Consistency, efficiency and transparency in investment treaty arbitration report 2018 1 Preface1 In 2014, the International Bar Association (IBA) Subcommittee on Investment Treaty Arbitration -

The Migration of the European Redshanks (Tringa Totanus (L.)). by FINN SALOMONSEN
94 The Migration of the European Redshanks (Tringa totanus (L.)). By FINN SALOMONSEN. (Med et dansk resume: De europæiske Rødbens (Tringa totanus (L.)) trækforhold.) The movements of the Redshank are rather well-known in Europe, where this species almost everywhere is a quite com mon bird. Recent ringing in Scandinavia, however, has revealed some new and interesting facts. The conclusions drawn in this paper are mainly based on the considerable number of recov eries of Scandinavian Redshanks. There are no less than 154 recoveries abroad of Redshanks ringed in Denmark. The cor responding figures for Sweden and N orway are 53 and 8, respectively. In most other countries ringing of Redshank has been carried out on a modest scale only. I am indebted to Dr. HANS JOHANSEN, Zool. Museum, Copenhagen, for giving me access to the ringing records of the Danish Redshanks not yet published, and to Dr. G. C. A. JUNGE, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, to Prof. Dr. R. DROST, Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven, and to Dr. H. HoLGERSEN, Stavanger Museum for various information about recoveries of Dutch, German and Norwegian Redshanks, respectively. I also wish to thank Mr. ERIK PETER SEN for carefully drawing the maps in this paper. The Danish Population. The Danish breeding stock leaves the country very early in the autumn, the adult as a rule in the latter half of July, the young birds usually not until August. Redshanks can be seen in small numbers until mid-September, but these birds are probably passage-migrants, coming from further north. Later in the autumn Redshanks are only exceptionally met with in Denmark, apart from Iceland birds (cf. -

1Oxfltate PUBLISHED by the AMERICAN MUSEUM of NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST at 79TH STREET, NEW YORK 24, N.Y
1oxfltate PUBLISHED BY THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST AT 79TH STREET, NEW YORK 24, N.Y. NUMBER 2042 JULY 7, I96I Systematic Notes on Palearctic Birds. No. 47 Accipitridae: The Genus Buteo BY CHARLES VAURIE The present paper completes my notes on the family Accipitridae. I wish to express my appreciation to Dr. J. P. Chapin, Dr. H. Johansen, and Mr. M. A. Traylor with whom I have discussed some of my material. Dr. Chapin has helped me with some African forms; Dr. Johansen, with the Siberian ones, especially Buteo lagopus. I am indebted also to Dr. A. L. Rand and Mr. M. A. Traylor for lending me specimens from the collection of the Chicago Natural History Museum. THE GENUS BUTEO Four species inhabit the Palearctic region (rufinus, hemilasius, buteo, and lagopus). Their breeding ranges are shown in figure 1, the range of lagopus extending also to northern North America. The other three are restricted to the Palearctic, as I cannot agree with Hartert (1925) or other authors that oreophilus of eastern and southern Africa and brachyurus of Madagascar are conspecific with B. buteo. In oreophilus, the dark markings on the under parts and "thighs" are more or less tear-shaped, and this pattern is quite different from that of buteo, in which the under parts are streaked, splotched, or irregularly barred. Furthermore, the two birds have dif- ferent proportions. The tail is shorter in oreophilus, about 49 per cent of the length of the wing, as against about 55 in buteo. This difference may seem slight but actually is very noticeable in comparable and well-made skins. -

2020 Directory of Members
2020 Directory of Members 600 Offices 100+ Countries 21,000 Lawyers 160 Premier Member Firms Lex Mundi – the law firms that know your markets. 2020 Directory of Members Table of Contents Your Global Service Platform 3 Recent Cross-Border Transactions 6 Our Leadership 8 Our Client Advisory Council 9 Our World Ready Member Firms 10 Listing by Region 11 Contacts by Jurisdiction 15 Membership Criteria 114 Service Standards 115 Free Advice Policy 117 Membership Review 120 Lex Mundi Pro Bono Foundation 121 Practice Group and Committee Overview 122 Conference Calendar 123 Staff Contact Information 124 Lex Mundi Sponsors 126 2 | Lex Mundi – The law firms that know your markets. Your Global Service Platform One Global Service Platform. Endless Integrated Client Solutions. Lex Mundi brings together the collaboration, knowledge and resources of 160 rigorously vetted, top-tier law firms in 100+ countries. Supported by client-focused methods, innovative technologies, joint learning and training, member law firms collaborate seamlessly across borders, industries and markets to help clients manage complex cross-border legal risks, issues and opportunities. Through the Lex Mundi global service platform, member firms are able to deliver integrated and efficient solutions focused on real business results for clients. Indigenous Insight. Innovative Solutions. Smart Resourcing. Our member firms are territory experts and leaders in their jurisdictions. Each has broad knowledge and understanding of their respective markets – how those markets were developed, their peculiarities, their drivers and their rules and regulations. Through close collaboration, Lex Mundi member firms deliver new perspectives, fresh thinking and rigorous questioning that are key to innovation in today’s markets. -
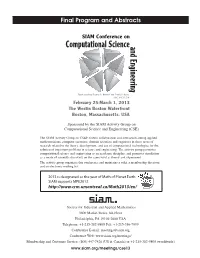
SIAM Conference on Computational Science and Engineering
Final Program and Abstracts Sponsored by the SIAM Activity Group on Computational Science and Engineering (CSE) The SIAM Activity Group on CS&E fosters collaboration and interaction among applied mathematicians, computer scientists, domain scientists and engineers in those areas of research related to the theory, development, and use of computational technologies for the solution of important problems in science and engineering. The activity group promotes computational science and engineering as an academic discipline and promotes simulation as a mode of scientific discovery on the same level as theory and experiment. The activity group organizes this conference and maintains a wiki, a membership directory, and an electronic mailing list. Society for Industrial and Applied Mathematics 3600 Market Street, 6th Floor Philadelphia, PA 19104-2688 USA Telephone: +1-215-382-9800 Fax: +1-215-386-7999 Conference E-mail: [email protected] Conference Web: www.siam.org/meetings/ Membership and Customer Service: (800) 447-7426 (US & Canada) or +1-215-382-9800 (worldwide) www.siam.org/meetings/cse13 2 2013 SIAM Conference on Computational Science and Engineering Table of Contents The SIAM registration desk is located Corporate Members on the Concourse Level. It is open and Affiliates during the following hours: Program-at-a-Glance ......Fold out section SIAM corporate members provide General Information ...............................2 Sunday, February 24 their employees with knowledge about, Get-togethers ..........................................4 4:00 PM - 8:00 PM access to, and contacts in the applied Invited Plenary Presentations ...............6 Monday, February 25 mathematics and computational sciences Poster Session ......................................60 community through their membership 7:00 AM - 5:00 PM benefits. -

Energy Research Within the Forest Industry in Sweden and Finland. Update for the Period 1996-2000
Skogsindustriell energiforskning i Sverige och Finland Uppdatering av f orskningslaget 1996-2000 HansNorrstrom, Mikael Ahlroth, Mats Nordgren AF-IPK AB S9-814 VARMEFORSK Service AB 10153 STOCKHOLM • Tel 08-677 25 80 Februari 2001 ISSN 0282-3772 DISCLAIMER Portions of this document may be illegible in electronic image products. Images are produced from the best available original document. VARMEFORSK Forord AF vill rikta ett varmt tack till alia dem vid myndigheter, forskningsinstitut, universitet, hogskolor och fdretag som lanrnat de uppgifter som bildar kaman i rapporten. Vi vill vidare rikta ett varmt tack till styrgmppen som med start intresse och sakkunskap lett arbetet Stockholm januari 2001 Tv7 vA rmeforsk Abstract This report is a summary of the energy research conducted in Sweden and Finland during the years 1996-2000 with relevance to the forest industry. The main research topics are gasification of biomass, waste products and black liquor, combustion in fluidized beds and drying technology. Another recent topic is system studies from a national perspective to investigate the long term impact of various factors relevant to the industry like recycled paper and COa-mitigation. ♦ VARMEFORSK Sammanfattning AF sammanstallde 1997 en rapport om laget betraffande skogsindustriell energi forskning pa uppdrag av Varmeforsks Skogsindustriella grapp. Foreliggande studie ar en uppdatering av delta arbete for samma uppdragsgivare. Rapportens syfte ar att ge en oversikt av det radande laget pa forskningsomradet i dagslaget samt att forsoka bedoma uppnadda resultat och ge fbrslag for framtida atgarder. Styrgrupp for arbetet bar varit Varmeforsks skogsindustriella kommitte med Rolf Edlund, StoraEnso Technical Support, som ordforande. Statusrapporten omfattar de energiprojekt med inriktning mot skogsindustriella ffagor vid svenska och finska institutioner, hogskolor och industriforetag som pagick respektive som avrapporterats inom perioden 1996-2000. -
Alpine Swift
Notes Alpine Swift 'playing' with piece of paper At 10.00 GMT on 20th June 1985, in sunny conditions with little wind at Les Baux, France, I watched several Alpine Swifts Apus melba with Swifts A. apus feeding 100-200 m up in the vicinity of the old village. One of the Alpine Swifts darted after what appeared to be a piece of white paper, a little larger than the head of a Swift, floating in the air; three times in a period of two minutes, it grasped the paper in its bill and flew with it for several metres, before releasing it and diving to catch it again. I can find no reference to 'play' behaviour by the Alpine Swift. JONATHAN H. MERCER Torridon, 79 Alexander Drive, Cirencester, Gloucestershire GL71UQ This appears to have been nest-collecting behaviour, or perhaps feeding behaviour by a bird which was, to judge from its repeating its mistake, 'slow to learn'. EDS Behaviour of Swallows with feather At 09.00 GMT on 8th August 1985, near Ipswich, Suffolk, I watched a juvenile Swallow Hirundo rustica swoop and catch in mid air a white object. It then dropped the object, and through binoculars I could see that it was a white feather. A second juvenile Swallow swooped and caught the feather, and flew with it for a few seconds before releasing it. The feather was then caught by a third juvenile. The whole 'game' was repeated in this fashion for about one minute, during which time each Swallow caught and released the feather about five times. -

A Diversificação Das Relações Comerciais De
The diversification of Portugal’s commercial relations in the late eighteenth century: between discourse and praxis. Miguel Dantas da Cruz1 Abstract The diversification of trading partners marked the context of Portugal’s economic relations with the outside world in the late eighteenth and nineteenth centuries. This had also been a frequent argument put forward in the organized discourse of Portuguese economic thought throughout the eighteenth century. Without claiming to be exhaustive, this article examines the testimonies of some of the eighteenth- century authors who reflected at greater length on the advantages of diversifying trading partners. After this, an analysis is made of some of the more distinctive manifestations of this experience, essentially related to the marked changes that took place in the shipping sector and the readjustments in the economic importance of trading partners. Keywords diversification of trading partners, foreign trade, shipping, economic thought, port of Lisbon, Baltic. Resumo A diversificação de parceiros comerciais marcou o quadro das relações económicas de Portugal com o exterior no final de Setecentos e princípios de Oitocentos. Esse havia sido também um argumento frequente no discurso organizado do pensamento económico português ao longo do século 18. Sem pretender ser exaustivo, o texto aborda os testemunhos de alguns dos autores setecentistas que reflectiram mais longamente sobre as vantagens da diversificação de parceiros. De seguida são exploradas as manifestações mais distintivas desta experiência de diversificação, essencialmente relacionadas com mudanças pronunciadas no sector da navegação e com reajustamentos no peso económico dos parceiros. Palavras-chave Diversificação de parceiros comerciais, comércio externo, navegação, pensamento económico, porto de Lisboa, Báltico. -

RECENT LITERATURE Reviews by Donald S
Vol. 1946XVII RecentLiterature [79 35-204712,banded at Sutherland,Iowa, September26, 1935,,by GustavJ. Schultz, was found dead November 1, 1935, at Newell, Iowa, about 35 miles away. A293311, banded at Sioux City, Iowa, December24, 1931, by Mrs. Marie Dales, was found dead May 11, 1932, about 80 miles away, at Santee,Nebraska. B270818, banded as an innnature, at Battle Creek, Michigan, October 23, 1933, by L. C. Nielsen, was captured by hand in the early morning of December 14, 1933, by Dr. J. Van Tyne, ,at Ann Arbor, about 85 miles distance. The bird seemedto be sufferingfrom cold but was releasedin goodcondition two hourslater. 39-247157,banded as an immature, at Chevy Chase, Maryland, August 20, 1943, by A. E. Clattenburg,Jr., was found,slightly injured November2, 1943,at R•anks, Lancaster County, Pennsylvania,a flight of about 85 miles. 36-120378,banded at Raleigh,North Carolina,May 29, 1938, by J. L. Primrose, was found dead December26, 1939, at Winston-Salem,North Carolina, about 95 miles away. 41-202287, banded at Elberton, Elbert Co., Georgia, April 4, 1944, ,by P. B. Smith, was "found" January 18, 1945, about 105 miles north in Dickinson County, Virginia, 3 miles north of Herald. 37-231808, banded at Iowa City, Iowa, April 18, 1940, by C. G. Danforth, was killed by a train at Des Moines, Iowa, 110 miles distant. 35-208878, banded at Memphis, Tennessee,February 18, 1936, by Mrs. G. W. Govert, was killed about November 25, 1936, 145 miles away, 3 miles north of Russellville, Alabama. 37-237826, banded at Takoma Park, Maryland, March 10, 1939, by L. -

MIGRATIONAL DRIFT and the YELLOW WAGTAIL COMPLEX by KENNETH WILLIAMSON (Fair Isle Bird Observatory)
MIGRATIONAL DRIFT AND THE YELLOW WAGTAIL COMPLEX BY KENNETH WILLIAMSON (Fair Isle Bird Observatory) INTRODUCTION FROM time to time grey-headed yellow wagtails which appear to be identical with Sykes's Wagtail (Motacilla flava beema) of western Siberia have been observed or captured in the British Isles. The frequency of their appearance has puzzled ornitholo gists and in the absence of a more satisfactory explanation of their origin they are now generally regarded as aberrant examples of the typical race, the Blue-headed Wagtail (Motacilla f. flava) of middle Europe, or even of the British Yellow Wagtail flavissima. The current view is reflected in the decision of the late British Ornithologists' Union List Sub-Committee to consider such speci mens as belonging to the race flava (Ibis, vol. 92, pp. 140-141) so that in consequence beema has failed to find a place in the Check list of birds of Great Britain and Ireland (1952). The fashion of regarding such birds as variants or mutants of flava, whilst it owes its origin to the work of Stresemann (1926), received a great impetus as a result of the policy of the Editors of The Handbook of British Birds (1941, vol 1, p. 215) and of the journal British Birds in the treatment of such records from 1935 onwards (see editorial note, antea, vol. xxix, p. 200). So far as this country is concerned, the seal of authority was placed on this theory by the writings of Harrison (1945), Tucker (1949) and Smith (1950). Stresemann's view is that mutants arise in the various yellow wagtail populations showing extraordinary con vergences, so that birds very like each other may be found in widely-separated breeding-areas.