FONTES 61 Vogtherr Heilmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unequal Lovers: a Study of Unequal Couples in Northern Art
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Faculty Publications and Creative Activity, School of Art, Art History and Design Art, Art History and Design, School of 1978 Unequal Lovers: A Study of Unequal Couples in Northern Art Alison G. Stewart University of Nebraska-Lincoln, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/artfacpub Part of the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Stewart, Alison G., "Unequal Lovers: A Study of Unequal Couples in Northern Art" (1978). Faculty Publications and Creative Activity, School of Art, Art History and Design. 19. https://digitalcommons.unl.edu/artfacpub/19 This Article is brought to you for free and open access by the Art, Art History and Design, School of at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications and Creative Activity, School of Art, Art History and Design by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. Unequal Lovers Unequal Lovers A Study of Unequal Couples in Northern Art A1ison G. Stewart ABARIS BOOKS- NEW YORK Copyright 1977 by Walter L. Strauss International Standard Book Number 0-913870-44-7 Library of Congress Card Number 77-086221 First published 1978 by Abaris Books, Inc. 24 West 40th Street, New York, New York 10018 Printed in the United States of America This book is sold subject to the condition that no portion shall be reproduced in any form or by any means, and that it shall not, by way of trade, be lent, resold, hired out, or otherwise disposed of without the publisher's consent, in any form of binding or cover other than that in which it is published. -

Article (Published Version)
Article Knowe Thyself. Anatomical figures in Early Modern Europe CARLINO, Andrea Reference CARLINO, Andrea. Knowe Thyself. Anatomical figures in Early Modern Europe. RES : Journal of Anthropology and Aesthetics, 1995, vol. 27, p. 52-69 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43016 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 The President and Fellows of Harvard College Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Knowe Thyself: Anatomical Figures in Early Modern Europe Author(s): Andrea Carlino Reviewed work(s): Source: RES: Anthropology and Aesthetics, No. 27 (Spring, 1995), pp. 52-69 Published by: The President and Fellows of Harvard College acting through the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20166917 . Accessed: 05/02/2012 05:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The President and Fellows of Harvard College, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, J. Paul Getty Trust are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to RES: Anthropology and Aesthetics. http://www.jstor.org 52 RES27 SPRING1995 Figure 1. Anatomical Fugitive Sheet (woman), 1662. Jobst de Negker (printer), Augsburg. Photo: Courtesy of Karl Sudhoff Institut, University of Leipzig. -

The Fall of the Blind Leading the Blind by Pieter Bruegel the Elder and the Esthetics of Subversion*
OF CHURCHES, HERETICS, AND OTHER GUIDES OF THE BLIND: THE FALL OF THE BLIND LEADING THE BLIND BY PIETER BRUEGEL THE ELDER AND THE ESTHETICS OF SUBVERSION* Jürgen Müller Heresy in Pictures Pictures are a medium of biblical exegesis. By illustrating biblical sub jects, they provide a specific interpretation of selected passages, clarifying and disambiguating by means of images, even where Scripture is vague or obscure. This is due first of all to the nature of the texts in the Old and New Testaments: one rarely encounters descriptions of persons and events vivid enough to function as precise templates for pictorial compo sitions. Pictures, on the other hand, are subject to the necessity of putting something in concrete form; as such, they require legitimization and are potentially instruments of codification.1 During the Reformation pictures were used to canonize religious view points and to give expression to various orthodoxies, but also to denounce the heterodoxy of the opposing side. But whatever their function in reli gious practice may have been, as a rule they operated as vehicles of dis ambiguation. Luther, in particular, valued pictures as a pedagogical tool and took a critical stance against the iconoclasts.2 For him, their essential purpose was to teach, simply and clearly.3 * Translated from German to English by Rosemarie Greenman and edited by Walter Melion. 1 Cf. Scribner R.W., “Reformatorische Bildpropaganda”, Historische Bildkunde 12 (1991) 83–106. 2 Cf. Berns J.J., “Die Macht der äußeren und der inneren Bilder. Momente des innerpro testantischen Bilderstreits während der Reformation”, in Battafarano I.M. -

Katalog 122 (März 2012)
122 Venator & Hanstein Buch- und Graphikauktionen Auktion 123 24. März 2012 Moderne und zeitgenössische Graphik Moderne Kunstliteratur Hanstein & Friedensreich Hundertwasser, Regentag. 1971/72. Venator 03/12 Venator & Hanstein Cäcilienstraße 48 · D-50667 Köln · Germany Tel. +49-221-2575419 Fax 2575526 · www.venator-hanstein.de Bücher Graphik Autographen Auktion 122 23. März 2012 Abbildung Umschlag, 595 De Bry / Pigafetta Venator & Hanstein Köln (Detail) Bücher Graphik Autographen Venator & Hanstein Bücher Graphik Autographen Auktion 122 23. März 2012 Köln Venator & Hanstein KG Buch- und Graphikauktionen Cäcilienstraße 48 (Haus Lempertz) 50667 Köln (Germany) Tel +49-221-257 54 19 Fax +49-221-257 55 26 www.venator-hanstein.de [email protected] HR Köln A 3690 USt-IdNr DE 122649294 Bankverbindungen Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 75514 IBAN DE58 3705 0299 0000 0755 14 Swift: COKSDE33 Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. Köln (BLZ 370 302 00) 23210 IBAN DE22 3703 0200 0000 0232 10 Swift: SOPPDE3K Postbank Köln (BLZ 370 100 50) 120 10-503 IBAN DE41 3701 0050 0012 0105 03 BIC: PBNKDEFF Vertretungen durch das Kunsthaus Lempertz 1, Rue aux Laines B-1000 Bruxelles Tel +32-2-5 14 05 86 Fax +32-2-5 11 48 24 Poststr. 22 10178 Berlin Tel +49-30-27 87 60 80 Fax +49-30-27 87 60 86 St.-Anna-Platz 3 80538 München Tel +49-89-98 10 77 67 Fax +49-89-21 01 96 95 VORBESICHTIGUNG PREVIEW Im Kunsthaus Lempertz März 2012 Neumarkt 3 Freitag 16. und Samstag 17. 10.00–17.30 Uhr Köln Sonntag 18. 11.00–15.00 Uhr Montag 19. -

Illustre Literatur Illustriert, Signiert, Nummeriert, Gewidmet
Illustre Literatur illustriert, signiert, nummeriert, gewidmet Antiquariat Abaton Liste 19 GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN Das Angebot ist freibleibend. Alle angebotenen Bücher sind, soweit nicht anders vermerkt, vollständig und dem Alter entsprechend gut erhalten. Mängel werden nach bestem Wissen angegeben. Die Preise sind in EURO ausgewiesen, die gesetzliche MWSt. (z. Zt. 7% bzw. 19%) ist bereits enthalten. Ein Lieferzwang besteht nicht. Alle Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs erledigt und auf Kosten des Emp- fängers versandt. Den Portokosten liegen die Tarife der Deutschen Post AG zugrunde, andere Versandmög- lichkeiten bestehen und können individuell verabredet werden. Verpackungskosten werden dem Käufer in Rechnung gestellt, wobei wir uns vorbehalten, die Verpackungsart zu wählen, die das verkaufte Objekt am besten schützt. Für Sendungen im Wert unter Euro 50,– werden i. d. R. Euro 3,00 Versandkosten berech- net, sofern sie unter 1 Kilo wiegen; alle übrigen Sendungen werden als versichertes DHL-Paket (Euro 5,80) verschickt (gültig nur innerhalb Deutschlands; für Bestellungen aus dem Ausland können individuelle Ver- sandarten abgesprochen werden). Der Verkauf erfolgt generell gegen Vorausrechnung und sofortige Bezah- lung, etwaige Bankgebühren sind vom Käufer zu tragen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum gemäß §455 BGB. Widerrufsrecht nach §3 FernAbsG und §361a BGB innerhalb von einem Monat ab Empfang der Ware. Weist eine Rücksendung durch zwischenzeitlichen Gebrauch, Verpackung oder Transport entstandene Mängel auf, so ist deren Absender dafür regresspflichtig. Gerichtsstand ist Mün- chen. Die vollständigen ver bind lichen Geschäftsbedingungen sind einsehbar auf unserer Homepage www. antiquariat-abaton.de. Mit der Sendung einer Bestellung via E-Mail, Briefpost, telefonisch o. ä. erkennt der Besteller diese Geschäftsbedingungen verbindlich an. -
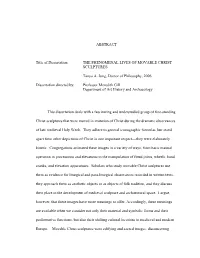
This Dissertation Considers How a New Approach to Understanding Historic Collections Will Be Able to Provide Fresh Perspectives
ABSTRACT Title of Dissertation: THE PHENOMENAL LIVES OF MOVABLE CHRIST SCULPTURES Tanya A. Jung, Doctor of Philosophy, 2006 Dissertation directed by: Professor Meredith Gill Department of Art History and Archaeology This dissertation deals with a fascinating and understudied group of free-standing Christ sculptures that were moved in imitation of Christ during the dramatic observances of late medieval Holy Week. They adhere to general iconographic formulas, but stand apart from other depictions of Christ in one important respect—they were elaborately kinetic. Congregations animated these images in a variety of ways, from basic manual operation in processions and elevations to the manipulation of fitted joints, wheels, hand cranks, and elevation apparatuses. Scholars who study movable Christ sculptures use them as evidence for liturgical and para-liturgical observances recorded in written texts, they approach them as aesthetic objects or as objects of folk tradition, and they discuss their place in the development of medieval sculpture and architectural space. I argue, however, that these images have more meanings to offer. Accordingly, these meanings are available when we consider not only their material and symbolic forms and their performative functions, but also their shifting cultural locations in medieval and modern Europe. Movable Christ sculptures were edifying and sacred images, disconcerting idols, homely folk objects, and works of art. My aim in this dissertation is to write a cultural biography of the lives of these images—in other words, a history that can account for the varied connotations of movable Christ sculptures in different instances of practice, reception, and response. It is my contention that these images, because of their performative function, experiential qualities, mimetic form, relatively anonymity, and “thingness,” present an ideal opportunity to exercise cultural biography from an art historical perspective. -

„Bücher, Bücher, Bücher, Bücher …“
„Bücher, Bücher, Bücher, Bücher …“ Wertvolle Autographen, Bücher, Graphik, Handschriften und Plakate Gemeinschaftskatalog der Antiquare 2010 veranstaltet von der Genossenschaft der Internet-Antiquare eG Geschäftsbedingungen: 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 Der Gemeinschaftskatalog der Antiquare 2009 wird BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt von der Genossenschaft der Internet-Antiquare eG die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der (GIAQ) herausgegeben, sie selbst bietet jedoch keine Sache. Der Widerruf ist an das jeweilige Antiquariat Waren zum Kauf an. Anbieter sind die jeweiligen zu richten. Die Adresse ist dem Kopf der jeweiligen Antiquariate, an die Bestellungen zu richten sind. Angebotsseiten im Katalog zu entnehmen. Kaufverträge kommen nur zwischen den einzel- nen Antiquariaten und den Käufern zustande, und Widerrufsfolgen: zwar dadurch, daß ein Antiquariat eine Bestellung Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider- annimmt und die Lieferung bestätigt oder die Ware seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren liefert. Für den Vertragsschluß und die Vertrags- und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus- abwicklung gelten die Geschäftsbedingungen des zugeben. Können Sie uns die empfangene Leis- jeweiligen Antiquariates. Soweit dort nichts anderes tung ganz oder teilweise nicht oder nur in ver- geregelt ist gelten folgende Grundsätze: schlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Das Angebot ist freibleibend, Lieferzwang besteht Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der nicht. Preise in € inkl. der gesetzlich gültigen MwSt. Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Der Versand erfolgt in der Reihenfolge der Bestel- Verschlechterung der Sache ausschließlich auf de- lungen und auf Kosten der Besteller. Die Ware bleibt ren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des an- möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. -

Nachverkauf AUKTION · Bücher & Antiquitäten Bücher · Alte Und Moderne Kunst Bücher & Antiquitäten Alte Und Moderne Kunst
115 AUKTION 115 Nachverkauf KIEFER BUCH- UND KUNSTAUKTIONEN AUKTION – Nachverkauf 115 · Bücher & Antiquitäten · Alte und Moderne Kunst Bücher & Antiquitäten Alte und Moderne Kunst KIEFER Steubenstraße 36 Fon (0 72 31) 92 32-0 D-75172 Pforzheim Fax (0 72 31) 92 32-16 BUCH- UND KUNSTAUKTIONEN www.kiefer.de [email protected] Kiefer BUCH- UND KUNSTAUKTIONEN INHALTSVERZEICHNIS Alte Drucke / Old and rare books, manuscripts . 3 – 406 Genealogie, Heraldik, Politik, Sozialismus, Wirtschaft / Genealogy, heraldry, politics, economics . 409 – 441 Varia (Film, Theater, Tanz, Freimaurerei, Grenzwissenschaften u. Okkultismus, Judaica, Juridica, Militaria, Musik, Numismatik, Spiele, Sport, Studentica, Zeitschriften) / Varia (movie, theatre, dance, freemasonry, judaica, occultism, military, music, numismatics, games, sports, studentica, Journals …) . 442 – 632 Jagd (Angeln, Kynologie), Pferde, Küche u. Haushalt (Garten), Land- u. Forstwirtschaft (Garten) / Hunting (fishing, kynology), horses, kitchen (household, garden), agriculture and forestry (garden) . 637 – 733 Kunstwissenschaft / Art History . 736 – 819 Buchwesen und Bibliographie / Bibliography . 825 – 880 Kultur- und Sittengeschichte / Cultural History . 883 – 924 Kinder- und Jugendbücher / Children’s books . 927 – 1010 Literatur und illustrierte Bücher bis 19. Jahrhundert / Literature and illustrated books 19th century . 1011 – 1144 Moderne Literatur und illustrierte Bücher bis 20. Jahrhundert / Modern literature and illustrated books 20th century . 1151 – 1429 Naturwissenschaften und Technik / Natural -
Recognitions: Theme and Metatheme in Hans Burgkmair the Elder's
Recognitions: Theme and Metatheme in Hans Burgkmair the Elder’s Santa Croce in Gerusalemme of 1504 Mitchell B. Merback And so that you might see yourself there union: the comprehension of a paradox uniting identity and and gently look at it, presence that, in itself, constitutes an ever-renewing chal- this pious mirror for your own good lenge to faith—an “enduring predicament” brought about we bring before your eyes, by grace itself.4 in visible form, with characters. From the mid-thirteenth century on, European artists pro- —Arnoul Greban, Le mystere de la Passion (mid-1400s)1 jected this demand onto their depictions of protagonists and antagonists, models and antimodels, within the narrative Pas- In Christianity’s preeminent narrative image, the Crucifix- sion image for the discernment of those outside it. Figures ion, Jesus of Nazareth hangs dead on the Cross, there for all who had once been mere agents, embodiments of a narrative to see. Ridiculed as the King of the Jews, victim of the most function, would henceforth be fleshed out as characters, abhorrent of punishments, focal point of mystery and won- embodied moral types possessed of human idiosyncrasies der, he embodies in death a harrowing paradox. For at the and passions, capable of a full range of situated responses— climax of the Passion drama, the epochal moment toward from belief to incredulity, from faith to doubt, from compas- which the Gospels point again and again, Jesus’s messianic sion to cruelty—indicative of human will. Especially striking identity was still hanging -

Chapter 3 the Birth of an Anatomical Icon
Chapter 3 The Birth of an Anatomical Icon Anatomical fugitive sheets clearly constitute a printed, iconographical and textual genre of their own. Their main characteristic, common to them all throughout the centuries, is to show the human anatomy by means of a printed figure made out of flaps of paper one can lift up, and surrounded with a brief explanatory text. This idea is at the basis of the tradition which persists from Vogtherr to Remmelin's Catoptron until the anatomical tables of Alexander Ramsay and Edward William Tuson, published in the nineteenth century.' Even today one can find books-particularly for children-which use the same, simple, immediate, intuitive method of unveiling figures in order to explain the make-up of the human body and the connections between its parts.2 Renaissance fugitive sheets constitute in fact one solution to the problem posed by the need to represent visually data which are intrinsically topographical: the body is a map, a collection of forms, parts and spatial relations hidden away under the skin, which can be explained in terms of these connections and relations. It was Vogtherr, as far as available documents show, who established the technique for these fugitive sheets with superimposed flaps; and his invention was a success because the method allowed for the restitution of a virtual three- dimensionality to an object-the human body-which would otherwise, when reproduced in print, be restricted to the two-dimensionality of pictorial representation. But what are the antecedents of Vogtherr's invention? What are its iconographical and textual sources? What were the channels for its diffusion? The reconstruction of this story, partial as it is, helps to throw some light on aspects of the cultural context in which the fugitive sheets were produced, and provides some clues about their social destination. -

Chapter 3 the Birth of an Anatomical Icon
Chapter 3 The Birth of an Anatomical Icon Anatomical fugitive sheets clearly constitute a printed, iconographical and textual genre of their own. Their main characteristic, common to them all throughout the centuries, is to show the human anatomy by means of a printed figure made out of flaps of paper one can lift up, and surrounded with a brief explanatory text. This idea is at the basis of the tradition which persists from Vogtherr to Remmelin's Catoptron until the anatomical tables of Alexander Ramsay and Edward William Tuson, published in the nineteenth century.' Even today one can find books-particularly for children-which use the same, simple, immediate, intuitive method of unveiling figures in order to explain the make-up of the human body and the connections between its parts.2 Renaissance fugitive sheets constitute in fact one solution to the problem posed by the need to represent visually data which are intrinsically topographical: the body is a map, a collection of forms, parts and spatial relations hidden away under the skin, which can be explained in terms of these connections and relations. It was Vogtherr, as far as available documents show, who established the technique for these fugitive sheets with superimposed flaps; and his invention was a success because the method allowed for the restitution of a virtual three- dimensionality to an object-the human body-which would otherwise, when reproduced in print, be restricted to the two-dimensionality of pictorial representation. But what are the antecedents of Vogtherr's invention? What are its iconographical and textual sources? What were the channels for its diffusion? The reconstruction of this story, partial as it is, helps to throw some light on aspects of the cultural context in which the fugitive sheets were produced, and provides some clues about their social destination. -

Froschauer Drucke. Katalog Des EOS Buchantiquariats Benz
Froschauer Drucke EOS Buchantiquariat Benz Katalogbearbeitung: Dorothe Schneider Froschauer Drucke EOS Buchantiquariat Benz Kirchgasse 17 8001 Zürich Switzerland Tel: +41(0)44 261 57 50 Fax: +41(0)44 260 59 01 [email protected] www.eosbooks.ch Allgemeine Geschäftsbedingungen Die angebotenen Bücher wurden nach unserem besten Wissen und Gewissen beschrieben und sind wenn nicht anders vermerkt voll- ständig. Kleinere Mängel wurden nicht beschrieben, sind aber im Preis berücksichtigt. Das Angebot ist freibleibend und es besteht kein Lieferzwang. Die Versandkosten werden auf Basis der Selbst- kosten dem Käufer belastet. Erfolgt der Versand ab Deutschland wird der Preis um 7% EUSt. erhöht. Bei begründeter Beanstan- dung bitten wir um Retournierung innerhalb von 8 Tagen. An uns unbekannte Besteller erfolgt die Lieferung nur gegen Vorauskasse. Gerichtsstand ist Zürich. 1 Aesop: [Fabulae]. Aesopi Phrygis et alliorum fabulae. His accesserunt Abstemii Hecatomythion secundum. Quaedam aliae incerto interprete, una cum selectis Poggii facetiis. Addita sunt Io. Fr. Quintiani Disticha in fabulas P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon. Tiguri, ex Officina Froschoviana, (um 1560). 8°. 296 S., (11) Bl. Index (letztes leeres Bl. fehlt). Mit Druckermarke. Neuer Einband mit Pergament-Rücken und Deckelbezügen aus einem schwarz und rot bedruckten Inkunabelblatt. (5587C) CHF 850,-- VD 16 A 487; Vischer C 643; Rudolphi 520. - Nebst Fabeln von Aesop enthält das Buch Werke von Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459), Lorenzo Astemio (1440-1506) und Giovanni Francesco Quinziano (1484- 1557). Leemann-van Elck (Offizin) bemerkt "Der humanistische Einschlag machte sich in vermehrten Neudrucken griechischer und lateinischer Klassiker geltend.". - Titel und letztes Blatt restauriert. - Mit Exlibris Paul Ad. Leemann. 2 Biblia Germanica.