2016-08-12-Ladenöffnungsgesetz.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ladenschlussrecht
Druckerei C. H . Beck Neumann: Ladenschlussgesetz Medien mit Zukunft ............................. Revision, 25.04.2008 ldok na um i e g i n r t Inhalt Revision O Inhaltsverzeichnis V n e Abkürzungsverzeichnis ........................................................................... XIII e r K l l a h Gesetz über den Ladenschluss g a Erster Abschnitt. Begriffsbestimmungen V e / § 11 Verkaufsstellen ..............................................................................C 1 k § 12 Begriffsbestimmungen ................................................................... 6 c H. B e Zweiter Abschnitt. Ladenschlusszeiten § 13 Allgemeine Ladenschlusszeiten ..................................................... 10 § 14 Apotheken ................................................................................... 16 § 15 Zeitungen und Zeitschriften ......................................................... 17 § 16 Tankstellen ................................................................................... 18 § 17 (weggefallen) ................................................................................ 19 § 18 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen ......................................... 19 § 19 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen ............................. 22 § 10 Kur- und Erholungsorte ............................................................... 24 § 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen ............................... 26 § 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen ..................................... -

“More”? How Store Owners and Their Businesses Build Neighborhood
OFFERING “MORE”? HOW STORE OWNERS AND THEIR BUSINESSES BUILD NEIGHBORHOOD SOCIAL LIFE Vorgelegt von MA Soz.-Wiss. Anna Marie Steigemann Geboren in München, Deutschland von der Fakultät VI – Planen, Bauen, Umwelt der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie in Soziologie - Dr. phil - Genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzende: Prof. Dr. Angela Million Gutachterin I: Prof. Dr. Sybille Frank Gutachter II: Prof. Dr. John Mollenkopf Gutachter III: Prof. Dr. Dietrich Henckel Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 10. August 2016 Berlin 2017 Author’s Declaration Author’s Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis and that this thesis and the work presented in it are my own and have been generated by me as the result of my own original research. In addition, I hereby confirm that the thesis at hand is my own written work and that I have used no other sources and aids other than those indicated. The author herewith confirms that she possesses the copyright rights to all parts of the scientific work, and that the publication will not violate the rights of third parties, in particular any copyright and personal rights of third parties. Where I have used thoughts from external sources, directly or indirectly, published or unpublished, this is always clearly attributed. All passages, which are quoted from publications, the empirical fieldwork, or paraphrased from these sources, are indicated as such, i.e. cited or attributed. The questionnaire and interview transcriptions are attached in the version that is not publicly accessible. This thesis was not submitted in the same or in a substantially similar version, not even partially, to another examination board and was not published elsewhere. -

Interview with J.D. Bindenagel
Library of Congress Interview with J.D. Bindenagel The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR J.D. BINDENAGEL Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial interview date: February 3, 1998 Copyright 2002 ADST Q: Today is February 3, 1998. The interview is with J.D. Bindenagel. This is being done on behalf of The Association for Diplomatic Studies. I am Charles Stuart Kennedy. J.D. and I are old friends. We are going to include your biographic sketch that you included at the beginning, which is really quite full and it will be very useful. I have a couple of questions to begin. While you were in high school, what was your interest in foreign affairs per se? I know you were talking politics with Mr. Frank Humphrey, Senator Hubert Humphrey's brother, at the Humphrey Drugstore in Huron, South Dakota, and all that, but how about foreign affairs? BINDENAGEL: I grew up in Huron, South Dakota and foreign affairs in South Dakota really focused on our home town politician Senator and Vice President Hubert H. Humphrey. Frank, Hubert Humphrey's brother, was our connection to Washington, DC, and the center of American politics. We followed Hubert's every move as Senator and Vice President; he of course was very active in foreign policy, and the issues that concerned South Dakota's farmers were important to us. Most of farmers' interests were in their wheat sales, and when we discussed what was happening with wheat you always had to talk about the Russians, who were buying South Dakota wheat. -

Constitutional Drift: Toward the End of Federal Shop-Closing (Ladenschluss) Regulation Craig T
University of North Carolina School of Law Carolina Law Scholarship Repository Faculty Publications Faculty Scholarship 2004 Constitutional Drift: Toward the End of Federal Shop-Closing (Ladenschluss) Regulation Craig T. Smith University of North Carolina School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.law.unc.edu/faculty_publications Part of the Law Commons Publication: German Law Journal This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at Carolina Law Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications by an authorized administrator of Carolina Law Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. PUBLIC LAW Constitutional Drift: Toward the End of Federal Shop- Closing (Ladenschluss) Regulation By Craig T. Smith* A. Introduction Germany’s Federal Constitutional Court held on June 9, 2004, that the weekend and holiday closing requirements of the federal Shop-Closing Act (Ladenschlussgesetz) are compatible with the Basic Law.1 At the same time, however, the Court’s deci- sion in this Weekend Shop-Closing Case situated the Act’s Saturday closing require- ment – and by implication its weekday closing requirements too – perilously close to the brink of unconstitutionality. The Court’s First Senate accomplished this through three distinct rulings. First, it unanimously upheld the Sunday and holiday shop-closing requirements. Second, the First Senate – likewise unanimously – clarified that, under a 1994 amendment to the Basic Law, power to regulate retail shop-opening hours shifted from the federal government to the Länder. Finally, an evenly divided First Senate upheld the Act’s Saturday closing requirement, but only by virtue of the deadlock. -

British Identity and the German Other William F
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2012 British identity and the German other William F. Bertolette Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the History Commons Recommended Citation Bertolette, William F., "British identity and the German other" (2012). LSU Doctoral Dissertations. 2726. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2726 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. BRITISH IDENTITY AND THE GERMAN OTHER A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by William F. Bertolette B.A., California State University at Hayward, 1975 M.A., Louisiana State University, 2004 May 2012 ACKNOWLEDGMENTS I wish to thank the LSU History Department for supporting the completion of this work. I also wish to express my gratitude for the instructive guidance of my thesis committee: Drs. David F. Lindenfeld, Victor L. Stater and Meredith Veldman. Dr. Veldman deserves a special thanks for her editorial insights -

Regelungen Zum Ladenschlussgesetz Die Ladenöffnungszeiten Wurden in Den Meisten Bundesländern Liberalisiert, Aber Nicht Immer Im Sinne Des Einzelhandels
Regelungen_zum_Ladenschlussgesetz.QXP:g_v 25.09.2009 14:28 Uhr Seite 1 gundv.de Download Thema: Regelungen zum Ladenschlussgesetz Die Ladenöffnungszeiten wurden in den meisten Bundesländern liberalisiert, aber nicht immer im Sinne des Einzelhandels. Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag Es gibt einen bunten „Flickenteppich“ in Deutschland. Bezug zum Heft: g&v 10/2009 In der unten stehenden Tabelle finden Sie die Regelungen zum Ladenschlussgesetz in den einzelnen Bundesländern. Regelungen zum Ladenschlussgesetz Bayern Baden- Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- Nordrhein- Nieder- Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen- Schleswig- Thüringen Württemberg Vorpommern Westfalen sachsen Anhalt Holsten 6 x 24 Stunden-Öff- x x x x x x x x x x nung an Werkstagen andere Regelung Montag bis Samstag Mo. bis Sa. Mo. bis Sa. Mo. bis Fr. 0.00 6.00 bis 20.00 Uhr 6.00 bis 22.00 Uhr 6.00 bis 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr, Sa. 0.00 bis 20.00 Uhr Sonntagsöffnung x x x x x x x x x x x x 4 Sonntage/Jahr 6 Sonntage/Jahr x x x Sonntage/Jahr 3 10 (Anzahl) Öffnung an nein x x nein nicht am 1. Advent, nein x x x x Adventssonntagen Ausnahmen für andere zulässig Adventssonntage Sonntagsöffnungs- Blumenverkauf Blumenverkauf 13.00 bis 13.00 bis 5 Stunden 5 Stunden 6 Stunden nicht zu den Hauptzeiten Blumenver- 5 Stunden 5 Stunden 5 Stunden zwischen 12 – 5 Stunden 5 Stunden 11.00 bis 20.00 Uhr zeiten, wenn 2 Stunden, mit 3 Stunden mit Ausnahme 20.00 Uhr 20.00 Uhr zwischen Ende Ende der Gottesdienste kauf 5 Stun- Ende 18.00 Uhr 11 und 18.00 Uhr 18.00 -
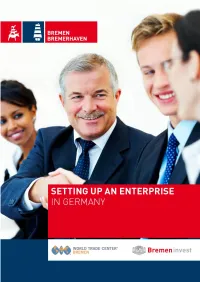
Information on Setting up an Enterprise in Germany
CONTENTS 1 LEGAL FORMS OF COMPANIES ................................................................................... 3 Representative Office ...................................................................................................... 3 Branch Office ................................................................................................................... 3 Sole Proprietorship .......................................................................................................... 4 General Partnership (OHG) ............................................................................................. 4 Limited Partnership (KG) ................................................................................................. 4 Stock Corporation (AG) ................................................................................................... 4 Limited Liability Company (GmbH) .................................................................................. 5 2 TAXATION ....................................................................................................................... 8 Personal Income Tax ....................................................................................................... 9 Corporate Income Tax ..................................................................................................... 9 Trade Tax ......................................................................................................................... 9 Capital Gains Tax ........................................................................................................... -

Opening Hours and Employment in the Retail Sector: Quasi
Opening Hours and Employment in the Retail Sector: Quasi-Experimental Evidence from Germany Bossler, Mario * Oberfichtner, Michael † Institute for Employment Research University of Erlangen-Nuremberg Preliminary, August 2013. Abstract We study the effect of a deregulation in shop opening hours on employment in food retailing. Our identification relies on changes in restrictions of business hours across German states that allow for a difference-in-differences approach. Using data on the universe of German establishments, we find that lifting restrictions on business hours increases total employment modestly. This effect is driven by an increase in part-time employment while full-time employment is not affected. The statistical significance of these effects hinges on the assumptions on error correlation and we hence report inference robust to clustering at different levels. * Institute for Employment Research, Department Establishments and Employment, Regensburger Str. 104, 90478 Nuremberg, e-mail: [email protected], phone: +49-911-179-3043. † Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Department of Economics, Lange Gasse 20, 90403 Nuremberg, e-mail: [email protected], phone: +49-911-5302-771. For helpful comments and suggestions, we thank Sascha Becker, Thiess Büttner, Boris Hirsch, Robin Naylor, Thorsten Schank, Claus Schnabel, Till von Wachter, Fabian Waldinger, Matthias Wrede, Jeffrey Wooldridge, and Thomas Zwick as well as participants of the 16th BGPE workshop and seminars at the universities of Erlangen-Nuremberg and Warwick. Michael Oberfichtner visited University of Warwick during the work on this article, and he is thankful for their hospitality. Introduction Despite a general trend towards deregulation, restrictions of shop opening hours are still widespread. -

12.2 Baden-Württemberg 12.2.1 Gesetz Über Die Ladenöffnung In
12.2 Baden-Württemberg 12.2.1 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) Vom 14.02.2007 (GBl. BW, S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2009 (GBl. BW, S. 628) § 1 Anwendungsbereich Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten von Waren. § 2 Begriffsbestimmungen (...) (3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. (...) § 3 Ladenöffnungszeiten (1) Verkaufsstellen dürfen geöffnet sein, soweit nicht Regelungen dieses Gesetzes entgegenstehen. (2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein 1. an Sonn- und Feiertagen, 2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr. (3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach diesem Gesetz oder den hierauf gestützten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten. (4) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. (5) Absatz 2 gilt nicht für Volksfeste, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterliegen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind. § 3a Verkauf alkoholischer Getränke (1) In Verkaufsstellen dürfen alkoholische Getränke in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht verkauft werden. Hofläden sowie Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen Genossenschaften, von landwirtschaftlichen Betrieben und auf Verkehrsflughäfen innerhalb der Terminals dürfen alkoholische Getränke abweichend von Satz 1 verkaufen. (2) § 3 Abs. 4 gilt entsprechend. (3) Auf Antrag der Gemeinden können die Regierungspräsidien örtlich und zeitlich beschränkte Ausnahmen vom Verbot nach Absatz 1 zulassen, wenn dabei die mit dem Gesetz verfolgten öffentlichen Belange gewahrt bleiben. -

Leuchtturmregion Bremerhaven
Studie Leuchtturmregion Bremerhaven Helma Landsberg Petra Meurer Bremen, im Dezember 2006 BAW Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH Leuchtturmregion Bremerhaven Auftraggeber: Der Magistrat der Stadt Bremerhaven Der Senator für Wirtschaft und Häfen Helma Landsberg Petra Meurer BAW Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH Wilhelm-Herbst-Str. 5 28359 Bremen Tel: 0421/206 99-0 Fax: 0421/206 99-99 Leitung: Prof. Dr. Frank Haller Dr. Nikolai Lutzky Prokuristen: Michael Meyer-Kornblum Walter Wehling Wissenschaftliche Mitarbeiter: Helma Landsberg, Dr. Petra Meurer, Thilo Ramms, Dr. Matthias Schönert, Dr. Gero Stenke, Isabel Sünner, Walter Wehling, Dr. Werner Willms Gliederung Gliederung 1 Notwendigkeit für die Bildung einer Leuchtturmregion Bremerhaven 1 1.1 Aufgabenstellung 1 1.2 Wirtschaftliche Lage Bremerhavens 2 1.2.1 Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze 2 1.2.2 Einwohnerentwicklung 4 1.2.3 Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe 5 1.2.4 Pendlersaldo 7 1.3 Positionierung Bremerhavens in der europäischen Metropolregion Bremen/Oldenburg im Nordwesten 9 1.3.1 Das Konzept der Metropolregionen in Deutschland 10 1.3.2 Europäische Metropolregion Bremen/Oldenburg im Nordwesten 12 1.3.3 Positionierung Bremerhavens 16 1.4 Ableitung von Programmschwerpunkten 22 2 Programmschwerpunkt: Wirtschaftsförderung und Finanzierung von Schwerpunktprojekten 26 2.1 Vorgehensweise 26 2.2 Finanzierung von Investitionen in Bremerhaven durch das Land Bremen – Das 25-Prozent-Prinzip 26 2.3 Fördermaßnahmen des Bundes und der EU 27 2.3.1 Gemeinschaftsaufgabe -
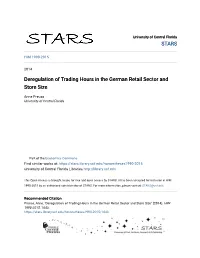
Deregulation of Trading Hours in the German Retail Sector and Store Size
University of Central Florida STARS HIM 1990-2015 2014 Deregulation of Trading Hours in the German Retail Sector and Store Size Anne Preuss University of Central Florida Part of the Economics Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/honorstheses1990-2015 University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Open Access is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in HIM 1990-2015 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. Recommended Citation Preuss, Anne, "Deregulation of Trading Hours in the German Retail Sector and Store Size" (2014). HIM 1990-2015. 1843. https://stars.library.ucf.edu/honorstheses1990-2015/1843 DEREGULATION OF TRADING HOURS IN THE GERMAN RETAIL SECTOR AND STORE SIZE by ANNE PREUSS A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in Economics in the College of Business Administration and in The Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2014 Thesis Chair: Dr. Melanie Guldi ©2014 Anne Preuss ii Abstract In 2006, the German federal government relinquished its power to determine store opening hours to the 16 federal states. Since then, substantial deregulation of shopping hours has occurred in all states except Bavaria and Saarland. Such deregulation could support economic growth, but it has been argued to hurt small businesses. Therefore, this thesis examines different store size categories to find possible effects of deregulation in Germany. Past studies have focused on the employment effects of deregulation, whereas this investigation employs a difference-in-difference approach with OLS regression on the number of stores in each size category. -

The Employment Effect of Deregulating Shopping Hours: Evidence from German Retailing
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Bossler, Mario; Oberfichtner, Michael Working Paper The employment effect of deregulating shopping hours: Evidence from German retailing Diskussionspapiere, No. 91 Provided in Cooperation with: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Chair of Labour and Regional Economics Suggested Citation: Bossler, Mario; Oberfichtner, Michael (2014) : The employment effect of deregulating shopping hours: Evidence from German retailing, Diskussionspapiere, No. 91, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik, Nürnberg This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/94197 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG Lehrstuhl für VWL, insbes. Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik Professor Dr. Claus Schnabel Diskussionspapiere Discussion Papers NO.