Gudrun Wolfschmidt (Hg.) Booklet of Abstracts
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Staircase of Vienna Observatory (Institut Für Astronomie Der Universität Wien)
Figure 15.1: Staircase of Vienna Observatory (Institut für Astronomie der Universität Wien) 142 15. The University Observatory Vienna Anneliese Schnell (Vienna, Austria) 15.1 Introduction should prefer non-German instrument makers (E. Weiss 1873). In spring of 2008 the new Vienna Observatory was th commemorating its 125 anniversary, it was officially During a couple of years Vienna Observatory was edit- opened by Emperor Franz Joseph in 1883. Regular ob- ing an astronomical calendar. In the 1874 edition K. L. servations had started in 1880. Viennese astronomers Littrow wrote a contribution about the new observatory had planned that observatory for a long time. Already th in which he defined the instrumental needs: Karl von Littrow’s father had plans early in the 19 “für Topographie des Himmels ein mächtiges parallakti- century (at that time according to a letter from Joseph sches Fernrohr, ein dioptrisches Instrument von 25 Zoll Johann Littrow to Gauß from December 1, 1823 the Öffnung. Da sich aber ein Werkzeug von solcher Grö- observatory of Turku was taken as model) (Reich 2008), ße für laufende Beobachtungen (Ortsbestimmung neu- but it lasted until 1867 when it was decided to build a er Planeten und Kometen, fortgesetzte Doppelsternmes- new main building of the university of Vienna and also sungen, etc.) nicht eignet, ein zweites, kleineres, daher a new observatory. Viennese astronomers at that time leichter zu handhabendes, aber zur Beobachtung licht- had an excellent training in mathematics, they mostly schwacher Objekte immer noch hinreichendes Teleskop worked on positional astronomy and celestial mechanics. von etwa 10 Zoll Öffnung, und ein Meridiankreis er- They believed in F. -

The MOON in the Age of PHOTOGRAPHY 1859-1969
The MOON in the Age of PHOTOGRAPHY 1859-1969 MILANEUM VINTAGE PHOTOGRAPHY The Moon in the Age of Photography 1859-1969 The photos of the moon landing on July 20, 1969 mark an important point in the history of the picture and have radically expanded the limits of human imagination. This exhibition takes place on the occasion of the 50th anniversary of the moon landing of Apollo 11. A wide range of photographs from NASA’s Apollo Program 1961 -1972, published in Austria via the U.S. Information Service (USIS), highlight #MILANEUM the culmination of technological development and international cooperation in space. (19-39) 4/2019 Photographs by the Austro-Hungarian astronomer Ladislaus Weinek from the 1880s illustrate the efforts of the 19th century to accurately depict the lunar surface. (3-6) The attraction between astronomy and photography is natural, since both are concerned with the reflectance or absorption of light upon surfaces. Around 1900 even simple studio photographers tried to profit from the fascination for the moon. (13-15) Photomontage postcards convey bizarre fantasies about life on the moon. (12/16/17) details and prices on request: [email protected] 1/2 Warren De La Rue (1815-1889) Moon, GB. ca. 1858 Stereoscopic photograph Albumine print Warren De La Rue was among the earliest astronomer-photographers and worked at Kew Observatory. De La Rue took the photos at different geographi- cal locations and different times of year. Stereophotography gives an illusion of depth. 7 3/4 Ladislaus Weinek Mondkrater (Archimedes) Lick Observatory Albumine print ca. 1888 ca. 25 x 21,5 cm 9 WEINEK, Ladislaus (*1848 in Ofen, †1913 in Prag) Weinek was educated in Vienna, and worked at the pho- 5/6 Übersicht der von Weinek in Prag 1884-1891 nach der tography laboratories in Schwerin. -

Appendix 1 1311 Discoverers in Alphabetical Order
Appendix 1 1311 Discoverers in Alphabetical Order Abe, H. 28 (8) 1993-1999 Bernstein, G. 1 1998 Abe, M. 1 (1) 1994 Bettelheim, E. 1 (1) 2000 Abraham, M. 3 (3) 1999 Bickel, W. 443 1995-2010 Aikman, G. C. L. 4 1994-1998 Biggs, J. 1 2001 Akiyama, M. 16 (10) 1989-1999 Bigourdan, G. 1 1894 Albitskij, V. A. 10 1923-1925 Billings, G. W. 6 1999 Aldering, G. 4 1982 Binzel, R. P. 3 1987-1990 Alikoski, H. 13 1938-1953 Birkle, K. 8 (8) 1989-1993 Allen, E. J. 1 2004 Birtwhistle, P. 56 2003-2009 Allen, L. 2 2004 Blasco, M. 5 (1) 1996-2000 Alu, J. 24 (13) 1987-1993 Block, A. 1 2000 Amburgey, L. L. 2 1997-2000 Boattini, A. 237 (224) 1977-2006 Andrews, A. D. 1 1965 Boehnhardt, H. 1 (1) 1993 Antal, M. 17 1971-1988 Boeker, A. 1 (1) 2002 Antolini, P. 4 (3) 1994-1996 Boeuf, M. 12 1998-2000 Antonini, P. 35 1997-1999 Boffin, H. M. J. 10 (2) 1999-2001 Aoki, M. 2 1996-1997 Bohrmann, A. 9 1936-1938 Apitzsch, R. 43 2004-2009 Boles, T. 1 2002 Arai, M. 45 (45) 1988-1991 Bonomi, R. 1 (1) 1995 Araki, H. 2 (2) 1994 Borgman, D. 1 (1) 2004 Arend, S. 51 1929-1961 B¨orngen, F. 535 (231) 1961-1995 Armstrong, C. 1 (1) 1997 Borrelly, A. 19 1866-1894 Armstrong, M. 2 (1) 1997-1998 Bourban, G. 1 (1) 2005 Asami, A. 7 1997-1999 Bourgeois, P. 1 1929 Asher, D. -

Communications in Asteroseismology
Communications in Asteroseismology Volume 149 December, 2008 Konferenzbeitr¨age/Proceedings Festkolloquium und Fachtagung 250 Jahre Universit¨atssternwarte Wien herausgegeben von/edited by M.G. Firneis und/and F. Kerschbaum Layout von/by M. Rode-Paunzen Communications in Asteroseismology Editor-in-Chief: Michel Breger, [email protected] Editorial Assistant: Daniela Klotz, [email protected] Layout & Production Manager: Paul Beck, [email protected] Institut f¨ur Astronomie der Universit¨at Wien T¨urkenschanzstraße 17, A - 1180 Wien, Austria http://www.univie.ac.at/tops/CoAst/ [email protected] Editorial Board: Conny Aerts, Gerald Handler, Don Kurtz, Jaymie Matthews, Ennio Poretti Cover Illustration Tranquillo Mollo, View of the old observatory on top of the University hall from 1755 (private property) British Library Cataloguing in Publication data. A Catalogue record for this book is available from the British Library. All rights reserved ISBN 978-3-7001-3915-7 ISSN 1021-2043 Copyright c 2008 by Austrian Academy of Sciences Vienna Austrian Academy of Sciences Press A-1011 Wien, Postfach 471, Postgasse 7/4 Tel. +43-1-515 81/DW 3402-3406, +43-1-512 9050 Fax +43-1-515 81/DW 3400 http://verlag.oeaw.ac.at, e-mail: [email protected] Contents Vorwort/Preface von M. G. Firneis und F. Kerschbaum, Editors 5 Ansprache des Pr¨asidenten der Osterreichischen¨ Akademie der Wissenschaften von H. Mang 6 Maximilian Hell’s invitation to Norway von P. P. Aspaas 10 Maximilian Hell und Prager Astronomie von J. Smolka und M. Solc˘ 21 Zur Biographieuber ¨ Franciscus de Paula Triesnecker anl¨asslich der 250-Jahrfeier der Wiener Sternwarte von H. -

New York Democrats Clamor for Cuomo’S Resignation in Harassment Scandal Free
MA MAR 12 18, 2021 VISION TIMES EDITION Images: SETH WENIG/POOL/AFP via Getty Images New York Democrats Clamor for Cuomo’s Resignation in Harassment Scandal Free By Neil Campbell lower back at a reception and process — where people get the Governor to resign in a New York Visiontimes once kissed her hand when she the facts, and they make a March 7 statement. More Governor rose from her desk.” determination…I was the than 50 elected o cials in the Andrew Cuomo’s Director of Attorney General of New York State legislature have called on Cuomo listens to ew York Democrat calls Communications, Peter for four years. I got all sorts of the Governor to resign or face And I think it should speakers at a for beleaguered Governor be encouraged in every Ajemian, took a page out of the allegations against politicians.” impeachment proceedings. vaccination Andrew Cuomo to tender Chinese Communist Party’s Last week Cuomo made a Stewart Cousins was joined site on March his resignation intensified way. I now understand (CCP) Ministry of Foreign point of o ering an apology by Assembly Speaker Carl 8, 2021, a er two additional women that I acted in a way A airs’ book, by launching an for his conduct, “I want New Heastie who questioned the in New York. came forward to accuse that made people feel assault on Hinton in defense of Yorkers to hear from me “governor’s ability to continue Cuomo is the Democrat of sexual his Governor, “Karen Hinton directly on this. First, I fully to lead this state,” according to facing calls harassment on Sunday, uncomfortable. -

The Minor Planet Bulletin (Warner Et 2010 JL33
THE MINOR PLANET BULLETIN OF THE MINOR PLANETS SECTION OF THE BULLETIN ASSOCIATION OF LUNAR AND PLANETARY OBSERVERS VOLUME 38, NUMBER 3, A.D. 2011 JULY-SEPTEMBER 127. ROTATION PERIOD DETERMINATION FOR 280 PHILIA – the lightcurve more readable these have been reduced to 1828 A TRIUMPH OF GLOBAL COLLABORATION points with binning in sets of 5 with time interval no greater than 10 minutes. Frederick Pilcher 4438 Organ Mesa Loop MPO Canopus software was used for lightcurve analysis and Las Cruces, NM 88011 USA expedited the sharing of data among the collaborators, who [email protected] independently obtained several slightly different rotation periods. A synodic period of 70.26 hours, amplitude 0.15 ± 0.02 Vladimir Benishek magnitudes, represents all of these fairly well, but we suggest a Belgrade Astronomical Observatory realistic error is ± 0.03 hours rather than the formal error of ± 0.01 Volgina 7, 11060 Belgrade 38, SERBIA hours. Andrea Ferrero The double period 140.55 hours was also examined. With about Bigmuskie Observatory (B88) 95% phase coverage the two halves of the lightcurve looked the via Italo Aresca 12, 14047 Mombercelli, Asti, ITALY same as each other and as in the 70.26 hour lightcurve. Furthermore for order through 14 the coefficients of the odd Hiromi Hamanowa, Hiroko Hamanowa harmonics were systematically much smaller than for the even Hamanowa Astronomical Observatory harmonics. A 140.55 hour period can be safely rejected. 4-34 Hikarigaoka Nukazawa Motomiya Fukushima JAPAN Observers and equipment: Observer code: VB = Vladimir Robert D. Stephens Benishek; AF = Andrea Ferrero; HH = Hiromi and Hiroko Goat Mountain Astronomical Research Station (GMARS) Hamanowa; FP = Frederick Pilcher; RS = Robert Stephens. -

61 Minor Planet Bulletin 46 (2019) PHOTOMETRIC OBSERVATIONS of MAIN-BELT ASTEROIDS 232 RUSSIA, 1117 REGINITA, and (11200) 1999
61 PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF diameter is 49.863 ± 0.975 km based on an absolute magnitude MAIN-BELT ASTEROIDS 232 RUSSIA, 1117 REGINITA, H = 10.25 (JPL, 2018). AND (11200) 1999 CV121. Observations at all three observatories were made on 11 nights Charles Galdies from 2018 May 6 to July 12. We obtained a synodic period of Znith Observatory 21.901 ± 0.001 hr and amplitude of 0.14 ± 0.02 mag. These results Armonie, E. Bradford Street, are consistent with previously published results from Ruthroff Naxxar NXR 2217, MALTA (2009), Pilcher (2014), and Stephens (2014). [email protected] Stephen M. Brincat Flarestar Observatory (MPC 171) San Gwann SGN 3160, MALTA Winston Grech Antares Observatory Fgura FGR 1555, MALTA (Received: 2018 Oct 1) Photometric observations of three main-belt asteroids were obtained from 2018 April-July from Malta in order to determine their synodic rotation periods. We provide lightcurves for 232 Russia and 1117 Reginita that were obtained from the Spin/Shape Modeling Opportunities list by Warner et al. (2018). The asteroid (11200) 1999 CV121 did not have a referenced period in the LCDB database (Warner et al., 2009). 1117 Reginita is a main-belt asteroid discovered on 1972 May 24 Photometric observations of three main-belt asteroids were carried by J. Comas Sola in Barcelona, Spain. This 10.193 ± 0.250 km out from three observatories located in Malta (Europe). diameter asteroid has an absolute magnitude H = 11.7 and orbits Observations of asteroids 232 Russia, 1117 Reginita, and (11200) the Sun with a semi-major axis of 2.248, eccentricity of 0.198, and 1999 CV121 were obtained from 2018 April-July. -

C.H.F. Peters
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES Ch RISTIAN HEINRIC H F RIEDRIC H PETERS A Biographical Memoir by W I L L I A M ShEE H AN Any opinions expressed in this memoir are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Academy of Sciences. Biographical Memoir COPYRIGHT 1999 NATIONAL ACADEMIES PRESS WASHINGTON D.C. CHRISTIAN HEINRICH FRIEDRICH PETERS September 19, 1813–July 18, 1890 BY WILLIAM SHEEHAN N THE MID-NINETEENTH century the discovery of new aster- Ioids was still far from routine. These objects had not yet grown so numerous as to earn for themselves the contemp- tuous label later applied, “vermin of the skies,” and those who excelled in claiming the starlike wanderers from the camouflage of background stars were honored with renown. Hind, de Gasparis, Goldschmidt, Chacornac, Pogson, and Peters were foremost among the early discoverers. Even on this short list C. H. F. Peters stood out. On May 29, 1861—just weeks after the American Civil War began at Fort Sumter—Peters discovered his first aster- oid (72 Feronia). It was the fifth asteroid discovered in North America (others had been found by Ferguson and Searle). Feronia was the first of forty-eight such discoveries that made Peters the most prolific finder of minor planets of his generation, and even today he remains second only to Johann Palisa among visual discoverers of asteroids. Dur- ing his colorful career, he also compiled meticulous star charts of the zodiac, collated observations from manuscripts of Ptolemy, and embroiled himself in a series of often bitter controversies with other astronomers, notably over the ex- istence of an intra-Mercurial planet. -
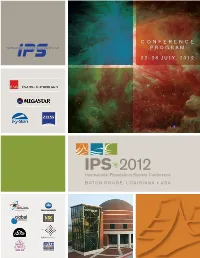
C O N F E R E N C E Program 22–26 July, 2012
CONFERENCE PROGRAM 22–26 JULY, 2012 International Planetarium Society Conference BATON ROUGE, LOUISIANA • USA 1 2 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Letter from Our Host 4 Letter from Our President 5 Contact Information 7 PROGRAM Speakers 10 Program Overview 12 Program 14 EXHIBITORS AND SPONSORS Sponsors 41 Exhibition Hall 42 Exhibitors & Sponsors 44 ABSTRACTS Panels 55 Papers 59 Posters 71 Workshops 75 PARTICIPANTS 79 3 Irene FROMW. Pennington PlanetariumOUR HOST Director’s Welcome Welcome to the 21st International Planetarium Society Conference in Baton Rouge! It is a pleasure to host IPS2012 and welcome you to Baton Rouge. All of us at the Irene W. Pennington Planetarium are excited to host this prestigious event. Baton Rouge has a rich and storied history with cultural roots from early Spanish, French and English settlements, and I hope you will take advantage of our cultural heritage by visiting some of our local attractions and experiencing our southern hospitality. The IPS Conference is the most important event of our profession and is a reflection of our society’s continued commitment to astronomy education, professional development and an international cultural exchange of ideas and hospitality. The conference theme is Bridge to New Beginnings, and I sincerely hope we will build new and enduring relationships and reach out across the globe to strengthen this commitment by what promises to be an exciting and rewarding week of paper, panel, poster, workshop and networking sessions, as well as visions of emerging technologies and new perspectives from our keynote speakers. Lagniappe (lan’-yap) is a Louisiana Cajun-French word for “something extra”. -

Ground-Based Surveys and the Asteroidfinder Mission
Ground-Based Surveys and the AsteroidFinder Mission DLR German Aerospace Center Institute of Space Systems, Bremen slide 1 Ground-Based Surveys & AsteroidFinder > AsteRisk @ obpsm > DLR RY-TY HB jtg > 28 Jun 2011 Overview (as seen from observatory code 005 ) a brief history of … visual telescopic searches photographic era surveys CCD era surveys the future surface vs space AsteroidFinder latest news … image: obspm slide 2 Ground-Based Surveys & AsteroidFinder > AsteRisk @ obpsm > DLR RY-TY HB jtg > 28 Jun 2011 planetary astronomy: a history of eyes, minds, and papers planets unveil themselves to the patient observer at night πλάνητες ἀστέρες planetes asteres wandering stars, or πλανήτοι planētoi wanderers 5 to the naked eye, since prehistory * 282287 to the telescope, so far ** when first discovered, a planetary object is a moving point source among stationary point sources has its location determined to within observational errors in only 3 of 4 dimensions, one of which is time naked eye: ~1' , seconds (Brahe, Kepler, 16th century) nowadays: m'' , nanoseconds & radar distance and line-of-sight velocity the 4th dimension can only be computed from follow-up observations over time continuously refining an orbit * Uranus and Vesta can be naked-eye objects – ** (282027) 5069 T-3 highest-numbered object as of 2011 Jun 17, + 8 planets, + 252 numbered comets image: Ian Pass via spaceweather.com slide 3 Ground-Based Surveys & AsteroidFinder > AsteRisk @ obpsm > DLR RY-TY HB jtg > 28 Jun 2011 motion in the noise floor: planet, star, or cosmics? search follow-up select a part of the sky expected pan with the expected motion of to yield a high flux of objects a discovered object revisit periodically, ≥3 exposures track as long as possible check for changes check for deviations filter for dots moving along a line refine orbit using reference stars slide 4 Ground-Based Surveys & AsteroidFinder > AsteRisk @ obpsm > DLR RY-TY HB jtg > 28 Jun 2011 the first survey: „Himmelspolizey“ – international and coordinated from the start based on J. -

NEAR EARTH ASTEROIDS (Neas) a CHRONOLOGY of MILESTONES 1800 - 2200
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE NEAR EARTH ASTEROIDS (NEAs) A CHRONOLOGY OF MILESTONES 1800 - 2200 8 July 2013 – version 41.0 on-line: www.iau.org/public/nea/ (completeness not pretended) INTRODUCTION Asteroids, or minor planets, are small and often irregularly shaped celestial bodies. The known majority of them orbit the Sun in the so-called main asteroid belt, between the orbits of the planets Mars and Jupiter. However, due to gravitational perturbations caused by planets as well as non- gravitational perturbations, a continuous migration brings main-belt asteroids closer to Sun, thus crossing the orbits of Mars, Earth, Venus and Mercury. An asteroid is coined a Near Earth Asteroid (NEA) when its trajectory brings it within 1.3 AU [Astronomical Unit; for units, see below in section Glossary and Units] from the Sun and hence within 0.3 AU of the Earth's orbit. The largest known NEA is 1036 Ganymed (1924 TD, H = 9.45 mag, D = 31.7 km, Po = 4.34 yr). A NEA is said to be a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) when its orbit comes to within 0.05 AU (= 19.5 LD [Lunar Distance] = 7.5 million km) of the Earth's orbit, the so-called Earth Minimum Orbit Intersection Distance (MOID), and has an absolute magnitude H < 22 mag (i.e., its diameter D > 140 m). The largest known PHA is 4179 Toutatis (1989 AC, H = 15.3 mag, D = 4.6×2.4×1.9 km, Po = 4.03 yr). As of 3 July 2013: - 903 NEAs (NEOWISE in the IR, 1 February 2011: 911) are known with D > 1000 m (H < 17.75 mag), i.e., 93 ± 4 % of an estimated population of 966 ± 45 NEAs (NEOWISE in the IR, 1 February 2011: 981 ± 19) (see: http://targetneo.jhuapl.edu/pdfs/sessions/TargetNEO-Session2-Harris.pdf, http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ApJ...743..156M), including 160 PHAs. -

Catalogue 178
JEFF WEBER RARE BOOKBOOKSSSS ··· 178178178 Los Angeles / Encinitas, California Wings of Imagination Catalogue 178 Muhammad Ali said, “The man who has no imagination has no wings.” The noted writer Zora Neale Hurston is described as one who rode on the “wings of imagination.” This is everything in both science and life. Here is a selection of books that celebrates man’s thought relating to the sciences. One of the most inspired was Newton. My copy of Newton’s Opticks, 1704, is traced to its original owner Dr. Charles Bernard, himself a member of the Royal Society, the book was sold at auction in 1711, reappeared in Edinburgh and bound for the university. The book was given as a student prize by Dr. Philip Kelland, also a Fellow of the Royal Society. Eventually the copy found its way to Washington [D.C.?] by 1915. Again it disappears until 1966 when it was owned by the bookseller Jake Zeitlin. There is nothing so inspiring to a collector than an important book, especially one with a history. Books bring one closer to inspiration, and that allows the mind to soar. 2014 [www.WEBERRAREBOOKS.COM] With more than 10,000 antiquarian books in the fields of science, medicine, Americana, classics, books on books, world travel and fore-edge paintings. Photos by e-mail on request. Our inventory is available for viewing by appointment. Terms are as usual. Shipping extra. RECENT CATALOGUES: 174: Visions of Scientific Imagination (303 items) 175: Medical Cabinet (152 items) 176: Revolutions in Science (469 items) 177: Sword & Pen (202 items) COVER: 830 Isaac Newton Jeff Weber J E F F W E B E R R A R E B O O K S PO Box 3368, Glendale, California 91221-0368 TELEPHONES: office: 323 – 344 – 9332; cell: 323 333-4140 FAX: 323-344-9267 e-mail: [email protected] 773.