Masterarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
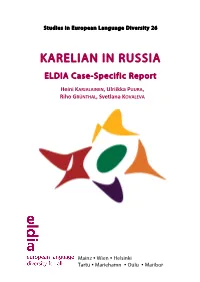
KARELIAN in RUSSIA ELDIA Case-Specific Report
Studies in European Language Diversity 26 KARELIAN IN RUSSIA ELDIA Case-Specific Report Heini KARJALAINEN, Ulriikka PUURA, Riho GRÜNTHAL, Svetlana KOVALEVA Mainz Wien Helsinki Tartu Mariehamn Oulu Maribor Studies in European Language Diversity is a peer-reviewed online publication series of the research project ELDIA, serving as an outlet for preliminary research findings, individual case studies, background and spin-off research. Editor-in-Chief Johanna Laakso (Wien) Editorial Board Kari Djerf (Helsinki), Riho Grünthal (Helsinki), Anna Kolláth (Maribor), Helle Metslang (Tartu), Karl Pajusalu (Tartu), Anneli Sarhimaa (Mainz), Sia Spiliopoulou Åkermark (Mariehamn), Helena Sulkala (Oulu), Reetta Toivanen (Helsinki) Publisher Research consortium ELDIA c/o Prof. Dr. Anneli Sarhimaa Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB) Johannes Gutenberg-Universität Mainz Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) D-55099 Mainz, Germany Contact: [email protected] © 2013 European Language Diversity for All (ELDIA) Cover design: Minna Pelkonen & Hajnalka Berényi-Kiss ELDIA is an international research project funded by the European Commission. The views expressed in the Studies in European Language Diversity are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Commission. All contents of the Studies in European Language Diversity are subject to the Austrian copyright law. The contents may be used exclusively for private, non- commercial purposes. Regarding any further uses of the Studies -

Novels, Histories, Novel Nations Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia
Novels, Histories, Novel Nations Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia Edited by Linda Kaljundi, Eneken Laanes and Ilona Pikkanen Studia Fennica Historica The Finnish Literature Society (SKS) was founded in 1831 and has, from the very beginning, engaged in publishing operations. It nowadays publishes literature in the fields of ethnology and folkloristics, linguistics, literary research and cultural history. The first volume of the Studia Fennica series appeared in 1933. Since 1992, the series has been divided into three thematic subseries: Ethnologica, Folkloristica and Linguistica. Two additional subseries were formed in 2002, Historica and Litteraria. The subseries Anthropologica was formed in 2007. In addition to its publishing activities, the Finnish Literature Society maintains research activities and infrastructures, an archive containing folklore and literary collections, a research library and promotes Finnish literature abroad. Studia fennica editorial board Pasi Ihalainen, Professor, University of Jyväskylä, Finland Timo Kaartinen, Title of Docent, Lecturer, University of Helsinki, Finland Taru Nordlund, Title of Docent, Lecturer, University of Helsinki, Finland Riikka Rossi, Title of Docent, Researcher, University of Helsinki, Finland Katriina Siivonen, Sunstitute Professor, University of Helsinki, Finland Lotte Tarkka, Professor, University of Helsinki, Finland Tuomas M. S. Lehtonen, Secretary General, Dr. Phil., Finnish Literature Society, Finland Tero Norkola, Publishing Director, Finnish Literature Society, Finland Maija Hakala, Secretary of the Board, Finnish Literature Society, Finland Editorial Office SKS P.O. Box 259 FI-00171 Helsinki www.finlit.fi Novels, Histories, Novel Nations Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia Edited by Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen Finnish Literature Society SKS • Helsinki Studia Fennica Historica 19 The publication has undergone a peer review. -
RMN Newsletter 7: Limited Sources, Boundless Possibilities 2013
The Retrospective Methods Network Newsletter Limited Sources, Boundless Possibilities Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts A special issue of RMN Newsletter Edited by Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki № 7 December 2013 RMN Newsletter is edited by Frog Helen F. Leslie and Joseph S. Hopkins Published by Folklore Studies / Dept. of Philosophy, History, Culture and Art Studies University of Helsinki, Helsinki 1 RMN Newsletter is a medium of contact and communication for members of the Retrospective Methods Network (RMN). The RMN is an open network which can include anyone who wishes to share in its focus. It is united by an interest in the problems, approaches, strategies and limitations related to considering some aspect of culture in one period through evidence from another, later period. Such comparisons range from investigating historical relationships to the utility of analogical parallels, and from comparisons across centuries to developing working models for the more immediate traditions behind limited sources. RMN Newsletter sets out to provide a venue and emergent discourse space in which individual scholars can discuss and engage in vital cross- disciplinary dialogue, present reports and announcements of their own current activities, and where information about events, projects and institutions is made available. RMN Newsletter is edited by Frog, Helen F. Leslie and Joseph S. Hopkins, published by Folklore Studies / Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies University of Helsinki PO Box 59 (Unioninkatu 38 A) 00014 University of Helsinki Finland The open-access electronic edition of this publication is available on-line at: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/ Limited Sources, Boundless Possibilities: Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts is a special thematic issue of the journal edited by Karina Lukin, Frog and Sakari Katajamäki. -

Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish
kaisa häkkinen Spreading the Written Word Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish Studia Fennica Linguistica THE FINNISH LITERATURE SOCIETY (SKS) was founded in 1831 and has, from the very beginning, engaged in publishing operations. It nowadays publishes literature in the fields of ethnology and folkloristics, linguistics, literary research and cultural history. The first volume of the Studia Fennica series appeared in 1933. Since 1992, the series has been divided into three thematic subseries: Ethnologica, Folkloristica and Linguistica. Two additional subseries were formed in 2002, Historica and Litteraria. The subseries Anthropologica was formed in 2007. In addition to its publishing activities, the Finnish Literature Society maintains research activities and infrastructures, an archive containing folklore and literary collections, a research library and promotes Finnish literature abroad. STUDIA FENNICA EDITORIAL BOARD Pasi Ihalainen, Professor, University of Jyväskylä, Finland Timo Kaartinen, Title of Docent, Lecturer, University of Helsinki, Finland Taru Nordlund, Title of Docent, Lecturer, University of Helsinki, Finland Riikka Rossi, Title of Docent, Researcher, University of Helsinki, Finland Katriina Siivonen, Substitute Professor, University of Helsinki, Finland Lotte Tarkka, Professor, University of Helsinki, Finland Tuomas M. S. Lehtonen, Secretary General, Dr. Phil., Finnish Literature Society, Finland Tero Norkola, Publishing Director, Finnish Literature Society, Finland Kati Romppanen, Secretary of the Board, Finnish Literature Society, Finland Editorial Office SKS P.O. Box 259 FI-00171 Helsinki www.finlit.fi K H Spreading the Written Word Mikael Agricola and the Birth of Literary Finnish Translated by Leonard Pearl Finnish Literature Society • SKS • Helsinki Studia Fennica Linguistica 19 The publication has undergone a peer review. The open access publication of this volume has received part funding via Helsinki University Library.