SWR2 Musikstunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beethoven's 250Th Birthday Music Room Objects
Beethoven’s 250th Birthday Music Room Objects Portrait of Beethoven (altered a bit for the festivities). This year we are celebrating the 250th birthday of the enduringly popular composer Ludwig van Beethoven who was born around December 17, 1770 (his baptism date). Beethoven never married, but there has been much speculation about whom he wrote the piece Für Elise. Two portraits on the wall are of women who are possible “candidates.” Portrait of Elisabeth Röckel. “According to a 2010 study by Klaus Martin Kopitz, there is evidence that the piece was written for the 17-year-old German soprano singer Elisabeth Röckel (1793–1883)... who played Florestan in the 1806 revival of Beethoven's opera Fidelio. "Elise", as she was called by a parish priest (later she called herself "Betty"), had been a friend of Beethoven's since 1808, who, according to Kopitz, perhaps wanted to marry her.” (from Wikipedia’s Für Elise entry) Portrait of Therese Malfatti. “Max Unger suggested that Ludwig Nohl may have transcribed the title incorrectly and the original work may have been named "Für Therese",[10] a reference to Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza (1792–1851). She was a friend and student of Beethoven's to whom he supposedly proposed in 1810.” (from Wikipedia’s Für Elise entry) Portrait of Daniel Steibelt. Steibelt was one of Europe's most renowned piano virtuosos, competed against Beethoven in an improvisation contest. “Steibelt, realising he was not only being comprehensively outplayed but humiliated, strode out of the room. Prince Lobkowitz hurried after him, returning a few moments later to say Steibelt had said he would never again set foot in Vienna as long as Beethoven lived there.” (from The man who dared to challenge Beethoven to a musical duel in Vienna) Beethoven’s Broadwood fortepiano. -
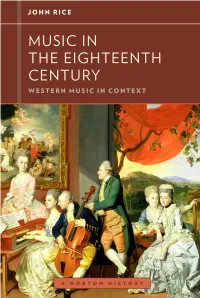
MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A. -

Haydn and Beethoven
23 Season 2018-2019 Thursday, February 28, at 7:30 The Philadelphia Orchestra Friday, March 1, at 2:00 Saturday, March 2, at 8:00 Nathalie Stutzmann Conductor Benjamin Grosvenor Piano Haydn Symphony No. 94 in G major (“Surprise”) I. Adagio cantabile—Vivace assai II. Andante III. Menuetto: Allegro molto IV. Allegro di molto Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15 I. Allegro con brio II. Largo III. Rondo: Allegro Intermission Beethoven Symphony No. 4 in B-flat major, Op. 60 I. Adagio—Allegro vivace II. Adagio III. Allegro vivace IV. Allegro ma non troppo This program runs approximately 2 hours. Philadelphia Orchestra concerts are broadcast on WRTI 90.1 FM on Sunday afternoons at 1 PM, and are repeated on Monday evenings at 7 PM on WRTI HD 2. Visit www.wrti.org to listen live or for more details. PO Book 27.indd 23 2/20/19 11:31 AM 24 PO Book 27.indd 24 2/20/19 11:31 AM 25 The Philadelphia Orchestra Jessica Griffin The Philadelphia Orchestra Philadelphia is home and orchestra, and maximizes is one of the preeminent the Orchestra continues impact through Research. orchestras in the world, to discover new and The Orchestra’s award- renowned for its distinctive inventive ways to nurture winning Collaborative sound, desired for its its relationship with its Learning programs engage keen ability to capture the loyal patrons at its home over 50,000 students, hearts and imaginations of in the Kimmel Center, families, and community audiences, and admired for and also with those who members through programs a legacy of imagination and enjoy the Orchestra’s area such as PlayINs, side-by- innovation on and off the performances at the Mann sides, PopUP concerts, concert stage. -

THE ALKAN SOCIETY Reg
THE ALKAN SOCIETY Reg. Charity No.276199 President: Ronald Smith Vice-Presidents: Robert Collet Nicholas King Hugh Macdonald Wilfrid Mellers Richard Shaw Roger Smalley John White Ron. Secretary: PETER GROVE 21 Reronswood, SALISBURY, Wilts. SP28DR Tel.0722-325771 BULLETIN NO.46 JUNE 1992 This bulletin concentrates mainly on new recordings. As I said last time, the number of Alkan recordings appearing on CD is encouraging, the more so when several contain excellent performances. Before reviewing them, may I apologise to any members who made a frustrating journey to hear Kevin Bowyer on 7th June. The date given in the last Bulletin was incorrect, and should have read 7tb July in Westminster Cathedral. His programme will include only a small amount of Alkan: the l0th and 11th Priéres from Op. 64. It is usually advisable to check dates with the venue concerned, and I thank the two members who took the trouble to telephone me about this recital. Sharp-eyed readers will have noticed the addition of three new names to our list of Vice-Presidents, and we thank them all for accepting the invitation so readily. Nicholas King has done much for the Society in playing and recording Alkan's organ works, and continues to be a most helpful contact at the Royal College of Music. Prof. Wilfrid Mellers contributed a great deal to the Centenary Festival with his opening lecture and wrote the progran1me notes for the memorable perforn1ance of the chamber music at the Wign1ore Hall on the actual anniversary of Alkan's death. His article for "Music and Musicians" in that year is reprinted later with his kind permission. -

First Movement of the Beethoven Third Piano Concerto: An
FIRST MOVEMENT OF THE BEETHOVEN THIRD PIANO CONCERTO: AN ARGUMENT FOR THE ALKAN CADENZA Yang Ding, B.M., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS May 2015 APPROVED: Pamela Mia Paul, Major Professor Clay Couturiaux, Committee Member Adam Wodnicki, Committee Member Steven Harlos, Chair of the Department of Keyboard Studies Benjamin Brand, Director of Graduate Studies in Music James C Scott, Dean of the College of Music Costas Tsatsoulis, Interim Dean of the Toulouse Graduate School Ding, Yang. First Movement of the Beethoven Third Piano Concerto: An Argument for the Alkan Cadenza. Doctor of Musical Arts (Performance), May 2015, 33 pp., 12 musical examples, bibliography, 41 titles. The goal of this dissertation is not only to introduce the unique cadenza by Alkan but also to offer an argument from the performer’s point of view, for why Alkan’s cadenza should be considered when there exists a cadenza by Beethoven himself, not to mention those by a number of other composers, both contemporaries of Beethoven and later. Information in reference to the brief history of the cadenza and the pianoforte in the time of Mozart and Beethoven is presented in Chapter 2. A brief bibliography about Alkan is presented in Chapter 3. Chapter 4 describes not only the cadenza in the era of Alkan, but also a comparison which is presented between Beethoven and Alkan's cadenzas. Examples of the keyboard range, dynamic contrast, use of pedal and alternating notes or octaves, and creative quote are presented in Chapter 4. In conclusion, the revival of Alkan's cadenza is mentioned, and the author's hope to promote the Alkan's cadenza is presented in Chapter 5. -

A Topical and Narrative Analysis of Napoleonic Era Battle Pieces
University of Northern Colorado Scholarship & Creative Works @ Digital UNC Master's Theses Student Research 5-2019 A Topical and Narrative Analysis of Napoleonic Era Battle Pieces Robert J. Gassner Follow this and additional works at: https://digscholarship.unco.edu/theses Recommended Citation Gassner, Robert J., "A Topical and Narrative Analysis of Napoleonic Era Battle Pieces" (2019). Master's Theses. 88. https://digscholarship.unco.edu/theses/88 This Text is brought to you for free and open access by the Student Research at Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO Greeley, Colorado The Graduate School A TOPICAL AND NARRATIVE ANALYSIS OF NAPOLEONIC ERA BATTLE PIECES A Thesis Submitted in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Music Robert J. Gassner College of Visual and Performing Arts Department of Music Music History and Literature May 2019 This Thesis by: Robert J. Gassner Entitled: A Topical and Narrative Analysis of Napoleonic Era Battle Pieces. has been approved as meeting the requirement for the Degree of Master of Music in the College of Visual and Performing Arts, Department of Music, Program of Music History and Literature Accepted by the Thesis Committee: _______________________________________________________ Dr. Jonathan Bellman, D.M.A., Advisor _______________________________________________________ Dr. Deborah Kauffman, D.M.A., Committee Member Accepted by the Graduate School ___________________________________________________________ Linda L. Black, Ed.D. Associate Provost and Dean Graduate School and International Admissions Research and Sponsored Projects ABSTRACT Gassner, Robert J. -

Download Booklet
Artist’s note AN OBBLIGATO SOUL LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) Beethoven and the violin sonata Violin Sonatas Nos. 1, 5 & 8 A few years ago, during a radio interview, Huw announced that he would like us to record a “I cannot write anything non-obbligato, for I Beethoven cycle together, much to my delight, came into this world with an obbligato soul”. and a little to my surprise. Beethoven has been at When Beethoven sent his Septet Op.20 to the Violin Sonata No. 1 in D major, Op. 12 No. 1 the heart of our recital programmes for the past publisher Hofmeister of Leipzig in December 1 I. Allegro con bio [9.28] dozen years or so, and in many ways, feels like 1800, he clearly felt the need to explain himself. 2 II. Tema con variazioni. Andante con moto [7.20] ‘home’. We want to share our love and our feeling He really shouldn’t have. The principle that 3 III. Rondo. Allegro [4.50] of closeness to Beethoven’s music with as many the separate parts in a chamber work were people as we can through our recordings, and we individual and necessary (obbligato) as opposed Violin Sonata No. 5 in F major, Op. 24 “Spring” hope its powerful, life-affirming spirit, its warmth, to optional (ad libitum) was widely established 4 I. Allegro [10.08] confidence, and noble beauty will bring as much by the time of Mozart’s final violin sonatas in the 5 II. Adagio molto espressivo [6.10] joy to our listeners as it brings to us. -

Le Pianiste: Parisian Music Journalism and the Politics of the Piano, 1833–35
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 Le Pianiste: Parisian Music Journalism and the Politics of the Piano, 1833–35 Shaena B. Weitz Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/760 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By SHAENA B. WEITZ A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York Graduate Center 2016 ii © 2016 SHAENA B. WEITZ All Rights Reserved iii LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By SHAENA B. WEITZ This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Musicology to satisfy the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy Janette Tilley ___________________ ____________________________________ Date Chair of Examining Committee Norman Carey ___________________ ____________________________________ Date Executive Officer Anne Stone Richard Kramer Dana Gooley Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iv Abstract LE PIANISTE: PARISIAN MUSIC JOURNALISM AND THE POLITICS OF THE PIANO, 1833–35 By Shaena B. Weitz Advisor: Anne Stone This dissertation examines the French music journal entitled Le Pianiste, published in Paris from 1833 to 1835. -

LESSON 2 Music Then and Now
6-8 GRADE LESSON 2 Music Then and Now SY DO MPH RA O O N L Y O C 2 S 50 YEA R 2019/20 EDUCATION PROGRAMS OF THE COLORADO SYMPHONY Bringing the youth concert experience and the story of Beethoven’s life through real-world topics 1 68 GRADE LESSON 2 Music Then and Now LESSON 2: Music Then and Now SUMMARY LEARNING OBJECTIVE In this lesson, students will investigate ■ Students will compare and contrast the current musical landscape to that of the Classical how and why the musical landscape and Romantic periods through a critical analysis. has simultaneously changed for both ■ Students will demonstrate the ability to listen with attention and purpose to at least the better and the worse. Students will two interpretations of the same excerpt from the rst movement of Beethoven’s Fifth examine how equity in terms of access Symphony before engaging in a whole-class dialogue to articulate the similarities and to music has evolved, in addition to di erences between the excerpts. tackling challenging ethical questions ■ addressing the di erence between cultural Students will analyze and unpack a Mark Twain quote. appropriation and cultural exchange, and ■ Independent Work Option #1: Students will develop 1-2 discussion questions in response what de nes originality and plagiarism. to an 18-minute video about the digital disruption of the music industry. ■ Independent Work Option #2: Students will read a New York Times article explaining the Williams v. Gaye court case and engage in a discourse about cultural appropriation and cultural exchange in relation to this case. -

Newslet T Er
6767 7 6 s s 6 s CIETY . O s 7 Ss F 7 . O s Cs R I 6 S . 6 s E U s I 7 G M s 7 s H . SECM 6 T Y s s 6 R E 7 E U s s N T 7 T N NEWSLETTER E s H s - C s s 6 6 7 7 6 6 7 Georgetown University SECM Inaugural Conference 30 April-2 May 2004 Stephen C. Fisher Our Society’s first conference, “Music in 18th-Century Life: from the period up to 1830 but also the compilation of an online Cities, Courts, Churches,” took place on the lovely campus of database for the genre at www.steglein.com. Mary Sue Morrow Georgetown University on a fine spring weekend. It was evident reported on plans to create a collaborative history of the early sym- from the beginning that the entire event was going to be a success; phony by enlisting some twenty scholars to pool their expertise not only were the individual presentations of unusually high qual- under her and Bathia Churgin’s supervision. This volume would ity, but in a specialized meeting they provided a context for each fill a gap in A. Peter Brown’s The Symphonic Repertoire, which was other that one would not encounter elsewhere, and the concentra- left a torso by Brown’s untimely death last year (of five projected tion of expertise in the audience led to some stimulating formal volumes, two were published and a third exists in draft, leaving the and informal discussions. -

CHAN 9418 FRONT COVER.Qxd 11/1/08 11:43 Am Page 1
CHAN 9418 FRONT COVER.qxd 11/1/08 11:43 am Page 1 Chan 9418 CHANDOS M USIC from the P USHKIN E POCH Alexander Bakhchiyev & Yelena Sorokina piano duo CHAN 9418 BOOK.qxd 11/1/08 11:44 am Page 2 Music from the Pushkin Epoch Piano music for three and four hands Ludwig Wilhelm Tepper von Ferguson (c. 1775–c. 1823) Sonata for four hands 11:28 AKG in D major • D-Dur • ré majeur 1 I Allegro con brio – 4:51 2 II Allegretto 6:37 John Field (1782–1837) 3 Rondeau for four hands, H. 43 6:22 in G major • G-Dur • sol majeur 4 Variations on a Russian Air for four hands, H. 10 4:53 in A minor • a-Moll • la mineur 5 Grand Waltz for four hands, H. 19 5:45 in A major • A-Dur • la majeur Johann Wilhelm Hässler (1747–1822) Grand Sonata for three hands 13:58 Daniel Steibelt in C major • C-Dur • ut majeur 6 I Allegro 4:17 7 II Un poco largo ed espressivo – 3:35 8 III Presto assai 6:03 3 CHAN 9418 BOOK.qxd 11/1/08 11:44 am Page 4 Daniel Steibelt (1765–1823) Sonata for four hands 6:26 Music from the Pushkin Epoch in F major • F-Dur • fa majeur 9 I Allegro 4:09 When Eugene Onegin ‘flies’ to the theatre in celebrate the marriage of his patron to 10 II Rondo: Allegretto non troppo 2:14 the seventeenth stanza of Alexander Pushkin’s Princess Elizabeth of Baden-Baden. -

Leonidas Kavakos, Violin Enrico Pace, Piano
CAL PERFORMANCES PRESENTS PROGRAM NOTES Sunday, February 17, 2013, 3pm Ludwig van Beethoven (1770–1827) he bested in competition Daniel Steibelt and Hertz Hall Sonata No. 1 in D major, Op. 12, No. 1 Joseph Wölffl, two of the town’s keyboard lumi- naries, he became all the rage among the gentry, Composed in 1798. who exhibited him in performance at the soirées in their elegant city palaces. In catering to the Leonidas Kavakos, violin In November 1792, the 22-year-old Ludwig van aristocratic audience, Beethoven took on the air Beethoven, bursting with talent and promise, of a dandy for a while, dressing in smart clothes, Enrico Pace, piano arrived in Vienna. So undeniable was the genius learning to dance (badly), buying a horse, and he had already demonstrated in a sizable amount even sporting a powdered wig. This phase of his of piano music, numerous chamber works, can- life did not outlast the 1790s, but in his biog- tatas on the death of Emperor Joseph II and raphy of the composer, Peter Latham described PROGRAM the accession of Leopold II, and the score for Beethoven at the time as “a young giant exult- a ballet, that Maximilian Franz, the Elector of ing in his strength and his success, and youthful Bonn, his hometown, underwrote the trip to the confidence gave him a buoyancy that was both Ludwig van Beethoven (1770–1827) Sonata No. 1 in D major, Op. 12, No. 1 (1798) Habsburg Imperial city, then the musical capi- attractive and infectious.” tal of Europe, to help further the young musi- Beethoven took some care during his first Allegro con brio cian’s career (and the Elector’s prestige).