„It's Still Real to Me, Damn
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Power Seeking and Backlash Against Female Politicians
Article Personality and Social Psychology Bulletin The Price of Power: Power Seeking and 36(7) 923 –936 © 2010 by the Society for Personality and Social Psychology, Inc Backlash Against Female Politicians Reprints and permission: sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0146167210371949 http://pspb.sagepub.com Tyler G. Okimoto1 and Victoria L. Brescoll1 Abstract Two experimental studies examined the effect of power-seeking intentions on backlash toward women in political office. It was hypothesized that a female politician’s career progress may be hindered by the belief that she seeks power, as this desire may violate prescribed communal expectations for women and thereby elicit interpersonal penalties. Results suggested that voting preferences for female candidates were negatively influenced by her power-seeking intentions (actual or perceived) but that preferences for male candidates were unaffected by power-seeking intentions. These differential reactions were partly explained by the perceived lack of communality implied by women’s power-seeking intentions, resulting in lower perceived competence and feelings of moral outrage. The presence of moral-emotional reactions suggests that backlash arises from the violation of communal prescriptions rather than normative deviations more generally. These findings illuminate one potential source of gender bias in politics. Keywords gender stereotypes, backlash, power, politics, intention, moral outrage Received June 5, 2009; revision accepted December 2, 2009 Many voters see Senator Hillary Rodham Clinton as coldly politicians and that these penalties may be reflected in voting ambitious, a perception that could ultimately doom her presi- preferences. dential campaign. Peter Nicholas, Los Angeles Times, 2007 Power-Relevant Stereotypes Power seeking may be incongruent with traditional female In 1916, Jeannette Rankin was elected to the Montana seat in gender stereotypes but not male gender stereotypes for a the U.S. -

Cancel Culture: Posthuman Hauntologies in Digital Rhetoric and the Latent Values of Virtual Community Networks
CANCEL CULTURE: POSTHUMAN HAUNTOLOGIES IN DIGITAL RHETORIC AND THE LATENT VALUES OF VIRTUAL COMMUNITY NETWORKS By Austin Michael Hooks Heather Palmer Rik Hunter Associate Professor of English Associate Professor of English (Chair) (Committee Member) Matthew Guy Associate Professor of English (Committee Member) CANCEL CULTURE: POSTHUMAN HAUNTOLOGIES IN DIGITAL RHETORIC AND THE LATENT VALUES OF VIRTUAL COMMUNITY NETWORKS By Austin Michael Hooks A Thesis Submitted to the Faculty of the University of Tennessee at Chattanooga in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of English The University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, Tennessee August 2020 ii Copyright © 2020 By Austin Michael Hooks All Rights Reserved iii ABSTRACT This study explores how modern epideictic practices enact latent community values by analyzing modern call-out culture, a form of public shaming that aims to hold individuals responsible for perceived politically incorrect behavior via social media, and cancel culture, a boycott of such behavior and a variant of call-out culture. As a result, this thesis is mainly concerned with the capacity of words, iterated within the archive of social media, to haunt us— both culturally and informatically. Through hauntology, this study hopes to understand a modern discourse community that is bound by an epideictic framework that specializes in the deconstruction of the individual’s ethos via the constant demonization and incitement of past, current, and possible social media expressions. The primary goal of this study is to understand how these practices function within a capitalistic framework and mirror the performativity of capital by reducing affective human interactions to that of a transaction. -

Here We Are at 500! the BRL’S 500 to Be Exact and What a Trip It Has Been
el Fans, here we are at 500! The BRL’s 500 to be exact and what a trip it has been. Imagibash 15 was a huge success and the action got so intense that your old pal the Teamster had to get involved. The exclusive coverage of that ppv is in this very issue so I won’t spoil it and give away the ending like how the ship sinks in Titanic. The Johnny B. Cup is down to just four and here are the representatives from each of the IWAR’s promotions; • BRL Final: Sir Gunther Kinderwacht (last year’s winner) • CWL Final: Jane the Vixen Red (BRL, winner of 2017 Unknown Wrestler League) • IWL Final: Nasty Norman Krasner • NWL Final: Ricky Kyle In one semi-final, we will see bitter rivals Kinderwacht and Red face off while in the other the red-hot Ricky Kyle will face the, well, Nasty Normal Krasner. One of these four will win The self-professed “Greatest Tag team wrestler the 4th Johnny B Cup and the results will determine the breakdown of the prizes. ? in the world” debuted in the NWL in 2012 and taunt-filled promos earned him many enemies. The 26th Marano Memorial is also down to the final 5… FIVE? Well since the Suburban Hell His “Teamster Challenge” offered a prize to any Savages: Agent 26 & Punk Rock Mike and Badd Co: Rick Challenger & Rick Riley went to a NWL rookie who could capture a Tag Team title draw, we will have a rematch. The winner will advance to face Sledge and Hammer who won with him, but turned ugly when he kept blaming the CWL bracket. -

The Popular Culture Studies Journal
THE POPULAR CULTURE STUDIES JOURNAL VOLUME 6 NUMBER 1 2018 Editor NORMA JONES Liquid Flicks Media, Inc./IXMachine Managing Editor JULIA LARGENT McPherson College Assistant Editor GARRET L. CASTLEBERRY Mid-America Christian University Copy Editor Kevin Calcamp Queens University of Charlotte Reviews Editor MALYNNDA JOHNSON Indiana State University Assistant Reviews Editor JESSICA BENHAM University of Pittsburgh Please visit the PCSJ at: http://mpcaaca.org/the-popular-culture- studies-journal/ The Popular Culture Studies Journal is the official journal of the Midwest Popular and American Culture Association. Copyright © 2018 Midwest Popular and American Culture Association. All rights reserved. MPCA/ACA, 421 W. Huron St Unit 1304, Chicago, IL 60654 Cover credit: Cover Artwork: “Wrestling” by Brent Jones © 2018 Courtesy of https://openclipart.org EDITORIAL ADVISORY BOARD ANTHONY ADAH FALON DEIMLER Minnesota State University, Moorhead University of Wisconsin-Madison JESSICA AUSTIN HANNAH DODD Anglia Ruskin University The Ohio State University AARON BARLOW ASHLEY M. DONNELLY New York City College of Technology (CUNY) Ball State University Faculty Editor, Academe, the magazine of the AAUP JOSEF BENSON LEIGH H. EDWARDS University of Wisconsin Parkside Florida State University PAUL BOOTH VICTOR EVANS DePaul University Seattle University GARY BURNS JUSTIN GARCIA Northern Illinois University Millersville University KELLI S. BURNS ALEXANDRA GARNER University of South Florida Bowling Green State University ANNE M. CANAVAN MATTHEW HALE Salt Lake Community College Indiana University, Bloomington ERIN MAE CLARK NICOLE HAMMOND Saint Mary’s University of Minnesota University of California, Santa Cruz BRIAN COGAN ART HERBIG Molloy College Indiana University - Purdue University, Fort Wayne JARED JOHNSON ANDREW F. HERRMANN Thiel College East Tennessee State University JESSE KAVADLO MATTHEW NICOSIA Maryville University of St. -

Professional Wrestling, Sports Entertainment and the Liminal Experience in American Culture
PROFESSIONAL WRESTLING, SPORTS ENTERTAINMENT AND THE LIMINAL EXPERIENCE IN AMERICAN CULTURE By AARON D, FEIGENBAUM A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2000 Copyright 2000 by Aaron D. Feigenbaum ACKNOWLEDGMENTS There are many people who have helped me along the way, and I would like to express my appreciation to all of them. I would like to begin by thanking the members of my committee - Dr. Heather Gibson, Dr. Amitava Kumar, Dr. Norman Market, and Dr. Anthony Oliver-Smith - for all their help. I especially would like to thank my Chair, Dr. John Moore, for encouraging me to pursue my chosen field of study, guiding me in the right direction, and providing invaluable advice and encouragement. Others at the University of Florida who helped me in a variety of ways include Heather Hall, Jocelyn Shell, Jim Kunetz, and Farshid Safi. I would also like to thank Dr. Winnie Cooke and all my friends from the Teaching Center and Athletic Association for putting up with me the past few years. From the World Wrestling Federation, I would like to thank Vince McMahon, Jr., and Jim Byrne for taking the time to answer my questions and allowing me access to the World Wrestling Federation. A very special thanks goes out to Laura Bryson who provided so much help in many ways. I would like to thank Ed Garea and Paul MacArthur for answering my questions on both the history of professional wrestling and the current sports entertainment product. -
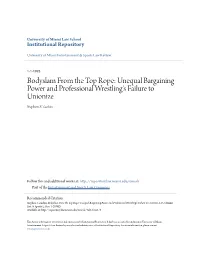
Bodyslam from the Top Rope: Unequal Bargaining Power and Professional Wrestling's Failure to Unionize Stephen S
University of Miami Law School Institutional Repository University of Miami Entertainment & Sports Law Review 1-1-1995 Bodyslam From the Top Rope: Unequal Bargaining Power and Professional Wrestling's Failure to Unionize Stephen S. Zashin Follow this and additional works at: http://repository.law.miami.edu/umeslr Part of the Entertainment and Sports Law Commons Recommended Citation Stephen S. Zashin, Bodyslam From the Top Rope: Unequal Bargaining Power and Professional Wrestling's Failure to Unionize, 12 U. Miami Ent. & Sports L. Rev. 1 (1995) Available at: http://repository.law.miami.edu/umeslr/vol12/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in University of Miami Entertainment & Sports Law Review by an authorized administrator of Institutional Repository. For more information, please contact [email protected]. Zashin: Bodyslam From the Top Rope: Unequal Bargaining Power and Professi UNIVERSITY OF MIAMI ENTERTAINMENT & SPORTS LAW REVIEW ARTICLES BODYSLAM FROM THE TOP ROPE: UNEQUAL BARGAINING POWER AND PROFESSIONAL WRESTLING'S FAILURE TO UNIONIZE STEPHEN S. ZASHIN* Wrestlers are a sluggish set, and of dubious health. They sleep out their lives, and whenever they depart ever so little from their regular diet they fall seriously ill. Plato, Republic, III I don't give a damn if it's fake! Kill the son-of-a-bitch! An Unknown Wrestling Fan The lights go black and the crowd roars in anticipation. Light emanates only from the scattered popping flash-bulbs. As the frenzy grows to a crescendo, Also Sprach Zarathustra' pierces the crowd's noise. -

The Evolution of Feminist and Institutional Activism Against Sexual Violence
Bethany Gen In the Shadow of the Carceral State: The Evolution of Feminist and Institutional Activism Against Sexual Violence Bethany Gen Honors Thesis in Politics Advisor: David Forrest Readers: Kristina Mani and Cortney Smith Oberlin College Spring 2021 Gen 2 “It is not possible to accurately assess the risks of engaging with the state on a specific issue like violence against women without fully appreciating the larger processes that created this particular state and the particular social movements swirling around it. In short, the state and social movements need to be institutionally and historically demystified. Failure to do so means that feminists and others will misjudge what the costs of engaging with the state are for women in particular, and for society more broadly, in the shadow of the carceral state.” Marie Gottschalk, The Prison and the Gallows: The Politics of Mass Incarceration in America, p. 164 ~ Acknowledgements A huge thank you to my advisor, David Forrest, whose interest, support, and feedback was invaluable. Thank you to my readers, Kristina Mani and Cortney Smith, for their time and commitment. Thank you to Xander Kott for countless weekly meetings, as well as to the other members of the Politics Honors seminar, Hannah Scholl, Gideon Leek, Cameron Avery, Marah Ajilat, for your thoughtful feedback and camaraderie. Thank you to Michael Parkin for leading the seminar and providing helpful feedback and practical advice. Thank you to my roommates, Sarah Edwards, Zoe Guiney, and Lucy Fredell, for being the best people to be quarantined with amidst a global pandemic. Thank you to Leo Ross for providing the initial inspiration and encouragement for me to begin this journey, almost two years ago. -

Lovetoawhores-Daughter.Pdf
Love to a Whore’s Daughter Life and faith through the lens of grace and redemption LISA F. BARNES Cover and layout design by Adriana Rivera Love to a Whore’s Daughter Life and faith through the lens of grace and redemption Lisa F. Barnes 2015 Frontier Press Cover and layout design by Adriana Rivera All rights reserved. Except for fair dealing permitted under the Copyright Act, no part of this book may be reproduced by any means without written permission from the publisher. Scripture quotations marked (NIV) are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Scripture quotations marked (MSG) are taken from THE MESSAGE. Copyright © by Eugene H. Pe- terson 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc. Scripture quotations marked (ESV) are taken from The Holy Bible, English Standard Version® (ESV®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved. Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copy- right ©1996, 2004, 2007, 2013 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved. Scripture quotations marked (TLB) are taken from The Living Bible copyright © 1971. Used by permission of Tyndale House Publishers, Inc., Carol Stream, Illinois 60188. -

Próba Określenia Istoty I Kulturowego Znaczenia Profesjonalnego Wrestlingu1 Joanna
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL) Załącznik Kulturoznawczy 5/2018 aneKs „WspółcZeśni gladiatorZy” „WspółcZeśni gladiatorZy”. próBa oKreślenia istoty i KulturoWego ZnacZenia profesjonalnego Wrestlingu1 joanna joanna Biernacik Biernacik [email protected] Prolog – gladiaTorzY na pograniczu śWiaTÓW Fałszywy sport. Prostacki teatr. Udawanie bólu za wielkie pieniądze. Zapasy profesjonalne, potocznie zwane po prostu wrestlingiem, choć śledzone przez miliony osób na całym świecie, wciąż wzbudzają kontrowersje wśród przypadkowych odbiorców. Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia istoty i kulturowego znaczenia tego pozornie nieskomplikowanego sportu. Jak zauważa Dariusz Kosiński, widowiska sportowe często są lekceważone i marginalizowane jako potencjalny przedmiot badań, sprowadzane do roli czczej rozrywki i bezproduktywnej zabawy2. Przekonanie to wydaje się wypływać z ignorowania faktu, iż są one istotną częścią życia społecznego. Kosiński postrzega sport jako „najpełniejszą reprezentację współczesnej kultury światowej”3, stanowiącą „najpełniejszy, najbardziej precyzyjny w swojej złożoności metakomentarz dotyczący jej podstawowych wartości, znaczeń i sposobów działania”4. Dziedzinę, która zawiera w sobie złożoną płaszczyznę performatywną – co badacz ukazuje na przykładzie meczu piłki nożnej. Skoro Kosiński postuluje ustanowienie sportu jako dziedziny 1 Artykuł stanowi przeredagowaną wersję rozprawy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i obronionej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w 2017 roku. 2 D. Kosiński, Performatyka i dramatologia sportu. Próba przewrotki teore- tycznej, „Kultura Współczesna” 2017, nr 1, s. 15. 3 Ibidem, s. 16. 4 Ibidem. ▪ www.zalacznik.uksw.edu.pl 353 joanna BiernaciK centralnej dla badań z zakresu performatyki, warto zatem przyjrzeć się także profesjonalnemu wrestlingowi5 – dyscyplinie wciąż w Polsce mało znanej, jednakże wartej opisania, łączącej w sobie cechy zarówno widowisk sportowych, jak i teatralnego performansu. -

Ecw One Night Stand 2005 Part 1
Ecw one night stand 2005 part 1 Watch the video «xsr07t_wwe-one-night-standpart-2_sport» uploaded by Sanny on Dailymotion. Watch the video «xsr67g_wwe-one-night- standpart-4_sport» uploaded by Sanny on Dailymotion. Watch the video «xsr4o9_wwe-one-night-standpart-3_sport» uploaded by Sanny on Dailymotion. ECW One Night Stand Vince Martinez. Loading. WWE RAW () - Eric Bischoff's ECW. Description ECW TV AD ECW One Night Stand commercial WWE RAW () - Eric. WWE RAW () - Eric Bischoff's ECW Funeral (Part 1) - Duration: WrestleParadise , ECW One Night Stand () was a professional wrestling pay-per-view (PPV) event produced 1 Production; 2 Background; 3 Event; 4 Results; 5 See also; 6 References; 7 External links promotion, that he would be part of the WWE invasion of One Night Stand, and that he would take SmackDown! volunteers with him. Гледай E.c.w. One Night Stand part1, видео качено от swat_omfg. Vbox7 – твоето любимо място за видео забавление! one-night-stand-full-movie-part adli mezmunu mp3 ve video formatinda yükleye biləcəyiniz ECW One Night Stand - OSW Review #3 free download. Watch ECW One Night Stand PPVSTREAMIN (HIGH QUALITY)WATCH FULL SHOWCLOUDTIME (HIGH QUALITY)WATCH FULL. Sport · The stars of Extreme Championship Wrestling reunite to celebrate the promotion's history Tommy Dreamer in ECW One Night Stand () Steve Austin and Yoshihiro Tajiri in ECW One Night Stand () · 19 photos | 1 video | 15 news articles». Long before WWE made Extreme Rules a part of its annual June ECW One Night Stand was certainly not a very heavily promoted. Turn on 1-Click ordering for this browser . -

University Micrcjfilms International 300 N
INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of "sectioning" the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand corner of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. -

The Oral Poetics of Professional Wrestling, Or Laying the Smackdown on Homer
Oral Tradition, 29/1 (201X): 127-148 The Oral Poetics of Professional Wrestling, or Laying the Smackdown on Homer William Duffy Since its development in the first half of the twentieth century, Milman Parry and Albert Lord’s theory of “composition in performance” has been central to the study of oral poetry (J. M. Foley 1998:ix-x). This theory and others based on it have been used in the analysis of poetic traditions like those of the West African griots, the Viking skalds, and, most famously, the ancient Greek epics.1 However, scholars have rarely applied Parry-Lord theory to material other than oral poetry, with the notable exceptions of musical forms like jazz, African drumming, and freestyle rap.2 Parry and Lord themselves, on the other hand, referred to the works they catalogued as performances, making it possible to use their ideas beyond poetry and music. The usefulness of Parry-Lord theory in studies of different poetic traditions tempted me to view other genres of performance from this perspective. In this paper I offer up one such genre for analysis —professional wrestling—and show that interpreting the tropes of wrestling through the lens of composition in performance provides information that, in return, can help with analysis of materials more commonly addressed by this theory. Before beginning this effort, it will be useful to identify the qualities that a work must possess to be considered a “composition in performance,” in order to see if professional wrestling qualifies. The first, and probably most important and straightforward, criterion is that, as Lord (1960:13) says, “the moment of composition is the performance.” This disqualifies art forms like theater and ballet, works typically planned in advance and containing words and/or actions that must be performed at precise times and following a precise order.