Smart Satellite City Deutschlandsberg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CE/CL/Annex IV/En 1 ANNEX IV AGREEMENT on SANITARY AND
549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Englische Anhänge 4 (Normativer Teil) 1 von 825 ANNEX IV AGREEMENT ON SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES APPLICABLE TO TRADE IN ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS, PLANTS, PLANT PRODUCTS AND OTHER GOODS AND ANIMAL WELFARE (Referred to in Article 89(2) of the Association Agreement) THE PARTIES, as defined in Article 197 of the Association Agreement: DESIRING to facilitate trade between the Community and Chile in animals and animal products, plants, plant products and other goods, whilst safeguarding public, animal and plant health; CONSIDERING that the implementation of this Agreement is to take place in accordance with the internal procedures and legislative processes of the Parties; CONSIDERING that recognition of equivalence will be gradual and progressive and should apply to priority sectors; CE/CL/Annex IV/en 1 2 von 825 549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Englische Anhänge 4 (Normativer Teil) CONSIDERING that one of the objectives of Part IV, Title I of the Association Agreement is to liberalise trade in goods in accordance with the GATT 1994 progressively and reciprocally; REAFFIRMING their rights and obligations under the WTO Agreement and its Annexes and in particular the SPS Agreement; DESIRING to ensure full transparency as regards sanitary, phytosanitary measures applicable to trade, to have a common understanding of the WTO SPS Agreement and to implement its principles and provisions; RESOLVED to take the fullest account of the risk of spread of animal infections, diseases and pests and of the measures put in place to control and eradicate such infections, diseases and pests, to protect public, animal and plant health while avoiding unnecessary disruptions to trade; WHEREAS, given the importance of animal welfare, with the aim of developing animal welfare standards and given its relation with veterinary matters, it is appropriate to include this issue in this Agreement and to examine animal welfare standards taking into account the development in the competent international standards organisations. -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21
Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

Ergebnis-Archiv 18
ERGEBNIS-ARCHIV 18. WelschLauf 2012 Ergebnisliste Marathon - 42,2k - nach Zeit sortiert 2012-05-05 Seite 1 Rang Stnr Name Jg. Nat. Verein/Ort Altersklasse KRg. Brutto/Rg. Netto 1 86 Kabicher Michael 85 AUT grsports.at Männer 1 2:54:10/1. 2:54:10 2 5 Kumpusch Vinzenz 76 AUT Stefflhof Adventures Männer 2 2:55:44/2. 2:55:43 3 236 Lilek David 85 AUT LCA Hochschwab Männer 3 2:59:55/3. 2:59:52 4 4 Achten Jörg 71 GER Stefflhof Adventures Männer 4 3:01:21/4. 3:01:21 5 3 Kleineberg Christian 74 AUT Stefflhof Adventures Männer 5 3:02:56/5. 3:02:54 6 122 Trenkwalder Norbert 80 AUT Graz Männer 6 3:04:27/6. 3:04:24 7 222 Hofbauer Chris 65 GER TV Altötting Männer 7 3:08:10/7. 3:08:08 8 131 Krenn Walter 67 AUT LCA Hochschwab Männer 8 3:09:03/8. 3:08:59 9 18 Krump Franz, Dr. 75 AUT 99ers Mödling Männer 9 3:09:18/9. 3:09:14 10 29 Mai Alexander 77 AUT Langmann & Partner Powerteam Männer 10 3:11:10/10. 3:11:08 11 210 Koller Otto 56 AUT LCA Hochschwab Männer 11 3:14:06/11. 3:14:05 12 289 Teufl Peter 79 AUT Run4smile Männer 12 3:15:26/12. 3:15:25 13 85 Weissenböck-Meerkatz Armin 71 AUT HSV Marathon Wr. Neustadt Männer 13 3:15:45/13. 3:15:43 14 77 Bernhart Markus 74 AUT Stefflhof Adventures Männer 14 3:18:06/14. -

Stadtmagazin 1/2016
DEUTSCHLANDSBERG 08Z037783P AUSGABE 1/2016 P.B.B. Neu in der Stadt • Ein klares Bekenntnis zum Hauptplatz • Frühling macht Lust auf Garten • Angebote für junge (werdende) Mütter/Eltern• Chöre unserer Stadt • Veranstaltungskalender • Schulen berichten • 22. Klavierfrühling • Steirische Meisterin kommt aus Deutschlandsberg • u. v. m. GEMEINDE-INFO Neu in der Stadt 4 Voranschlag für das Haushaltsjahr 2016 5 Neugegründete Kleinregion | Neue Gemeinderätin 5 Ein klares Bekenntnis zum Hauptplatz 6 Vom Brot bis zur Glühbirne 6 Einkaufsgutschein: Erfolg auf ganzer Linie 8 Ostern am Hauptplatz; Stadt- und Kinderflohmarkt 9 Bürgerservice 10 Karantanischer Lichtstein in der Pfarrkirche Osterwitz 11 UMWELT Sperrmüll- und Problemstoffentsorgung 12 Nie mehr Abfuhrtermine vergessen! 12 Halten Sie unsere Bäche sauber! 12 Initiativ für Österreich 2025 13 Verkehrssicherungspflicht 14 Baum-, Strauch- und Heckenschnittabholung 15 Frühling macht Lust auf Garten 16 GESELLSCHAFT & Was versteht man unter dem Mietzins? 17 GESUNDHEIT Angebote für junge (werdende) Mütter/Eltern 18 Kampf gegen das Vergessen 21 Bewegungsprogramm Jackpot – Projektstart 21 Philatelistenverein – Erfolge der Jugendgruppe 22 Frisch und munter in den Frühling 23 JUGEND & WIKI Kinderkrippe Bad Gams; Kindergarten Kloster 24 BILDUNG KG/VS Trahütten; Kinderlandsberg 25 Volksschulen berichten 26 Sommerbetreuung für Volksschüler 26 FS Schloss Frauenthal 27 NMS 1 und NMS 2 28 Veranstaltungskalender zum Herausnehmen 30 Musikschulen berichten 32 Jugend engagiert sich | Du suchst einen Lehrplatz? 33 KULTUR Verschiedene Veranstaltungstipps 34 theaterzentrum: Programmvorschau; Treffpunkt Lyrik 35 22. Deutschlandsberger Klavierfrühling 36 Chöre unserer Stadt stellen sich vor 38 Volksmusikseminar 39 SPORT & FREIZEIT Naturfreunde: Pistenspaß 40 Leichtathletik: Steir. Meisterin kommt aus Deutschlandsberg 41 Handballclub JUFA-Deutschlandsberg 43 SEITENBLICKE 44 BUNT GEMISCHT in Deutschlandsberg 50 IMPRESSUM: Magazin der Stadtgemeinde Deutschlandsberg. -
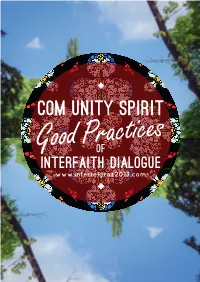
Good Practices of Interfaith Dialogue
Com Unity Spirit s Good PracticeOF Interfaith Dialogue www.interrelgraz2013.com COM UNITY SPIRIT GOOD PRACTICES OF INTERFAITH DIALOGUE This is a collection of 50 of Good Practice examples recommended by the participants of the “Interreligious Conference Graz 2013 ComUnitySpirit”, which have already been implemented in different countries and settings. This collection serves as an illustrative “snapshot” taken at the time of the Interreligious Conference and no claim is made with regard to its completeness. 1 Bad Gams/ Graz, Austria: “FrOM ALL FOUR POINTS OF THE COMPASs” (Recommended by Inge Brenner) In May 2013, the Jewish Community Graz and the Buddhist Centre Bad Gams jointly invited an interested audience to the Graz Synagogue for a reading of parables of different religions. The actor Daniel Doujenis narrated parables and traditions of some of the world’s major religions – Judaism, Buddhism, Christianity, Islam as well as the Bahà’I faith. A reading tour for the young and the young at heart inspired by the religious cultures and musically accentuated by Stefan Heckel on the accordion. Contact: Inge Brenner ([email protected]) 2 Berlin, Germany: “BeRLIN DIALOGUE OF THE RELIGIOns” (Recommended by Anika Sendes) The Dialogue of the Religions, initially recommended by the mayor of Berlin and first implemented in 2011, is multilayered and includes a wide range of activities from events at the neighborhood community level, the so called “Kiez”, to cross-district partnerships and even Berlin-wide initiatives. Interfaith Dialogue can be initiated by all stakeholders involved: the leadership level of the religious communities, public institutions, multiplicators as well as the individual believer. -
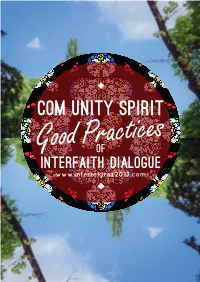
Com Unity Spirit S Good Practiceof Interfaith Dialogue Com Unity Spirit Good Practices
Com Unity Spirit s Good PracticeOF Interfaith Dialogue www.interrelgraz2013.com COM UNITY SPIRIT GOOD PRACTICES OF INTERFAITH DIALOGUE This is a collection of 50 of Good Practice examples recommended by the participants of the “Interreligious Conference Graz 2013 ComUnitySpirit”, which have already been implemented in different countries and settings. This collection serves as an illustrative “snapshot” taken at the time of the Interreligious Conference and no claim is made with regard to its completeness. 1 Bad Gams/ Graz, Austria: “FrOM ALL FOUR POINTS OF THE COMPASs” (Recommended by Inge Brenner) In May 2013, the Jewish Community Graz and the Buddhist Centre Bad Gams jointly invited an interested audience to the Graz Synagogue for a reading of parables of different religions. The actor Daniel Doujenis narrated parables and traditions of some of the world’s major religions – Judaism, Buddhism, Christianity, Islam as well as the Bahà’I faith. A reading tour for the young and the young at heart inspired by the religious cultures and musically accentuated by Stefan Heckel on the accordion. Contact: Inge Brenner ([email protected]) 2 Berlin, Germany: “BeRLIN DIALOGUE OF THE RELIGIOns” (Recommended by Anika Sendes) The Dialogue of the Religions, initially recommended by the mayor of Berlin and first implemented in 2011, is multilayered and includes a wide range of activities from events at the neighborhood community level, the so called “Kiez”, to cross-district partnerships and even Berlin-wide initiatives. Interfaith Dialogue can be initiated by all stakeholders involved: the leadership level of the religious communities, public institutions, multiplicators as well as the individual believer. -

20. Int. Wachaumarathon 2017 Ergebnisliste Halbmarathon - 21.097M - Nach Zeit Sortiert 2017-09-17 Seite 1
20. Int. WACHAUmarathon 2017 Ergebnisliste Halbmarathon - 21.097m - nach Zeit sortiert 2017-09-17 Seite 1 Rang Stnr Name Jg. Nat. Verein/Ort Altersklasse KRg. 0-7.6k 7.6k-12.1k 12.1-21.1k Brutto/Rg. Netto 1 1 Kirui Peter 88 KEN Volare Sports M-Elite 1 0:21:19 0:13:11 0:26:14 1:00:45/2. 1:00:45 2 6 Cheruiyot Wilson 87 KEN Run2gether M-Elite 2 0:21:19 0:13:11 0:26:32 1:01:03/3. 1:01:03 3 5 Kimaiyo Hillary 94 KEN Zsolt Benedek M-Elite 3 0:21:32 0:13:24 0:26:08 1:01:05/4. 1:01:05 4 3 Bett Benard 93 KEN Run2gether M-Elite 4 0:21:22 0:13:26 0:27:00 1:01:49/5. 1:01:49 5 2 Lobuwan Luka 88 KEN Runfast M-Elite 5 0:21:31 0:13:28 0:27:23 1:02:24/6. 1:02:24 6 7 Maritim Philimon 88 KEN Run2gether M-Elite 6 0:21:39 0:14:05 0:27:58 1:03:43/7. 1:03:43 7 9 Kipserem Douglas 90 KEN Run2gether M-Elite 7 0:21:39 0:14:22 0:28:13 1:04:16/8. 1:04:16 8 14 Kirui Robert 90 KEN Run2gether M-Elite 8 0:22:16 0:14:36 0:28:07 1:05:01/9. 1:05:01 9 8 Steinhammer Christian 88 AUT USKO Melk M-Elite 9 0:23:12 0:14:17 0:27:59 1:05:31/10.