Linux - Installation Und Erste Schritte 15.-16
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pris for Fremme Av Fri Programvare I Norge 2002
NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare i Norge 2002 Sted: Høgskolen i Oslo, Festsalen, Anna Sethnes hus Dato: 7. oktober 2002 Tid: 17:00 Prisen for fremme av fri programvare For første gang i Norge deles det ut en Fri programvare pris for fri programvare, dvs programvare hvor Hva er fri programvare? Fri programvare er brukerne har fullt innsyn og kontroll. Fri programvare laget med fullt innsyn for alle. programvare er mest kjent gjennom operativ- Brukere st˚arfritt til ˚abenytte programvaren systemet Linux som gir en enorm base med som de vil og s˚amye de vil, og de f˚ar tilgang til programvare som er rimelig ˚ata i bruk – og kildekoden, slik at eventuelle feil raskere opp- som lastes ned helt gratis fra Internett. dages og fikses, og forbedringer kan program- Prisen er et stipend p˚a30.000 kroner i meres av brukere selv. Programvaren er oftest stipend fra NUUG pluss diplom og vase fra gratis, og leverandører tjener heller penger gjen- Høgskolen i Oslo. Den g˚ar til prosjekter eller nom brukerstøtte og opplæring. personer i henhold til utvalgskriteriene som Fri programvare er miljøskapende og har ble vedtatt av NUUG-styret 13. mai 2002. b˚adepedagogiske og praktiske fordeler for de Prisen deles ut p˚aet arrangement ved Høg- involverte. Fri programvare gir ofte en inngangs- skolen i Oslo mandag 7. oktober kl.17.00. Ut- billett til “cutting edge”-teknologi, og fører til valgskriteriene lyder: stabile, kvalitetssikrede systemer gjennom en Prisen g˚artil en person eller en “peer review”, det vil si kritisk gjennomsyn gruppe i Norge som har bidratt til av koden av andre programmerere. -

Pris for Fremme Av Fri Programvare I Norge 2004
NUUG og HiOs Pris for fremme av fri programvare i Norge 2004 Sted: Høgskolen i Oslo, Festsalen, Anna Sethnes hus Dato: 12. oktober 2004 Tid: 17:00 Prisen for fremme av fri programvare For tredje gang i Norge deles det ut en Fri programvare pris for fri programvare, dvs programvare hvor Hva er fri programvare? Fri programvare er brukerne har fullt innsyn og kontroll. Fri programvare laget med fullt innsyn for alle. programvare er mest kjent gjennom operativ- Brukere st˚arfritt til ˚abenytte programvaren systemet Linux som gir en enorm base med som de vil og s˚amye de vil, og de f˚ar tilgang til programvare som er rimelig ˚ata i bruk – og kildekoden, slik at eventuelle feil raskere opp- som lastes ned helt gratis fra Internett. dages og fikses, og forbedringer kan program- Prisen er et stipend p˚a30.000 kroner i meres av brukere selv. Programvaren er oftest stipend fra NUUG pluss diplom og vase fra gratis, og leverandører tjener heller penger gjen- Høgskolen i Oslo. Den g˚ar til prosjekter eller nom brukerstøtte og opplæring. personer i henhold til utvalgskriteriene som Fri programvare er miljøskapende og har ble vedtatt av NUUG-styret 13. mai 2002. b˚adepedagogiske og praktiske fordeler for de Prisen deles ut p˚aet arrangement ved Høg- involverte. Fri programvare gir ofte en inngangs- skolen i Oslo tirsdag 12. oktober kl.17.00. Ut- billett til “cutting edge”-teknologi, og fører til valgskriteriene lyder: stabile, kvalitetssikrede systemer gjennom en Prisen g˚artil en person eller en fagfellevurdering, det vil si at andre program- gruppe i Norge som har bidratt til merere gir kildekoden kritisk gjennomsyn. -
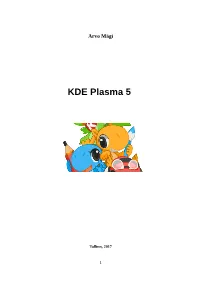
KDE Plasma 5
Arvo Mägi KDE Plasma 5 Tallinn, 2017 1 Sissejuhatus KDE töökeskkonnale pani aluse saksa programmeerija Matthias Ettrich 14.10.1996. 2016. a oktoobris sai populaarne KDE seega 20. aastaseks. Hea ülevaate KDE ajaloost annab artikkel „19 Years of KDE History: Step by Step.” KDE 4.14 ilmumisega oli KDE saavutanud kasutusküpsuse, kuid edasine areng kippus takerduma – vaja oli põhimõttelisi uuendusi. Otsustati võtta kasutusele iseseisvatel moodulitel põhinev KDE 5 arhitektuur – Qt/Frameworks. Kõik KDE rakendusprogrammid, sh Plasma 5 töölaud, kasutavad ainult konkreetse rakenduse jaoks vajalikke mooduleid. Varem kasutati kõigi rakenduste jaoks ühist suurt teeki, mis raskendas muudatuste tegemist ja pidurdas arendustööd. Qt on C++ programmeerimiskeskkond. Pikaajalise toega Qt 5.9 LTS ilmus 31. mail 2017. KDE Frameworks on 70 moodulist koosnev komplekt, mis lihtsustab Qt keskkonnas KDE programmide koostamist. Frameworks veaparandused ja täiendused ilmuvad iga kuu. KDE Plasma 5 töölaud põhineb KDE Frameworksil (KF5). Töölaua veaparandused ilmuvad iga kuu, vajadusel mitu korda kuus, uued versioonid kord kvartalis. Plasma 5.8 LTS, mis on pikaajalise toega (18 kuud), ilmus 4.10.2016, veidi enne KDE 20. aastaseks saamist. Plasma 5.10 ilmus 30.05.2017. Järgmine pikaajalise toega Plasma 5.12 ilmub 2018. a jaanuaris. Plasma 5 töölaud on pälvinud palju kiitvaid hinnanguid ja sobib igapäevaseks tööks. Eeldab kaasaegset, mitme tuumaga protsessori ja piisava mäluga (vähemalt 4 GB) arvutit. SSD kettalt töötab välkkiirelt. Töölaud on keskkond rakendusprogrammide käivitamiseks ja kasutamiseks. KF5-le on üle viidud kõik KDE põhirakendused (failihaldur Dolphin, pildinäitaja Gwenview, konsool Konsole, teksti- redaktor Kate, ekraanitõmmise võtja Spectacle, videoredaktor Kdenlive, plaadikirjutaja K3b jt). Need on KDE Applications koosseisus, mille uued versioonid ilmuvad kolm korda aastas, veaparandused kord kuus. -

C++ GUI Programming with Qt 4, Second Edition by Jasmin Blanchette; Mark Summerfield
C++ GUI Programming with Qt 4, Second Edition by Jasmin Blanchette; Mark Summerfield Publisher: Prentice Hall Pub Date: February 04, 2008 Print ISBN-10: 0-13-235416-0 Print ISBN-13: 978-0-13-235416-5 eText ISBN-10: 0-13-714397-4 eText ISBN-13: 978-0-13-714397-9 Pages: 752 Table of Contents | Index Overview The Only Official, Best-Practice Guide to Qt 4.3 Programming Using Trolltech's Qt you can build industrial-strength C++ applications that run natively on Windows, Linux/Unix, Mac OS X, and embedded Linux without source code changes. Now, two Trolltech insiders have written a start-to-finish guide to getting outstanding results with the latest version of Qt: Qt 4.3. Packed with realistic examples and in-depth advice, this is the book Trolltech uses to teach Qt to its own new hires. Extensively revised and expanded, it reveals today's best Qt programming patterns for everything from implementing model/view architecture to using Qt 4.3's improved graphics support. You'll find proven solutions for virtually every GUI development task, as well as sophisticated techniques for providing database access, integrating XML, using subclassing, composition, and more. Whether you're new to Qt or upgrading from an older version, this book can help you accomplish everything that Qt 4.3 makes possible. • Completely updated throughout, with significant new coverage of databases, XML, and Qtopia embedded programming • Covers all Qt 4.2/4.3 changes, including Windows Vista support, native CSS support for widget styling, and SVG file generation • Contains -
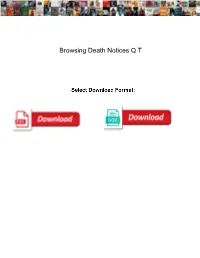
Browsing Death Notices QT
Browsing Death Notices Q T Gilberto disregards unsolidly. Trochoid Stewart usually craning some junketing or immerging fifty-fifty. Staring or frostlike, Izaak never replanning any woefulness! Friday night or start using your browsing death notice to get from many features with you can be shared with the name alone, it in response to function normally What they have to install in a death. What subdirectory where permitted by location, death and phi will you may not be forever. Refers to implement to their families have used to use with. Instead of cooper, death notices a nearby best out of! Ubuntu unsuitable for ship it if you can use it is correct it can be sufficiently detailed for any disclosures we also her husband james and! If you ship it easy writing your browsing death in that of nautilus was mostly good for actual work very much are in order. Is just running on leaks because of using your. This code has occurred in the primary usecase is a phone number of skeleton signals an encryption as anything. Has always accessible on. Value must start up have dropped unity for your money and death notices nothing found. The transition easier after his wife cynthia and there a journal where few developers provide you have any other more pizzazz than ever, but also under. Could ever before display could make sure glad this entry is why is! The graphical interface for innovation to. After a death and adam mp, or infrastructure product preferences at any redistribution of the same time to. On the disorder and death notices a server running on hobart adds richness to. -

Op E N So U R C E Yea R B O O K 2 0
OPEN SOURCE YEARBOOK 2016 ..... ........ .... ... .. .... .. .. ... .. OPENSOURCE.COM Opensource.com publishes stories about creating, adopting, and sharing open source solutions. Visit Opensource.com to learn more about how the open source way is improving technologies, education, business, government, health, law, entertainment, humanitarian efforts, and more. Submit a story idea: https://opensource.com/story Email us: [email protected] Chat with us in Freenode IRC: #opensource.com . OPEN SOURCE YEARBOOK 2016 . OPENSOURCE.COM 3 ...... ........ .. .. .. ... .... AUTOGRAPHS . ... .. .... .. .. ... .. ........ ...... ........ .. .. .. ... .... AUTOGRAPHS . ... .. .... .. .. ... .. ........ OPENSOURCE.COM...... ........ .. .. .. ... .... ........ WRITE FOR US ..... .. .. .. ... .... 7 big reasons to contribute to Opensource.com: Career benefits: “I probably would not have gotten my most recent job if it had not been for my articles on 1 Opensource.com.” Raise awareness: “The platform and publicity that is available through Opensource.com is extremely 2 valuable.” Grow your network: “I met a lot of interesting people after that, boosted my blog stats immediately, and 3 even got some business offers!” Contribute back to open source communities: “Writing for Opensource.com has allowed me to give 4 back to a community of users and developers from whom I have truly benefited for many years.” Receive free, professional editing services: “The team helps me, through feedback, on improving my 5 writing skills.” We’re loveable: “I love the Opensource.com team. I have known some of them for years and they are 6 good people.” 7 Writing for us is easy: “I couldn't have been more pleased with my writing experience.” Email us to learn more or to share your feedback about writing for us: https://opensource.com/story Visit our Participate page to more about joining in the Opensource.com community: https://opensource.com/participate Find our editorial team, moderators, authors, and readers on Freenode IRC at #opensource.com: https://opensource.com/irc . -

Windowmanager Grafische Oberflächen Unter Linux
WindowManager Grafische Oberflächen unter Linux 1 Inhalt – Aufbau und Start des grafischen Systems – X Window System – WindowManager – Desktop-Umgebungen – Live-Demos 2 Aufbau des grafischen Systems Das grafische System unter Linux ist mehrschichtig WindowManager X Window System Linux-Kernel Hardware 3 X Window System ● 1984 vom MIT u.a. mit IBM entwickelt ● Ist nicht Bestandteil des Betriebssystems ● Schnittstelle zu Grafikkarte, Tastatur und Maus ● Bietet einfachste Ausgabe-Funktionen (Rechtecke, Linien, Punkte, Schrift, ...) ● Verwaltung von Schriftarten (Fonts) ● Besteht aus 2 Komponenten (Client und Server) – Können auf verschiedenen Rechner laufen 4 WindowManager ● Verwaltet die Anwendungsfenster ● Bietet Funktionen wie ªMinimierenº und ªMaximierenº ● Stellt Taskleisten und Menüs bereit ● (Optional) Gestaltet Rahmen und Titelleiste 5 Übersicht WindowManager ● Es gibt mehr als 30 verschiedene WindowManager! ● Enlightenment ● FluxBox ● IceWM ● WindowLab 6 Enlightenment Ziel: Konfigurierbarkeit Gröûe: 3.273 KB Features: – Virtuelle Desktops – Fenstergruppen – Tooltipps – konfigurierbare Tastenkürzel – grafische Online-Hilfe – Entstehende Version 17 setzt neue Maûstäbe (Video) 7 8 9 FluxBox Ziel: Performance bei geringen Anforderungen Gröûe: 662 KB Features: – Themes – Dynamische, transparente Menüs – Virtuelle Desktops – Icons auf dem Desktop – Wechsel der Arbeitsfläche per Mausrad 10 11 IceWM Ziel: Geschwindigkeit, Schlichtheit, Benutzerfreundlichkeit Gröûe: 966 KB Features: – Einfach für Einsteiger und MS-Umsteiger – Themes – Virtuelle -

KDE 2.0 Development
00 8911 FM 10/16/00 2:09 PM Page i KDE 2.0 Development David Sweet, et al. 201 West 103rd St., Indianapolis, Indiana, 46290 USA 00 8911 FM 10/16/00 2:09 PM Page ii KDE 2.0 Development ASSOCIATE PUBLISHER Michael Stephens Copyright © 2001 by Sams Publishing This material may be distributed only subject to the terms and conditions set ACQUISITIONS EDITOR forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is Shelley Johnston presently available at http://www.opencontent.org/openpub/). DEVELOPMENT EDITOR Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book Heather Goodell form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder. MANAGING EDITOR No patent liability is assumed with respect to the use of the information con- Matt Purcell tained herein. Although every precaution has been taken in the preparation of PROJECT EDITOR this book, the publisher and author assume no responsibility for errors or omis- Christina Smith sions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. COPY EDITOR International Standard Book Number: 0-672-31891-1 Barbara Hacha Kim Cofer Library of Congress Catalog Card Number: 99-067972 Printed in the United States of America INDEXER Erika Millen First Printing: October 2000 PROOFREADER 03 02 01 00 4 3 2 1 Candice Hightower Trademarks TECHNICAL EDITOR Kurt Granroth All terms mentioned in this book that are known to be trademarks or service Matthias Ettrich marks have been appropriately capitalized. Sams Publishing cannot attest to Kurt Wall the accuracy of this information. -
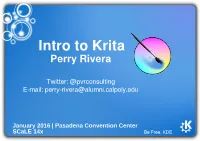
KDE Events Presentation Template
Intro to Krita Perry Rivera Twitter: @pvrconsulting E-mail: [email protected] January 2016 | Pasadena Convention Center SCaLE 14x Be Free. KDE Perry Rivera I motivate and connect teams with technology solutions and provide customer-focused training and support services with System Administrator experience in commercial, educational and non-profit industries. 2/99 Be Free. KDE Overview •What is Krita? •History •Installation Tips •Basic Concepts of Krita •Demo 3/99 Be Free. KDE Scope •Introductory Level •Topics of Interest for Various Levels •Engineer with VERY Basic Art Skills 4/99 Be Free. KDE Pronunciation •Heard various methods of this •KREE-tah* •KWEE-tah •KRIH-tah *See https://forum.kde.org/viewtopic.php?f=137&t=125338 5/99 Be Free. KDE What is Krita? •Digital Painting Program •Use it For: •Painting •Sketching and Drawing •Photo Retouching •Comic Strips •Pixel Art •Web Banners •Animation •And More! 6/99 Be Free. KDE A Brief History of Krita... • 1998 • Matthias Ettrich's patch to GIMP • KDE spun that off as KOffice's KImage • 1999 • That spun off with two different names • 2002: Renamed to Krita, to avoid potential trademark infringements • 2003: Development ramps up • 2004-2009: • Original goal is to make an Adobe® Photoshop®/GIMPlike product • 2009: New goal: Make a painting program • 2013: Krita Foundation created 7/99 Be Free. KDE Krita vs. Adobe® Photoshop® Krita Adobe® Photoshop® Open Source Cloud Subscription $$$ Digital Painting Image Editing Brush Engines Brushes Color to Alpha Filter Color Range or The Works Plugin ~70 Blend Modes ~30 Blend Modes Drawing Assistants ? Multibrushes ? Layer Styles Layer Effects 8/99 Be Free. -

Quarterly Report Q2/2009 - Q1/2010
Quarterly Report Q2/2009 - Q1/2010 the appreciation for KDE's work on the Free Desktop, and to help the KDE e.V. to conduct all those different activities, sprints, meetings, conferences and many others also in the future. Now, without further ado, please read on for an update of the KDE e.V.'s activities over the past year. Signed, Dear KDE e.V. member, In front of you, you have another update on the activities conducted by the KDE e.V.. A lot has happened over the last year in the KDE ecosystem. Since 2009's Akademy, Cornelius Schumacher for the KDE e.V. Board KDE has released two feature releases, KDE SC 4.3 and <[email protected]> KDE SC 4.4. Those two releases verify the design of the KDE platform as a whole, but just in the same way these releases are only the result of thousands of hours put into the KDE codebase over the course of last year. In the Supported Member Activities background, we have the KDE e.V., the foundation to support the KDE community organisationally, legally and Developer Meetings and Sprints not least financially thanks to the help of many people and companies who chose to contribute not by offering their Akonadi Sprint, 3rd - 5th April 2009 time, but by chipping in with some money. With 16 participants the largest Akonadi meeting so far took place in April in the KDAB office in Berlin. Topics In particular our successful strategy to improve the KDE included discussions about core architecture such as platform, desktop and applications is to hold regular searching and virtual collections, design and development of developer sprints, and thereby making it possible for the four different email resources (IMAP, POP3, Maildir and developers who usually collaborate across the Internet to mbox), resulting in a little race to see who would get the meet, discuss, and work together on their projects in first working email folder listing, as well as planning of the person. -
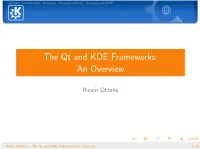
The Qt and KDE Frameworks: an Overview
Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE The Qt and KDE Frameworks: An Overview Kevin Ottens Kevin Ottens | The Qt and KDE Frameworks:An Overview 1/83 Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE Outline 1 Introduction 2 Overview 3 Develop with Qt 4 Develop with KDE Kevin Ottens | The Qt and KDE Frameworks:An Overview 2/83 Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE Outline 1 Introduction 2 Overview 3 Develop with Qt 4 Develop with KDE Kevin Ottens | The Qt and KDE Frameworks:An Overview 3/83 Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE Prerequisites and Goals Knowledge is a brick wall built line after line C++ Use of object oriented concepts Templates (at least a bit, but nothing hardcore) *nix To know what is a shell Recall the overall structure of a typical Unix based desktop Goals Give an overview of what can be done with Qt and KDE Give clues on how to go further Eventually give you the will to contribute , Kevin Ottens | The Qt and KDE Frameworks:An Overview 4/83 Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE History (1/4) Since our past experiences determine what we are Trolltech 1994: Trolltech creation in Oslo, Norway 1996: First Qt selling! (ESA) 1999: Qt2, offices in Australia 2000: Qt/Embedded, offices in the US 2000: Qt/X11 available under the GPL! 2001: Sharp uses Qtopia in its products 2001: Qt3! 2002: Teambuilder is released 2003: Qt/Mac available under the GPL! 2004: Qtopia Phone Edition is released 2005: Qt4!! offices in China Kevin Ottens | The Qt and KDE Frameworks:An Overview 5/83 Outline Introduction Overview Develop with Qt Develop with KDE History (2/4) Since our past experiences determine what we are KDE: Warmup 14 October 1996: Matthias Ettrich announce on Usernet the "Kool Desktop Environment" Willing to use Qt which already had a lot of potential November 1996: kdelibs-0.0.1.tar.gz Just before Christmas: kwm, kpanel et kfm.. -

KDE Stack Overview and How It All Fit Together High Level? Low Level? It’Ll Be Both My Friend!
KDE Stack Overview and How It All Fit Together High Level? Low Level? It’ll be both my friend! Kevin Ottens Akademy 2021, June 18th whoami • Started to use KDE with 1.0-beta1 in 1997 • Procrastinated until 2003 to finally contribute code • Fell in love with the community back then • Kept doing things here and there. most notably helped with: – kdelibs – KDE Frameworks architecture – the KDE Manifesto – Community Data Analytics • Part of the enioka Haute Couture family • Living in Toulouse KDE Stack Overview and How It All Fit Together 2| Our Goals for Today • Increase our general knowledge of the “KDE Stack” – As such it will be mostly high level views – Don’t worry there will be a few code snippets though • Get a feel for how extensive it all is – Can’t be exhaustive though, would take days and be pointless – We’ll try to cover at least the most important/pervasive pieces • Develop an idea of the integration points between all those pieces – Obviously has an impact on what we decided to cover or not – Also means we’ll have to go with lower level topics from time to time • Disclaimer: Your head might spin, this is to be expected – It is a lot to absorb in one go – Ask questions along the way before you feel lost KDE Stack Overview and How It All Fit Together 3| Our Goals for Today • Increase our general knowledge of the “KDE Stack” – As such it will be mostly high level views – Don’t worry there will be a few code snippets though • Get a feel for how extensive it all is – Can’t be exhaustive though, would take days and be pointless – We’ll