Zur Pilzflora Der Eilenriede in Hannover - Zweiter Teil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fertility-Dependent Effects of Ectomycorrhizal Fungal Communities on White Spruce Seedling Nutrition
Mycorrhiza (2015) 25:649–662 DOI 10.1007/s00572-015-0640-9 ORIGINAL PAPER Fertility-dependent effects of ectomycorrhizal fungal communities on white spruce seedling nutrition Alistair J. H. Smith II1 & Lynette R. Potvin2 & Erik A. Lilleskov2 Received: 14 January 2015 /Accepted: 6 April 2015 /Published online: 24 April 2015 # Springer-Verlag Berlin Heidelberg (outside the USA) 2015 Abstract Ectomycorrhizal fungi (EcMF) typically colonize manganese, and Atheliaceae sp. had a negative relationship with nursery seedlings, but nutritional and growth effects of these P content. Findings shed light on the community and species communities are only partly understood. To examine these ef- effects on seedling condition, revealing clear functional differ- fects, Picea glauca seedlings collected from a tree nursery natu- ences among dominants. The approach used should be scalable rally colonized by three dominant EcMF were divided between to explore function in more complex communities composed of fertilized and unfertilized treatments. After one growing season unculturable EcMF. seedlings were harvested, ectomycorrhizas identified using DNA sequencing, and seedlings analyzed for leaf nutrient concentra- Keywords Stoichiometry . Ectomycorrhizal fungal tion and content, and biomass parameters. EcMF community community effects . Nitrogen . Phosphorus . Micronutrients . structure–nutrient interactions were tested using nonmetric mul- Amphinema . Atheliaceae . Thelephora terrestris . tidimensional scaling (NMDS) combined with vector analysis of Greenhouse foliar nutrients and biomass. We identified three dominant spe- cies: Amphinema sp., Atheliaceae sp., and Thelephora terrestris. NMDS+envfit revealed significant community effects on seed- Introduction ling nutrition that differed with fertilization treatment. PERM ANOVA and regression analyses uncovered significant species Seedlings regenerating naturally or artificially are influenced by effects on host nutrient concentration, content, and stoichiometry. -

Mycorrhization Helper Bacteria Associated with the Douglas Fir-Laccaria Laccata Symbiosis: Effects in Aseptic and in Glasshouse Conditions R Duponnois, J Garbaye
Mycorrhization helper bacteria associated with the Douglas fir-Laccaria laccata symbiosis: effects in aseptic and in glasshouse conditions R Duponnois, J Garbaye To cite this version: R Duponnois, J Garbaye. Mycorrhization helper bacteria associated with the Douglas fir-Laccaria laccata symbiosis: effects in aseptic and in glasshouse conditions. Annales des sciences forestières, INRA/EDP Sciences, 1991, 48 (3), pp.239-251. hal-00882751 HAL Id: hal-00882751 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00882751 Submitted on 1 Jan 1991 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Original article Mycorrhization helper bacteria associated with the Douglas fir-Laccaria laccata symbiosis: effects in aseptic and in glasshouse conditions R Duponnois J Garbaye 1 BIOSEM, Laboratoire de Technologie des Semences, Avenue du Bois de l’Abbé, F-49070 Beaucouzé; 2INRA, Centre de Recherches Forestières de Nancy, Champenoux, F-54280 Seichamps, France (Received 8 October 1990; accepted 19 December 1990) Summary — A range of bacterial isolates from Laccaria laccata mycorrhizas and sporocarps were tested for their effect on ectomycorrhizal development of Douglas fir with L laccata. The experiments were carried out in aseptic conditions and in the glasshouse under summer and winter conditions. -

An Ectomycorrhizal Thelephoroid Fungus of Malaysian Dipterocarp Seedlings
Journal of Tropical Forest Science 22(4): 355–363 (2010) Lee SS et al. AN ECTOMYCORRHIZAL THELEPHOROID FUNGUS OF MALAYSIAN DIPTEROCARP SEEDLINGS Lee SS*, Thi BK & Patahayah M Forest Research Institute Malaysia, 52109 Kepong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Received April 2010 LEE SS, THI BK & PATAHAYAH M. 2010. An ectomycorrhizal thelephoroid fungus of Malaysian dipterocarp seedlings. The ectomycorrhizal Dipterocarpaceae are among the most well-known trees in the tropics and this is the most important family of timber trees in Malaysia and South-East Asia. Recent studies and molecular data reveal that members of the Thelephoraceae are common ectomycorrhizal fungi associated with the Dipterocarpaceae. The suspected thelephoroid fungus FP160 was isolated from ectomycorrhizal roots of a Shorea parvifolia (Dipterocarpaceae) seedling and kept in the Forest Research Institute Malaysia (FRIM) culture collection. In subsequent inoculation experiments it was able to form morphologically similar ectomycorrhizas with seedlings of two other dipterocarps, namely, Hopea odorata and S. leprosula, and the exotic fast-growing legume, Acacia mangium. A taxonomic identity of this fungus would benefit its possible use in inoculation and planting programmes. This information is also important to expand our limited knowledge of Malaysian mycodiversity. In this paper the morphological characteristics of the ectomycorrhizas formed by FP160 with H. odorata and A. mangium are described and the fungus identified using molecular methods as a member of the family Thelephoraceae, most likely a Tomentella sp. It was not possible to identify the fungus more precisely due to the limited number of sequences available for tropical Thelephoraceae in the public databases. Keywords: Acacia mangium, Dipterocarpaceae, ectomycorrhizas, ITS, Thelephoraceae LEE SS, THI BK & PATAHAYAH M. -
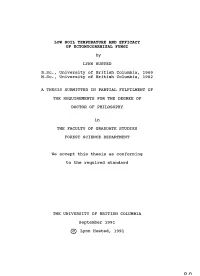
Low Soil Temperature and Efficacy of Ectomycorrhizal Fungi
LOW SOIL TEMPERATURE AND EFFICACY OF ECTOMYCORRHIZAL FUNGI by LYNN HUSTED B.Sc, University of British Columbia, 1969 M.Sc., University of British Columbia, 1982 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES FOREST SCIENCE DEPARTMENT We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA September 1991 (c) Lynn Husted, 1991 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of The University of British Columbia Vancouver, Canada Date DE-6 (2/88) ABSTRACT The influence of root-zone temperature on the efficacy of various ectomycorrhizal fungi, i.e., their ability: (1) to colonize roots in a nursery environment, (2) to persist and colonize new roots in the field and (3) to improve the growth, nutrition, and physiology of white spruce (Picea glauca (Moench) Voss) seedlings, was examined in controlled environment experiments using water baths to regulate root-zone temperature. Eight-week-old non-mycorrhizal seedlings were inoculated with 13 different inocula (1 forest floor inoculum, 12 specific fungi), then transplanted into 6, 16, or 26°C peat:vermiculite mixes for 8 weeks. -

Ectomycorrhizal Fungal Community Structure in a Young Orchard of Grafted and Ungrafted Hybrid Chestnut Saplings
Mycorrhiza (2021) 31:189–201 https://doi.org/10.1007/s00572-020-01015-0 ORIGINAL ARTICLE Ectomycorrhizal fungal community structure in a young orchard of grafted and ungrafted hybrid chestnut saplings Serena Santolamazza‑Carbone1,2 · Laura Iglesias‑Bernabé1 · Esteban Sinde‑Stompel3 · Pedro Pablo Gallego1,2 Received: 29 August 2020 / Accepted: 17 December 2020 / Published online: 27 January 2021 © The Author(s) 2021 Abstract Ectomycorrhizal (ECM) fungal community of the European chestnut has been poorly investigated, and mostly by sporocarp sampling. We proposed the study of the ECM fungal community of 2-year-old chestnut hybrids Castanea × coudercii (Castanea sativa × Castanea crenata) using molecular approaches. By using the chestnut hybrid clones 111 and 125, we assessed the impact of grafting on ECM colonization rate, species diversity, and fungal community composition. The clone type did not have an impact on the studied variables; however, grafting signifcantly infuenced ECM colonization rate in clone 111. Species diversity and richness did not vary between the experimental groups. Grafted and ungrafted plants of clone 111 had a diferent ECM fungal species composition. Sequence data from ITS regions of rDNA revealed the presence of 9 orders, 15 families, 19 genera, and 27 species of ECM fungi, most of them generalist, early-stage species. Thirteen new taxa were described in association with chestnuts. The basidiomycetes Agaricales (13 taxa) and Boletales (11 taxa) represented 36% and 31%, of the total sampled ECM fungal taxa, respectively. Scleroderma citrinum, S. areolatum, and S. polyrhizum (Boletales) were found in 86% of the trees and represented 39% of total ECM root tips. The ascomycete Cenococcum geophilum (Mytilinidiales) was found in 80% of the trees but accounted only for 6% of the colonized root tips. -

Ectomycorrhizal Fungal Assemblages of Nursery-Grown Scots Pine Are Influenced by Age of the Seedlings
Article Ectomycorrhizal Fungal Assemblages of Nursery-Grown Scots Pine are Influenced by Age of the Seedlings Maria Rudawska * and Tomasz Leski Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Parkowa 5, 62-035 Kórnik, Poland; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: Scots pine (Pinus sylvestris L.) is the most widely distributed pine species in Europe and is relevant in terms of planted areas and harvest yields. Therefore, each year the demand for planting stock of Scots pine is exceedingly high, and large quantities of seedlings are produced annually throughout Europe to carry out reforestation and afforestation programs. Abundant and diverse ectomycorrhizal (ECM) symbiosis is critical for the success of seedlings once planted in the field. To improve our knowledge of ECM fungi that inhabit bare-root nursery stock of Scots pine and understand factors that influence their diversity, we studied the assemblages of ECM fungi present across 23 bare-root forest nurseries in Poland. Nursery stock samples were characterized by a high level of ECM colonization (nearly 100%), and a total of 29 ECM fungal taxa were found on 1- and 2- year-old seedlings. The diversity of the ECM community depended substantially on the nursery and age of the seedlings, and species richness varied from 3–10 taxa on 1-year-old seedlings and 6–13 taxa on 2-year-old seedlings. The ECM fungal communities that developed on the studied nursery stock were characterized by the prevalence of Ascomycota over Basidiomycota members on 1-year-old seedlings. All ecological indices (diversity, dominance, and evenness) were significantly affected by age of the seedlings, most likely because dominant ECM morphotypes on 1-year-old seedlings (Wilcoxina mikolae) were replaced by other dominant ones (e.g., Suillus luteus, Rhizopogon roseolus, Thelephora terrestris, Hebeloma crustuliniforme), mostly from Basidiomycota, on 2-year-old seedlings. -

Thelephora Anthocephala Thelephora ≡ Anthocephala Var
© Demetrio Merino Alcántara [email protected] Condiciones de uso Thelephora anthocephala (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 535 (1838) [1836-1838] Foto Dianora Estrada Thelephoraceae, Thelephorales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi ≡ Clavaria anthocephala Bull., Herb. Fr. (Paris) 6: tab. 452 (1786) ≡ Merisma anthocephalum (Bull.) Sw., K. Vetensk-Acad. Nya Handl. 32: 84 (1811) = Merisma clavulare Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 156 (1815) = Merisma foetidum var. anthocephala (Bull.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 584 (1801) ≡ Phylacteria anthocephala (Bull.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 154 (1887) ≡ Phylacteria anthocephala (Bull.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 154 (1887) f. anthocephala ≡ Phylacteria anthocephala f. incrustans-resupinata Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 123 (1924) ≡ Phylacteria anthocephala f. repens Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 123 (1924) ≡ Phylacteria anthocephala (Bull.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 154 (1887) var. anthocephala ≡ Phylacteria anthocephala var. clavularis (Fr.) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 122 (1924) = Phylacteria clavularis (Fr.) Bigeard & H. Guill., Fl. Champ. Supér. France (Chalon-sur-Saône) 2: 452 (1913) = Phylacteria terrestris var. digitata Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 126 (1924) = Thelephora americana (Peck) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 16: 183 (1902) ≡ Thelephora anthocephala (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 535 (1838) [1836-1838] f. anthocephala ≡ Thelephora anthocephala f. incrustans-resupinata (Bourdot & Galzin) Corner, Beih. Nova Hedwigia 27: 40 (1968) ≡ Thelephora anthocephala f. repens (Bourdot & Galzin) Corner, Beih. Nova Hedwigia 27: 40 (1968) ≡ Thelephora anthocephala var. americana (Peck) Corner, Beih. Nova Hedwigia 27: 40 (1968) ≡ Thelephora anthocephala (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 535 (1838) [1836-1838] var. -

Mycorrhizal Fungi of Aspen Forests: Natural Occurrence and Potential Applications
Utah State University DigitalCommons@USU Aspen Bibliography Aspen Research 2001 Mycorrhizal fungi of aspen forests: natural occurrence and potential applications C.L. Cripps Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/aspen_bib Part of the Forest Sciences Commons Recommended Citation Cripps, CL. 2001. Mycorrhizal fungi of aspen forests: natural occurrence and potential applications. WD Shepperd et al (compilers). Sustaining Aspen in Western Landscapes: Symposium Proceedings. Proceedings RMRS-P-18. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. Fort Collins, CO. This Contribution to Book is brought to you for free and open access by the Aspen Research at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in Aspen Bibliography by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. Mycorrhizal Fungi of Aspen Forests: Natural Occurrence and Potential Applications Cathy L. Cripps1 Abstract—Native mycorrhizal fungi associated with aspen were surveyed on three soil types in the north-central Rocky Mountains. Selected isolates were tested for the ability to enhance aspen seedling growth in vitro. Over 50 species of ectomycorrhizal fungi occur with Populus tremuloides in this region, primarily basidiomycete fungi in the Agaricales. Almost one-third (30%) were ubiquitous with aspen and were found on all three soil types. Over one-third (37%) were restricted to the acidic, sandy soil of the smelter-impacted Butte-Anaconda area, revealing a subset of fungi that tolerate these conditions. Mycorrhizal fungi were screened for their ability to enhance aspen growth and establishment. Of nine selected isolates, all but one increased the biomass of aspen seedlings 2–4 times. -

Thelephora Terrestris
© Demetrio Merino Alcántara [email protected] Condiciones de uso Thelephora terrestris Ehrh., Pl. Crypt. Linn. Exsicc.: no. 178 (1787) Thelephoraceae, Thelephorales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi = Coniophora eradians (Fr.) Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1: 195 (1828) ≡ Hyphoderma terrestre (Ehrh.) Wallr., Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 579 (1833) = Hypochnus eradians (Fr.) Bres., Annls mycol. 1(2): 106 (1903) ≡ Phylacteria terrestris (Ehrh.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 119 (1900) ≡ Phylacteria terrestris var. eradians (Fr.) Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 127 (1924) ≡ Phylacteria terrestris var. infundibuliformis Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 126 (1924) ≡ Phylacteria terrestris var. resupinata Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 127 (1924) ≡ Phylacteria terrestris (Ehrh.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc. (Lons-le-Saunier): 119 (1900) var. terrestris ≡ Phylacteria terrestris var. tomentella Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 40(1): 127 (1924) = Thelephora crustosa Lloyd, Mycol. Writ. 7(Letter 69): 1196 (1923) = Thelephora eradians Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1: 195 (1828) = Thelephora minor Velen., České Houby 4-5: 770 (1922) = Thelephora rhipidium Velen., České Houby 4-5: 772 (1922) ≡ Thelephora terrestris f. resupinata (Bourdot & Galzin) Donk, Medded. Nedl. Mycol. Ver. 22: 44 (1933) ≡ Thelephora terrestris var. infundibuliformis (Bourdot & Galzin) Corner, Beih. Nova Hedwigia 27: 88 (1968) ≡ Thelephora terrestris var. tomentella (Bourdot & Galzin) Corner, Beih. Nova Hedwigia 27: 88 (1968) = Thelephora tristis Sacc., Fl. ital. crypt., Hymeniales (Genoa) 1: 1138 (1916) Material estudiado: España, Huelva, Punta Umbría, Los Enebrales, 29SPB7817, 13 m, en duna fija sobre ramitas caídas de Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa y Pinus pinea, 11-I-2016, leg. -

Ectomycorrhizal Status of Scots Pine Saplings Growing in Post-Agricultural Soils
Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20, No. 6A (2011), 83-88 Original Research Ectomycorrhizal Status of Scots Pine Saplings Growing in Post-Agricultural Soils Dorota Hilszczańska1*, Zbigniew Sierota2, Monika Małecka2 1Forest Research Institute, Department of Forest Ecology, 2Forest Research Institute, Department of Forest Protection, Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Poland Received: 14 October 2010 Accepted: 21 July 2011 Abstract Ectomycorrhizal communities associated with Pinus sylvestris L. saplings growing on abandoned post agricultural soils were studied. 1-year-old seedlings inoculated with either Suillus luteus Fr. or Thelephora ter- restris (Ehrh.) Fr. had been outplanted on three sites. We investigated the long-term effect (6 and 8 years after outplanting) of inoculation on ectomycorrhizal composition and species richness. We found 17 morphotypes in total that could be identified to genus or species. In all sites the most predominant ectomycorrhizae were Suillus luteus, Thelephora terrestris, Tomentella sp., Dermocybe palustris, and Dermocybe sp. Species rich- ness was higher in the case of inoculated seedlings grown at sites in Garwolin and Płońsk, whereas at the third site, Jabłonna, more diverse ectomycorrhizae possessed non-inoculated seedlings. The number of S. luteus mycorrhizae on seedlings inoculated with the fungus was higher than on non-inoculated ones. Dissimilar results have been found in cases of seedlings inoculated by T. terrestris. The latter possessed only 14% of the ectomycorrhizae. The results showed that persistence of inoculated fungi in roots of Scots pine is regulated by environmental conditions. Keywords: Scots pine, inoculation, ectomycorrhizal fungi, agricultural lands Introduction One way of overcoming the problem of the absence of ectomycorrhizal fungi in soil would be the preinoculation Ectomycorrhizal symbiosis plays a major role in two of seedlings with selected ECM fungi. -

About TERI the Bioresources and Biotechnology Division the Mycorrhiza Network and the Centre for Mycorrhizal Culture Collection
Vol. 11 No. 3 October 1999 About TERI A dynamic and flexible organization with a global vision and a local focus, TERI was established in 1974. While in the initial period the focus was mainly on documentation and information dissemination activities, research activities in the fields of energy, environment, and sustainable development were initiated towards the end of 1982. The genesis of these activities lay in TERIs firm belief that efficient utilization of energy, sustainable use of natural resources, large-scale adoption of renewable energy technologies, and reduction of all forms of waste would move the process of development towards the goal of sustainability. The Bioresources and Biotechnology Division Focusing on ecological, environmental, and food security issues, the Divisions activities include working with a wide variety of living organisms, sophisticated genetic engineering techniques, and, at the grassroots level, with village communities. The Division functions through four areas: Microbial Biotechnology, Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, and Forestry/Biodiversity. The Division is actively engaged in mycorrhizal research. The Mycorrhiza Network has specifically been created to help scientists across the globe in carrying out research on mycorrhiza. The Mycorrhiza Network and the Centre for Mycorrhizal Culture Collection Established in April 1988 at TERI, New Delhi, the Mycorrhiza Network first set up the MIC (Mycorrhiza Information Centre), the same year, and the CMCC (Centre for Mycorrhizal Culture Collection) a national germplasm bank of mycorrhizal fungi in 1993. The general objectives of the Mycorrhiza Network are to strengthen research, encourage participation, promote information exchange, and publish the quarterly newsletter, Mycorrhiza News. The MIC has been primarily responsible for establishing an information network, which facilitates information sharing among the network members and makes the growing literature on mycorrhiza available to researchers. -

Mycorrhizae in Forest Tree Nurseries Michelle M
Mycorrhizae in Forest Tree Nurseries Michelle M. Cram and R. Kasten Dumroese Mycorrhizae are symbiotic fungus The intensive commercial seedling root associations. The colonization of production for reforestation typically roots by mycorrhizal fungi can benefit suppresses or delays colonization of the host by improving nutrient and water seedlings by mycorrhizal fungi. Fumiga uptake. In exchange, the host plant provides tion used to control pests can limit and the mycorrhizal fungi carbohydrates (car sometimes remove mycorrhizal fungi bon) from photosynthesis. A substantial from the upper 15 to 30 cm (6 to 12 portion of this carbon is ultimately trans in) of soil for weeks to several months. ferred to the rhizosphere and is estimated Some fungicides have also been found to to account for up to 15 percent of the suppress mycorrhizae development, espe organic matter in forest soils. Under most cially systemic fungicides (for example, environmental conditions, trees and other triadimefon) and fungicides applied as plants are naturally colonized by mycor soil drenches (for example, azoxystrobin, rhizal fungi. These mycorrhizal associations iprodione). High fertilization rates have are highly complex and dynamic, a result also been known to suppress mycorrhizae of the great diversity of mycorrhizal fungi, development, particularly when the fertil hosts, and terrestrial systems that interact izer is high in phosphorus (greater than and evolve with changes in hosts and 150 ppm). Despite the negative effect Figure I.6—Pisolithus tinctorius forms a yellow- environmental conditions. these common nursery treatments have on brown (ocher) mantle on pine feeder roots. Photo by mycorrhizae, the benefits of fertilization Michelle M. Cram, USDA Forest Service.