DBU-Abschlussbericht-AZ-25231.Pdf (2.29
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geogenic Organic Carbon in Terrestrial Sediments and Its Contribution to Total Soil Carbon
SOIL, 7, 347–362, 2021 https://doi.org/10.5194/soil-7-347-2021 © Author(s) 2021. This work is distributed under SOIL the Creative Commons Attribution 4.0 License. Geogenic organic carbon in terrestrial sediments and its contribution to total soil carbon Fabian Kalks1, Gabriel Noren2, Carsten W. Mueller3,4, Mirjam Helfrich1, Janet Rethemeyer2, and Axel Don1 1Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Bundesallee 65, 38116 Braunschweig, Germany 2Institute of Geology and Mineralogy, University of Cologne, Institute of Geology and Mineralogy, Zülpicher Str. 49b, 50674 Cologne, Germany 3Chair of Soil Science, School of Life Sciences, Technical University of Munich, Emil-Ramann-Strasse 2, 85354 Freising-Weihenstephan, Germany 4Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Øster Voldgade 10, 1350 Copenhagen K, Denmark Correspondence: Fabian Kalks ([email protected]) Received: 19 May 2020 – Discussion started: 5 June 2020 Revised: 18 May 2021 – Accepted: 27 May 2021 – Published: 6 July 2021 Abstract. Geogenic organic carbon (GOC) from sedimentary rocks is an overlooked fraction in soils that has not yet been quantified but influences the composition, age, and stability of total organic carbon (OC) in soils. In this context, GOC is the OC in bedrock deposited during sedimentation. The contribution of GOC to total soil OC may vary, depending on the type of bedrock. However, no studies have been carried out to investigate the contribution of GOC derived from different terrestrial sedimentary rocks to soil OC contents. In order to fill this knowledge gap, 10 m long sediment cores from three sites recovered from Pleistocene loess, Miocene sand, and Triassic Red Sandstone were analysed at 1 m depth intervals, and the amount of GOC was calculated based on 14C measurements. -

3.2 Maßnahmenkatalog Gewässer Ilme
UMSETZUNG DER EG-WRRL IM BEARBEITUNGSGEBIET 18 LEINE/ILME Zwischenbericht Phase III A Seite 39 3.2 Maßnahmenkatalog Gewässer Ilme 3.2.1 Entwicklungsziele • Umsetzung der Ziele der FFH-Richtlinie für das FFH-Gebiet 128 „Ilme“ für den Ge- wässerlauf und die wasserabhängigen Lebensräume in der Aue. • Umsetzung der Ziele des Fließgewässerschutzsystems des Landes Niedersach- sen. Die Ilme ist in diesem System Hauptgewässer 1. Priorität (RASPER et al. 1991) • Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an insgesamt 13 Wehranlagen und Sohlabstürzen vom Quellbereich bis in den Abschnitt Einbeck durch Bau von Fisch- pässen, Umgehungsgewässern oder rauen Sohlgleiten um Wanderungen der Interstitial-, Makrobenthos- und Fischfauna wieder zu ermöglichen. Mit diesen Maßnahmen sind möglichst auch die Rückstaubereiche aufzuheben. • Verbesserung der Durchgängigkeit an Querbauwerken (Brücken) mit betonierten und/oder gepflasterten Sohlen. • Strukturelle Verbesserungen an ausgebauten und begradigten Abschnitten mit der Zielerreichung der Gewässerstrukturgüteklasse 3. Das gilt insbesondere für den Unterlauf ab Einbeck, wo mindestens die GKl 4 erreicht werden sollte. • Sohlanhebungen in Abschnitten, die durch Tiefenerosion stark in das umgebende Gelände eingeschnitten sind, z. B. Unterlauf ab Einbeck, mit dem Ziel, die Grund- wasserstände in der Aue anzuheben. Der Hochwasserschutz der Stadt Einbeck ist zu beachten. • Weitgehender Ersatz der im Oberlauf an den Bach angrenzenden Fichten durch standortheimische Baumarten. • Langfristiger Ersatz der monotonen Fichtenforsten im Einzugsgebiet der Ilme und ihrer Seitenbäche im Bereich des Solling durch Laub-Nadelholz-Mischbestände oder reine Laubwaldbestände. • Anlagen von Gewässerrandstreifen mit Gehölzen, Gras- und Hochstaudenfluren oder als Extensivgrünland zur Reduktion des Stoffeintrags, Zulassung der eigendy- namischen Entwicklung, als Vernetzungselement von Lebensräumen in der Land- schaft und zur Schaffung neuen Lebensraums für Flora und Fauna. -
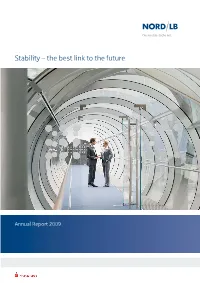
NORD/LB Group Annual Report 2009
Die norddeutsche Art. Stability – the best link to the future Annual Report 2009 NORD/LB Annual Report 2009 Erweiterter Konzernvorstand (extended Group Managing Board) left to right: Dr. Johannes-Jörg Riegler, Harry Rosenbaum, Dr. Jürgen Allerkamp, Dr. Gunter Dunkel, Christoph Schulz, Dr. Stephan-Andreas Kaulvers, Dr. Hinrich Holm, Eckhard Forst These are our figures 1 Jan.–31 Dec. 1 Jan.–31 Dec. Change 2009 2008 (in %) In € million Net interest income 1,366 1,462 – 7 Loan loss provisions – 1,042 – 266 > 100 Net commission income 177 180 – 2 ProÞ t/loss from Þ nancial instruments at fair value through proÞ t or loss including hedge accounting 589 – 308 > 100 Other operating proÞ t/loss 144 96 50 Administrative expenses 986 898 10 ProÞ t/loss from Þ nancial assets – 140 – 250 44 ProÞ t/loss from investments accounted – 200 6 > 100 for using the equity method Earnings before taxes – 92 22 > 100 Income taxes 49 – 129 > 100 Consolidated proÞ t – 141 151 > 100 Key Þ gures in % Cost-Income-Ratio (CIR) 47.5 62.5 Return on Equity (RoE) – 2.7 – 31 Dec. 31 Dec. Change 2009 2008 (in %) Balance Þ gures in € million Total assets 238,688 244,329 – 2 Customer deposits 61,306 61,998 – 1 Customer loans 112,083 112,172 – Equity 5,842 5,695 3 Regulatory key Þ gures (acc. to BIZ) Core capital in € million 8,051 7,235 11 Regulatory equity in € million 8,976 8,999 – Risk-weighted assets in € million 92,575 89,825 3 BIZ total capital ratio in % 9.7 10.0 BIZ core capital ratio in % 8.7 8.1 NORD/LB ratings (long-term / short-term / individual) Moody’s Aa2 / P-1 / C – Standard & Poor’s A– / A-2 / – Fitch Ratings A / F1 / C / D Our holdings Our subsidiaries and holding companies are an important element of our corporate strategy. -

Laubwald-Gesellschaften Trockenwarmer Standorte Im
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Tuexenia - Mitteilungen der Floristisch- soziologischen Arbeitsgemeinschaft Jahr/Year: 1997 Band/Volume: NS_17 Autor(en)/Author(s): Klocke Annette Artikel/Article: Laubwald-Gesellschaften trockenwarmer Standorte im nördlichen Sollingvorland und im Wesertal bei Bodenwerder 59-79 ©Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschft; www.tuexenia.de; download unter www.zobodat.at Tuexenia 17: 59-79. Göttingen 1997 Laubwald-Gesellschaften trockenwarmer Standorte im nördlichen Sollingvorland und im Wesertal bei Bodenwerder - Annette Klocke - Zusammenfassung Die Laubwälder trockenwarmer Standorte des nördlichen Sollingvorlandes und der Wesertalhänge bei Bodenwerder (Niedersachsen) werden beschrieben und pflanzensoziologisch eingeordnet. An den steilen, meist süd- oder westexponierten und daher trockenen und wärmebegünstigten Kalkhängen siedeln als charakteristische Waldgesellschaften das Carici-Fagetum und dessen Ersatzge sellschaft, das Galio-Carpinetum. Daneben wächst auf wärmebegünstigten, trockenen Buntsandstein hängen das Luzulo-Quercetum. Auf einem kleinflächigen Sonderstandort, auf einer Geröllhalde unter halb eines Muschelkalkfelsens, tritt das Aceri-Tilietum auf. Da recht umfangreiches Material von anthropogenen Eichen-Hainbuchenwäldern vorhegt, wird die Einordnung der Ersatzgesellschaft als Galio-Carpinetum diskutiert. Die bisher meist übliche und auch hier vorgenommene Einordnung derartiger -

Geologischen Karte
{was 5%„47 ._ „_v _..__. ‚äg— I l l J Erläuterungen ll' Geologischen Karte V011 Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 127. wemmummg—.-. Blatt Lnuenheru. .. __—._ Gradabteilung 55, N0. 15. pw__.„._.._.__ ‚- w - BERLIN. Im Vertrieb bei der Königl. Preuß. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, l Berlin N 4, Invalidenstraße 44. l l l I 1906. d g’ä' ‘xKaaaaaaaaaaaaaaaa König]. Universitäts- Bibliothek zu Göttingen. Geschenk ä dess.Kgl Ministeriums der geistlichen, Unterrichts— und Med. Ü] m zu Ber iAngelegenheiten aaaaaaäi m 194;..... l _LaaaaaaaaaaaaaaaaaLiga EIBIJOTHEGA in” MMUAUEMIAE Blatt Lauenbe‘rg‘. 52 Gradabteilung 55 (Breitem Länge 27° 128 °), Blatt N0. 15. 51° Geognostisch bearbeitet durch A. von Koenen, 0. Grupe und M. Schmidt 1898—1902. Erläutert durch A. VON KOENEN. ‚.._ _ 0.......“ Das Blatt Lauenberg enthält noch den südlichsten Teil des Einbeck-Markoldendorfer Beckens, welches im Süden begrenzt wird von den Bergrücken der Forst Grubenhagen mit der Ahls- burg und dem Ellenser Walde mit "seinen Ausläufern. Südlich von jener liegt das nördliche Ende der Weper, welche sich von hier nach Süden bis Hardegsen und Fehrlingsen erstreckt und von der Ahlsburg nur durch flache Einsenkungen und. die Berg- rücken nordöstlich von Fredelsloh getrennt wird. Den größeren Rest des Blattes nimmt der östliche Teil des‘Solling ein, ein aus— gedehntes Waldgebirge mit mehr oder minder ebenen Hoch— flächen, welche durch zahlreiche tiefe Täler und Schluchten un— regelmäßig zerschnitten Werden und im Südwesten sich bis zu 49] m erheben, Während die Ahlsburg auf dem Blatt nur 411 m erreicht, und die Weper nur 369 m. -

Berge Und Täler Im Wechselspiel Der Jahreszeiten Lieblingsplätze in Der Solling-Vogler-Region
Berge und Täler im Wechselspiel der Jahreszeiten Lieblingsplätze in der Solling-Vogler-Region Herausgeber: Solling-Vogler-Region im Weserbergland e.V. Verlag Jörg Mitzkat Holzminden 2013 bildband_solling_vogler.indd 1 14.05.13 16:36 Blick vom Burgberg über Bevern auf Solling und Wesertal Ronny Elis Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliothek; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-940751-65-2 Verlag Jörg Mitzkat www.mitzkat.de Holzminden 2013 Das Wechselspiel der Jahreszeiten verdeutlichen diese zwei Fotos des Wanderweges an der Lenne zwischen Buchhagen und Linse im Herbst und im Sommer. Fotos: Wolfgang Dieffenbach bildband_solling_vogler.indd 2 14.05.13 16:36 Liebe Leser, im Juli 2012 startete das Touristikzentrum Solling-Vogler-Region im Weserbergland einen ganz besonderen Aufruf zur Bürgerbeteiligung: Alle Einwohner der Region wurden dazu aufgefordert, Bilder der persönlichen Lieblingsplätze für die Erstellung eines Bildbandes einzusenden. Die Resonanz war enorm! Mehr als 200 individuelle Eindrücke aus der Solling-Vogler- Region sind dem Touristikzentrum zugeschickt worden. Ob Landschaftsaufnahmen, Stadtbilder oder Fotos von Sehenswürdigkeiten; die eingesandten Motive zeigen die Orte unserer Region, denen die Menschen, die rund um Solling, Vogler und Weser leben, am meisten Bedeutung beimessen. Aus allen Einsendungen finden sich in diesem Bildband die schönsten Aufnahmen aus der Solling-Vogler-Region im Weserbergland wieder. Von der Kirsch- und Rapsblüte im Frühjahr über die Weserschifffahrt im Sommer bis hin zur herbstlichen Stimmung in den Wäldern rund um Ith, Solling und Vogler und der vereisten Weser im Winter. Der Bildband zeigt die persönlichen Lieblingsplätze der Fotografen im Wandel der Jahreszeiten. -

Eifas Und Ahlsburg - Die Struktur Der Schollengrenze Zwischen Hils Und Solling
Mitt. Geol. Inst. Hannover ISSN 0440-2812 38 S. 149-162, 6 Abb. Univ. Hannover Juli 1998 Eifas und Ahlsburg - die Struktur der Schollengrenze zwischen Hils und Solling von Heinz Jordan Kurzfassung: Die Eifas-, Ahlsburg- und Salzderhelden-Überschiebung gelten seit langem als halo tektonisch entstanden, d. h. unter Beteiligung von Zechsteinsalz, das diapirartig in die Überschie bungsbahnen und sonstige Schwächezonen des Deckgebirges eindrang. Die Markoldendorfer Mulde zwischen den Überschiebungen ist in weiten Teilen von Quartär-Ablagerungen verhüllt. Bei der Neuaufnahme des Blattes 4124 Dassel der GK 25 wurde mit zahlreichen Bohrungen und mikropaläontologischer Datierung der Intembau der Mulde sowie ihre West- und Süd-Begrenzung kartiert: Die Ahlsburg-Überschiebung setzt sich nach NW fort und mündet in den Lüthorster Graben, der die Mulde im Westen abschneidet und sich bis zur Sattelstörung des Eifas fortsetzt. Abb. 6 zeigt die SE-verlaufenden Störungen als Grenzen dreier Schollen, die sich nach seismischer Interpretation (Geotektonischer Atlas 1996) mehrfach, abschnittsweise auch gegenläufig bewegt haben. Die NNE-streichenden Grabenstrukturen trennen wie Scharniere diese Abschnitte unterschiedlichen Bewegungsablaufs. Abstract: The Eifas, Ahlsburg, and Salzderhelden overthrusts have been considered for a long time to be halotectonic structures caused by diapiric rise of Zechstein salt into thrust planes and other zones of weakness in the overlying rocks. Much of the Markoldendorf syncline between the overthrusts is covered by Quaternary deposits. The structure of the syncline and its western and southern boundaries were mapped with the help of many boreholes and micropalaeontological dating during remapping of the 1 : 25 000 geological sheet 4124 (Dassel). The Ahlsburg overthrust has now been shown to continue to the NW and to lead into the Lüthorst graben, which truncates the syncline in the west and passes into the crestal fault of the Elfas anticline. -

Beitrag Zur Historischen Kulturlandschaft Für Das RROP Des Landkreises Holzminden
Beitrag zur Historischen Kulturlandschaft für das RROP des Landkreises Holzminden Anlage 3 zu Kapitel 2.1 zum Beteiligungsverfahren 07/2019 Dr. Christian Leiber / Dr. Hilko Linnemann Landkreis Holzminden Holzminden, im Februar 2018 Inhaltsverzeichnis Inhalt Einleitung .................................................................................................................... 4 Gesetzlicher Rahmen.............................................................................................. 4 Gefährdung Historischer Kulturlandschaften und ihrer Elemente ........................... 6 Ziele ........................................................................................................................ 8 Historische Kulturlandschaft im Landkreis Holzminden .............................................. 9 Historisches Landschaftsbild und Wandel der Kulturlandschaft im Landkreis Holzminden ............................................................................................................. 9 Burgen, Schlösser, Klöster ...................................................................................... 9 Siedlung ................................................................................................................ 10 Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft ..................................................................... 11 Sandstein, Kalk und Gips ...................................................................................... 12 Handel und Gewerbe ........................................................................................... -

Spielstätten 2020/2021 Stand: 15.08.2020
Spielstätten 2020/2021 Stand: 15.08.2020 Herren Kreisliga Mannschaft Spielstätte FC 08 Boffzen Boffzen A-Platz, Place-de Villers-sur-Mer, 37691 Boffzen-Zentrum FC Stadtoldendorf II Stadtoldendorf (K), Jahnweg, 37627 Stadtoldendorf MTSV Eschershausen Eschershausen, Jahnstr., 37632 Eschershausen-Zentrum MTV Bevern Bevern A-Platz, Jahnstr. 1, 37639 Bevern-Zentrum MTV Fürstenberg Fürstenberg, Am Waldstadion, 37699 Fürstenberg-Zentrum SCM Bodenwerder Bodenwerder, Poller Str., 37619 Bodenwerder-Zentrum SV 06 Holzminden Holzminden Stadion, Liebigstr., 37603 Holzminden-Zentrum TSV Kirchbrak Kirchbrak, Sportplatzweg, 37619 Kirchbrak-Zentrum SG Lenne/Wangelnstedt II Lenne, Stadtoldendorfer Str. 3, 37627 Lenne-Zentrum TSV Ottenstein Ottenstein, Zum Echternberg 1, 31868 Ottenstein-Zentrum SG Wesertal Polle, Mühlenweg, 37647 Polle-Zentrum VfL Dielmissen Dielmissen, Am Sportplatz 8, 37633 Dielmissen-Zentrum VFR Hehlen Hehlen, Schäferbrink, 37619 Hehlen-Zentrum 1. Kreisklasse Nord Mannschaft Spielstätte FC Eintracht Ammensen e.V. Ammensen, Johannisanger, 31073 Delligsen-Ammensen SCM Bodenwerder II Bodenwerder, Poller Str., 37619 Bodenwerder-Zentrum Delligser SC Delligsen, August-Reuter-Str., 31073 Delligsen-Zentrum SG Eschershausen II/Dielmissen II Dielmissen, Am Sportplatz 8, 37633 Dielmissen-Zentrum TuSpo Grünenplan II Grünenplan, Am Sportplatz, 31073 Grünenplan-Zentrum VFR Hehlen II Hehlen, Schäferbrink, 37619 Hehlen-Zentrum FC Hohe/Brökeln Brökeln, Am Sportplatz, 37619 Brökeln TSV Kaierde Kaierde, Weidenbergweg, 31073 Delligsen-Kaierde TSV Kemnade -

Fachbeitrag Zur Aktualisierung Ausgewählter LRP-Schutzgüter
Fachbeitrag zur Aktualisierung ausgewählter LRP-Schutzgüter – Landkreis Northeim – Teilbericht Landschaftsbewertung Stand 30.06.2020 Auftragnehmer: Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12, D-30159 Hannover Tel.: 0511/ 51 94 97 80 Fax: 0511/ 51 94 97 83 e-mail: [email protected] Bearbeitung: Dipl. Ing. Holger Runge M. Sc. Janna-Edna Bartels Auftraggeber: Landkreis Northeim Fachbereich 44 – Regionalplanung und Umweltschutz Medenheimer Straße 6/8 | 37154 Northeim Tel.: 05551 708-193 Tatiana Fahlbusch PLANUNGSGRUPPE UMWELT Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und Anlass ................................................................................ 5 2 Untersuchungsgebiet ................................................................................. 6 3 Landschaftsbewertung .............................................................................. 8 3.1 Rechtliche Grundlagen ................................................................................. 8 3.2 Methodisches Vorgehen - Erfassung ............................................................ 9 3.2.1 Landschaftstypen ......................................................................................... 9 3.2.2 Erlebniswirksame Einzelelemente .............................................................. 12 3.2.3 Beeinträchtigungen .................................................................................... 12 3.3 Methodisches Vorgehen - Bewertung ......................................................... 12 3.3.1 Bewertung der Landschaftstypen .............................................................. -

Rundtour Am Burgberg-Südhang
Wandern Rundtour am Burgberg-Südhang Länge: 5,64 km Start: Burgbergparkplatz an der B 64 auf der Bergkuppe Steigung:+ 151 m / - 151 m zwischen Negenborn und Lobach. Ziel: Burgbergparkplatz an der B 64 auf der Bergkuppe zwischen Negenborn und Lobach. Überblick großen niedersächsischen Vorkommen des Frauenschuhs befindet sich im Gebiet des Burgbergs. Besucher können Rundwanderung am Südhang des Burgbergs, einem Kleinod Exemplare des Frauenschuhs, der wohl spektakulärsten für Naturliebhaber im Landkreis Holzminden. heimischen Orchidee, zwischen Mitte Mai und Anfang Juni auf Der Weg führt durch Kalkbuchenwälder und vorbei an einer einer Wiese vom Wegesrand aus betrachten. Zeitgleich blüht Fläche, auf der im Frühsommer Orchideen wachsen. Im auf der nur licht mit Bäumen und Wacholder bestandenen Frühjahr überziehen Teppiche von Bärlauch den Waldboden. Fläche bis in den August tiefblau der Wiesensalbei, etwas Der gesamte Höhenzug ist von europaweiter Bedeutung für später erblühen Wilder Majoran, Thymiane und den Naturschutz und deshalb Bestandteil des europäischen Fransenenzian. Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Neben botanischen Besonderheiten treffen Wanderer auf der Rundtour auch auf kulturhistorisch Außergewöhnliches, darunter die Burgruine Everstein und eine Telegraphenstation. Wer den Burgberg auf einer geführten Wanderung erleben möchte, findet im Veranstaltungsprogramm des Naturparks Solling-Vogler namens "Termine für Entdecker" Anregungen. Diese Tour liegt im Naturpark Solling - Vogler. Dieses Projekt wurde im Rahmen des Programmes "Natur erleben" gefördert. Dieses Projekt wurde mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Der südliche Burgberg ist von europaweiter Bedeutung für den Naturschutz (Foto: Naturpark Solling-Vogler). Tourbeschreibung Auf einer Tour am südöstlichen Hang des Burgbergs erleben Wanderer ein nicht alltägliches Waldgebiet: Im Untergrund des Burgbergs befindet sich Muschelkalk; deshalb wächst hier Kalkbuchenwald. -

Erläuterungen (Pdf)
‚7g f1] „.M 9'!*"f - —.. 7...„ “—5‘... _._...‚._ +4— n. l l l l Erläuterungen l ä Geologischen Karte V011 Preußen und benachbarten Bundesstaaten. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt. Lieferung 127. Blatt Bassel. Gradabteilung 55, N0. 9. " r‘ \:-. '\/\.Al\‘.’ h1" r‘ rßnru .. um: r“ u‘u‘d‘ 1’" - N" I‘J‘ I HIN.” ‚i‘d‘yf RAIN/V BERLIN. 1m Vertrieb bei der Königl. Preuß. Geologischen Landesanstalt und Bergakademie, Berlin N 4, Invalidenstraße 44. 1906. äßf: ä Künigl. Universitäts-Bibliothek zu Göttingen. Geschenk des Kgl. Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Med-Angelegenheiten zu Ber in. aaaamaaamaaaaä 190 _____ [26.95 g ex finsuomncn 7 2078148UB1Göttlngen4864 Blatt Dassel. 52. 6 W Gradabteilung 55 70| 26 o), Blatt N0. 9, 51° Geognostiseh bearbeitet durch A. von Koenen, 0. Grupo und M. Schmidt 1898—1903. Erläutert durch A. VON KOENEN. Blatt Dassel enthält in seiner südlichen Hälfte den nördlichen Hauptteil des wenig-hügeligen Beckens von Markoldendorf, welches nach Westen begrenzt wird von dem unregelmäßigen Höhenzuge zwischen Dassel und Wangelnstedt und im Norden durch den ebenso unregelmäßigen, vielfach zerschn‘ittenen Elfas, welcher frei- lieh nach Ostsüdosten bedeutend an Höhe und Breite abnimmt. Nördlich von dessen Steilhang folgt die breite Talniederung von Hallensen -Wenzen - Eimen - Mainzholz’en -Vorwohle , von welcher nach Norden das Gelände zum >>Hils« ansteigt. Der Elfas erhebt sich bis zu 400 m, der Hils auf unserem Gebiete im Osten bis zu 430 m, Während die Ilme bei Hullersen nur 114m über dem Meere liegt. Nordwestlieh von Dassel enthält das Blatt aber noch den Anfang des »Solling«. Die Entwässerung erfolgt für das Markoldendorfer Becken durch die Ilme mit ihren Nebenbächen in die Leine, für die Niede- rung Vorwohle-Hallcnsen durch den Hillebach und das >>Krumme Wasser<<, welches sich bei Einbock ebenfalls in die Ilme ergießt und der Leine zufließt.