Deutsch-Griechische Beziehungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Kaminis' Lightning Quick NY City Trip Greece Feels the Heat, Moves
S O C V th ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ W ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ E 10 0 ΑΠΟ ΤΟ 1915 The National Herald anniversa ry N www.thenationalherald.com A wEEKLy GREEK-AMERIcAN PUBLIcATION 1915-2015 VOL. 18, ISSUE 916 May 2-8 , 2015 c v $1.50 Kaminis’ Greece Feels t1he Heat, Lightning Moves toward Reforms Quick NY To Unblock Loan Flow City Trip ATHENS – Hopes for a deal on Tsipras said in a television in - Greece’s bailout rose after Prime terview that he expected a deal Minister Alexis Tsipras said he would be reached by May 9, in Mayor of Athens expected an agreement could be time for the next Eurozone reached within two weeks and meeting. Spoke on Gov’t the European Union reported a Greece has to repay the In - pick-up in the negotiations. ternational Monetary Fund a to - At Columbia Univ. Greek stocks rose and its sov - tal of almost 1 billion euros by ereign borrowing rates dropped, May 12. It is expected to have TNH Staff a sign that international in - enough money to make that, if vestors are less worried about it manages to raise as much as NEW YORK – Even during a cri - the country defaulting on its it hopes from a move to grab sis, Greece – and even some of its debts in coming weeks. cash reserves from local entities politicians – can rise to the occa - The European Union said like hospitals and schools. sion and present the world with that Greece’s talks with its cred - But it faces bigger repay - examples of good governance. -

Table of Contents 1
Maria Hnaraki, 1 Ph.D. Mentor & Cultural Advisor Drexel University (Philadelphia-U.S.A.) Associate Teaching Professor Official Representative of the World Council of Cretans Kids Love Greece Scientific & Educational Consultant Tel: (+) 30-6932-050-446 E-mail: [email protected]; [email protected] Table of Contents 1. FORMAL EDUCATION ....................................................................................................................................................................... 2 2. ADDITIONAL EDUCATION .............................................................................................................................................................. 2 3. EMPLOYMENT RECORD ................................................................................................................................................................... 2 3.1. Current Status (2015-…) ................................................................................................................................................................. 2 3.2. Employment History ....................................................................................................................................................................... 3 3.2.1. Teaching Experience ................................................................................................................................................................ 3 3.2.2. Research Projects .................................................................................................................................................................... -
A Day of Rage in Greece As Debt Worries Mount
O C V ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Bringing the news ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ to generations of ΑΠΟ ΤΟ 1915 The National Herald Greek Americans c v A wEEkly GREEk AMERICAN PuBlICATION www.thenationalherald.com VOL. 14, ISSUE 698 February 26-March 4 , 2011 $1.50 A Day of Rage in Greece as Debt Worries Mount Back to the Drach? Some Analysts Say Restructuring Inevitable, Is Coming ATHENS – Pumped up by up - loans over three years to keep risings in other countries, more the country from going bank - than 30,000 protesters furious rupt. Prime Minister George Pa - over government-imposed pay pandreou has acknowledged cuts for public workers, tax that generations of profligate hikes and an international cadre overspending by different gov - of lenders who have nearly ernment administrations has taken control of the country’s fi - created the crisis he said left nances, clashed with riot police him no chance but to seek in - on Feb. 23 during a day-long ternational help, but at a price general strike that shut down many citizens said is too heavy businesses, services and trans - and has exempted the rich and portation. Graffiti calling for a politicians they blame for the “Day of Rage,” the calling cry of dilemma. Protesters chanting demonstrators who overthrew “Don’t obey the rich — Fight the Egyptian government and back!” marched to Parliament set off a spate of uprisings in as the city center was heavily Yemen and Libya and unease in policed. northern Africa and the ISLANDS NOT FOR SALE Mideast, was sprawled on walls The assault on Parliament, in the capital -
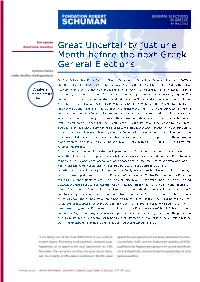
Download/Print the Study in PDF Format
GENERAL ELECTIONS IN GREECE 6th May 2012 European Elections monitor Great Uncertainty just one Month before the next Greek General Elections Corinne Deloy (with Stellina Galitopoulou) On 31st October last Prime Minister George Papandreou (Panhellenic Socialist Movement, PASOK) announced the organisation of a referendum on the rescue plan for Greece approved by the Euro- Analysis pean Union on 27th October in Brussels. The latter aimed to help Greece pay off its debts but obliged 1 month before the country to submit to economic supervision and to implement a stricter austerity regime. The the poll announcement was the source of stupor and indignation in Greece and across all of Europe – it sent the European, American and Asian stock exchanges into disarray and surprised the financial markets. “It’s suicide”, declared Michalis Matsourakis, chief economist at the Greek Alpha Bank, who perceived an attempt on the part of George Papandreou to break out of his solitude and the political crisis that was undermining the country as he pushed the opposition parties, which until now had categorically refused to support the strict austerity measures taken by the government, to adopt a position on the European plan, in order to calm the social protest movement that went together with a sharp decline in living standards. The Prime Minister, who was finding it increasingly difficult to find support within his own socialist party and the ministers of his government, had already suggested to the opposition that they create an alliance in the shape of a government coalition in June 2011. The right however, rejected this proposal. -

Greek Whisky : the Localization of a Global Commodity Bampilis, T
Greek whisky : the localization of a global commodity Bampilis, T. Citation Bampilis, T. (2010, February 10). Greek whisky : the localization of a global commodity. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/14731 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the License: Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/14731 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). GREEK WHISKY THE LOCALIZATION OF A GLOBAL COMMODITY TRYFON BAMPILIS ii Printed by Wöhrmann Print Service © 2010, T. Bampilis, Leiden, The Netherlands ISBN 978-90-9025132-5 iii Greek whisky The localization of a global commodity PROEFSCHRIFT Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op woensdag 10 februari 2010 klokke 15.00 uur Door Tryfon Bampilis Geboren te Athene, Griekenland In 1978 iv PROMOTIECOMMISSIE Promotor: Prof. Dr. P.Pels Overige Leden: Prof. Dr. P. Geschiere (UVA) Prof. Dr. P. Spyer Dr. G. Agelopoulos (University of Macedonia, GR) Dr. P. ter Keurs This research was financially supported by a PhD fellowship in social anthropology from the State Scholarship Foundation of Greece (IKY) v !"# $% &%$'(# &)* +#" ,$% &-.&% $)* /#$'(# &)* To my mother and the memory of my father vi vii Contents Acknowledgments xi List of Figures xiii Note on transliteration xv Part One 1. Introduction: the social life of whisky 1 Materiality 5 Mass commodities: the things of modernity 9 Commodity consumption and globalization 14 Performances of consumption in relation to style 18 The cultural context of consuming alcohol in Greece 19 Recent history 19 Drinking alcohol in Greek ethnography 24 To “follow the thing” 27 The scope of following things and commodities 27 Research and fieldwork 29 Argument and description of the parts of the study 32 2. -

The Greek Publishing Market During the Economic Crisis: Resilience, Innovation & Change
The Greek Publishing Market during the economic crisis: Resilience, Innovation & Change Socrates Kabouropoulos Book Policy Working Group (BPWG) Minister’s Office, Ministry of Culture 68th Frankfurt Book Fair, 19-23 October 2016 1 68th Frankfurt Book Fair, 19-23 October 2016 2 Number of books published (read) every year Decline in the number of new book titles published from 10,680 titles in 2008 to appr. 6,700 titles in 2015 (-37%) New titles by subject: Literature (including fiction, nonfiction & poetry) 27% Social & Human Sciences 22% Children’s Books 18% other (Practical & Self Help Books, School Books, Pure & Applied Sciences, Art) 33% Average print runs: novels-2,000 copies, poetry & essays-500 to 800 copies. A true bestseller is expected to sell 7.000 - 40.000 copies. Hardboiled bestsellers (only very few) have sold 100.000 to 500.000 copies (i.e. J.K.Rowling, Dan Brown, E.L.James, V. Hislop, et.al.) 68th Frankfurt Book Fair, 19-23 October 2016 3 Book reading statistics Population size: 11 million, <50% Book readers 42,3% over 15 yo read at least one book per year (source: National Book Centre, Reading Behaviour Survey, 2010) 34,2% read 1 to 9 books/year 8,1% read over 10 books/year (appr. 780.000), of which: 1,7% read over 25 books/year (appr. 150.000) [Average: 5,9 books/year, Median: 3 books/year] 16,9% read books only for their professional/educational needs 40,7% read no books at all [Hoping to change that through our Educational & Cultural policies!] 68th Frankfurt Book Fair, 19-23 October 2016 4 Book reading -

Zeitgeist Media Group Literary Agency Frankfurt Rights Catalogue 2012
! ! ! ! ZEITGEIST MEDIA GROUP LITERARY AGENCY FRANKFURT RIGHTS CATALOGUE 2012 ! 1! Zeitgeist Media Group is a unique literary agency. We represent a distinctive array of Australian, American, British, European, and Chinese authors from our Sydney & Brussels offices. ‘China’ stories have been our passion and we have a number of fascinating works of fiction and non- fiction that break new ground. Setting us apart from other agencies is our Zeitgeist media department, giving us the capacity to generate unsurpassed media exposure for our authors. We hope you enjoy what we have to offer. Warm regards, Benython, Sharon and Emma http://www.zeitgeistmediagroup.com/ !!! ! ! ! ! Benython Oldfield Sharon Galant Emma Nicholas Sydney Agent Europe Agent Sydney Agent Level 1, 142 Smith Street Ave du Vert Chasseur 8A Level 1, 142 Smith Street Summer Hill, Sydney 1180 Brussels Summer Hill, Sydney NSW, 2130 Australia Belgium NSW, 2130 Australia +61 2 8060 9715 +32 479 262 843 +61 2 8060 9715 benython@ sharon@ emma@ zeitgeistmediagroup.com zeitgeistmediagroup.com zeitgeistmediagroup.com ! 2! Fiction pg. 3 Jasper Jones by Craig Silvey pg. 4 The Amber Amulet by Craig Silvey pg. 5 The Burial by Courtney Collins pg. 6 Amber Road by Boyd Anderson pg. 7 Errol, Fidel and the Cuban Rebel Girls by Boyd Anderson pg. 8 The 13th Tablet by Alex Mitchell pg. 9 Fractured by Dawn Barker pg. 10 Ideal Love by Alice Burnett pg. 11 Leave Me Alone: A Novel of Chengdu & Dancing Through Red Dust by Murong pg. 12 The Missing Ingredient by Murong pg. 13/14 New writing from China: Modern Chinese Masters pg. -

Downloaded 4.0 License
chapter 8 A Child among the Ruins: Some Thoughts on Contemporary Modern Greek Literature for Children Przemysław Kordos I admit that the title of this chapter may be misleading at first glance. Greece is by no means a country of ruins, or a ruined country, and ancient archaeologi- cal sites (“ruins”) are relatively scarce. In fact, in some regions of this beautiful country, such as Thrace or Thessaly, one can hardly find such attractions. On the other hand, the two main cities, Athens and Thessaloniki, which house probably up to 40% of the country’s population, are built around vast and well-exposed ancient sites. The Athenian Acropolis is the city’s most impor- tant landmark, helping substantially in navigating the chaotic city centre. In Thessaloniki the excavations mingle seamlessly with housing districts, shop- ping areas, and recreational parks, and are located near busy streets. So a Greek child has an excellent chance of living close to some ruins. The other, even more universal means of encountering Greek ruins is the standard school curriculum, which revolves around ancient history, tradi- tion, and literature. Textbooks abound in pictures and drawings that proudly present their ancient heritage to Greek children. The role of the educational system is very important in shaping the attitudes of future citizens. I will come back to this issue later on, but first I will start with a personal note. Although this chapter analyses several books for children written by Greek authors in the past few decades, it is by no means reduced solely to literary criticism. I propose a daring approach both in regard to classical reception and children’s literature studies—one that results from my primary formation, which is ethnography and my practice in this field, which comprises research- ing the Modern Greeks for fifteen years now. -
Ex-CIA Officer Kiriakou to Get 30-Month Sentence
S O C V ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Bringing the news W ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ to generations of E ΑΠΟ ΤΟ 1915 The National Herald Greek- Americans N c v A weekly GReek-AMeRIcAN PublIcATION www.thenationalherald.com VOL. 16, ISSUE 796 January 12-18, 2013 $1.50 Greek PM Ex-CIA Officer Kiriakou to Get 30-month Sentence Samaras Intelligence Officer Back in Leaked Colleague’s Germany Name to Reporter By Scott Shane Told Chancellor The New York Times WASHINGTON, DC – Looking Merkel Greeks back, John C. Kiriakou admits he should have known better. But Did Their Part when the F.B.I. called him a year ago and invited him to stop by By Andy Dabilis and “help us with a case,” he did TNH Staff Writer not hesitate. In his years as a C.I.A. opera - ATHENS – Returning to Berlin tive, after all, Mr. Kiriakou had for the second time since he worked closely with F.B.I. agents took office last year, Greek overseas. Just months earlier, he Prime Minister Antonis Samaras had reported to the bureau a re - told German Chancellor Angela cruiting attempt by someone he Merkel that Greeks had done believed to be an Asian spy. their part to stay in the Euro - “Anything for the F.B.I.,” Mr. zone as he gave her an update Kiriakou replied. on reform efforts his uneasy Only an hour into what began coalition government has under - as a relaxed chat with the two taken. agents — the younger one who “I would like to make clear traded Pittsburgh Steelers talk from the start that our country with him and the senior investi - is making an enormous effort, gator with the droopy eye — did which goes hand-in-hand with he begin to realize just who was great sacrifices, to get things on the target of their investigation. -

Download Frei Verfügbar Als Ebook
HELLENIKA Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen Neue Folge 9 Herausgeber Vereinigung der deutsch-griechischen Gesellschaften Redaktion: Cay Lienau unter Mitarbeit von Anastasios Katsanakis Elmar Winters-Ohle LIT Zusendung von Manuskripten und von Büchern zur Besprechung an Prof. Dr. Cay Lienau, Zumsandestr. 36, 48145 Münster, Fax 0 251 – 1 36 72 94, e-Mail: [email protected]. Bei unverlangt eingesandten Manuskripten behält sich die Redaktion eine Veröffentlichung vor; gleiches gilt für die Besprechung nicht angeforderter Bücher. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 15. 7. 2015 Redaktion: Cay Lienau, Zumsandestraße 36, 48145 Münster Fax: 0 251 – 1 36 72 94, e-Mail: [email protected] Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-643-99820-0 ISSN 0018-0084 © LIT VERLAG Dr. W. Hopf Berlin 2014 Verlagskontakt: Fresnostr. 2 D-48159 Münster Tel. +49 (0) 2 51-62 03 20 Fax +49 (0) 2 51-23 19 72 E-Mail: [email protected] http://www.lit-verlag.de Auslieferung: Deutschland: LIT Verlag Fresnostr. 2, D-48159 Münster Tel. +49 (0) 2 51-620 32 22, Fax +49 (0) 2 51-922 60 99, E-Mail: [email protected] Österreich: Medienlogistik Pichler-ÖBZ, E-Mail: [email protected] E-Books sind erhältlich unter www.litwebshop.de 1 Vorwort Seit nunmehr 50 Jahren besteht in diesem Jahr die jetzt als Jahrbuch erscheinende Zeitschrift HELLENIKA. 1964 von der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften aus der Taufe gehoben, wurde sie anfänglich von dem Publizisten Johannes Gaitanides, dem Autor von „Griechenland ohne Säulen“, dann über Jahrzehnte von der Bochumer Neogräzistin Helga Heitmann Prof. -

Challenging Greek History-By-Slogans
Challenging Greek History-By-Slogans By Victor Bivell Thank you Dushan and the Australian Macedonian Literary Association. I'm very happy to launch these two short and very interesting books - The Little Book of Big Greek Lies by Risto Stefov in Canada, and Ancient Greek and Other Ancient Testimonies About the Unique Ethnic Distinctness of the Ancient Macedonians by Aleksandar Donski in Macedonia. Let me start with the obvious - that Greek Government lies are very topical at present. They are on the front pages of the newspapers and often the lead stories on the nightly TV news. They've been there for a couple of years, and that is where they are likely to stay for a few more years while the Eurozone debt crisis gets sorted, and the Greek economy continues in recession. We've all seen the TV news with the dramatic demonstrations and riots in Athens and outside the Greek parliament. The reporters tell us the Greek people are calling their own government "Liars" and "Thieves". I saw one photograph of a demonstrator with a sign in English that said exactly those words - "Liars & Thieves", and I thought: that guy could be a Macedonian. Because the Macedonians have been calling the Greek Government liars and thieves for over a hundred years. The Greek Government lied about Macedonia when it was under the Turks, saying there no Macedonians there, that they were Greeks. Then it stole half of Macedonia in 1912-13 when it sent in the Greek army, and it has been lying about Macedonia ever since. -

Greek Books in Translation 2013-2015
75$16/$7,21&29(5SGI 1 GREEK BOOKS IN TRANSLATION 2013-2015 2 HELLENIC FOUNDATION FOR CULTURE Latest transLated pubLications this catalogue includes the majority of Greek literary works translated and published into foreign languages during the last two years, giving an 3 insight into current Greek literary production. Foreign publishers interested in establishing contact with Greek publishers may consult the electronic catalogue of Greek publishers, hosted through the new web page of Hellenic Foundation for culture: hfc-worldwide.org We would like to express our thanks to the Greek publishers and to the literary agencies: Ersilia Literary Agency (www.ersilialit.com), and Iris Literary Agency (www.irisliteraryagency.gr) for providing us with the information regarding Greek books in translation. Fiction Melpo Axioti Difficult Nights Novel Kedros publications, 1981 232 pp. ISBN: 978-960-04-1710-4 translated into French Nuits Difficiles Éditions de la différence, 2014 ISBN: 978-2-7291-2103-7 tHe BooK Youthful freshness – bright summers of a young girl on Mykonos, dull winters at the nuns’ school, a bumpy landing in athens and acquaintance with love, all complete the journey from childhood to womanhood. tHe AUtHoR Melpo axioti is one of the most important writers of the 30s generation. Her novel The Twentieth Century has been translated into French, italian, German, russian and romanian. C.p. CAvAfy 4 Selected Poems Poetry translated into French Choix de Poèmes aiora press, 2015 98 pp. ISBN: 978-618-5048-31-0 tHe BooK cavafy is by far the most translated and most well-known Greek poet interna- tionally.