Ih Cffecnaig%' LED)(1 31), ©0 Cil 52 \
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geheimdienste
1 | 2016 Preis: GLOBAL 3,– Euro VIEWUnabhängiges Magazin der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) und des Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA) Geheimdienste http://www.globalview.at ISSN: 1992-9889 DVR: 0875538 Nr.1/2016; global view cover 1/2016.indd 1 11.04.16 09:57 Mit einem Beitrag von Rudolf Hundstorfer Bitte gehen Sie wählen! Die Bundespräsidenten Wahl naht und wir möchten an Sie appellieren, von Ihrem Wahl- recht Gebrauch zu machen. Gehen Sie zur Wahl und bestimmen Sie mit, wer die nächsten 6 Jah- re unser Staatsoberhaupt sein soll. Weder das AFA noch die ÖGAVN können aufgrund Ihrer Überparteilichkeit eine Wahlempfehlung abge- ben, aber Sie zumindest bitten, Ihrer demokra- tischen Pflicht nachzukommen und wählen zu gehen. Wir möchten Ihnen hier auch einige Bücher von den Kandidatinnen und Kandidaten bzw. ein Buch, in dem zwei Kandidaten einen Beitrag verfasst haben, präsentieren. Zudem natürlich auch die Bücher unseres amtierenden Staats- oberhaupts und seiner „First Lady“. Liebe Leserin! Lieber Leser! Dear Readers! Jeder kennt ihn, viele begehren ihn, viele fürch- gehrten James-Bond-Filmen, entsprechen ver- ten ihn: Die Rede ist von Mr. Bond, James Bond. mutlich (noch) nicht der Realität, aber dennoch Der wohl bekannteste Geheimagent der Welt ist werfen wir einen Blick auf das Land, in dem ei- zwar nur Fiktion in Ian Flemmings Geschichten, ner der Nobelkarosen unseres Vorzeigeagenten, aber der Stereotyp eines „Geheimdienstlers“ ein BMW, produziert wird, und beleuchten den ist geschaffen. Gut aussehend, charmant, stark Waffenhandel der Bundesrepublik Deutschland. und den Bösewichten immer um einen Schritt Den so wertvollen Treibstoff für diese Autos pro- voraus. -

An Unfinished Debate on NATO's Cold War Stay-Behind Armies
The British Secret Service in Neutral Switzerland: An Unfinished Debate on NATO’s Cold War Stay-behind Armies DANIELE GANSER In 1990, the existence of a secret anti-Communist stay-behind army in Italy, codenamed ‘Gladio’ and linked to NATO, was revealed. Subsequently, similar stay-behind armies were discovered in all NATO countries in Western Europe. Based on parliamentary and governmental reports, oral history, and investigative journalism, the essay argues that neutral Switzerland also operated a stay-behind army. It explores the role of the British secret service and the reactions of the British and the Swiss governments to the discovery of the network and investigates whether the Swiss stay-behind army, despite Swiss neutrality, was integrated into the International NATO stay-behind network. INTRODUCTION During the Cold War, secret anti-Communist stay-behind armies existed in all countries in Western Europe. Set up after World War II by the US foreign intelligence service CIA and the British foreign intelligence service MI6, the stay-behind network was coordinated by two unorthodox warfare centres of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), the ‘Clandestine Planning Committee’ (CPC) and the ‘Allied Clandestine Committee’ (ACC). Hidden within the national military secret services, the stay-behind armies operated under numerous codenames such as ‘Gladio’ in Italy, ‘SDRA8’ in Belgium, ‘Counter-Guerrilla’ in Turkey, ‘Absalon’ in Denmark, and ‘P-26’ in Switzerland. These secret soldiers had orders to operate behind enemy lines in -
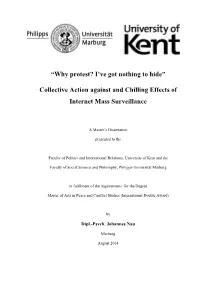
“Why Protest? I've Got Nothing to Hide” Collective Action Against And
“Why protest? I’ve got nothing to hide” Collective Action against and Chilling Effects of Internet Mass Surveillance A Master’s Dissertation presented to the Faculty of Politics and International Relations, University of Kent and the Faculty of Social Science and Philosophy, Philipps-Universität Marburg in fulfilment of the requirements for the Degree Master of Arts in Peace and Conflict Studies (International Double Award) by Dipl.-Psych. Johannes Nau Marburg August 2014 ! “Why protest? I’ve got nothing to hide” - Collective Action against and Chilling Effects of Internet Mass Surveillance A Master’s Dissertation presented to the Faculty of Politics and International Relations, University of Kent and the Faculty of Social Science and Philosophy, Philipps-Universität Marburg in fulfilment of the requirements for the Degree Master of Arts in Peace and Conflict Studies (International Double Award) Word Count: 14790 Copyright © 2014 Johannes Nau This work is licensed under a Creative Commons Attribution – Non-commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) The content of this master’s dissertation may be used, shared and copied on the condition that appropriate credit is given to the author, indication of changes are made and the material is used for non-commercial purposes only. The full-length legal code / license can be accessed under: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode ! Acknowledgments In preparation for this thesis, I have received support from various people whom I would like to thank. First of all I want to give credit to my supervisors from Marburg and Canterbury Prof Dr Wagner and Dr Morgan-Jones for the friendly, competent and reliable supervision and support. -

Impersonal Names Index Listing for the INSCOM Investigative Records Repository, 2010
Description of document: US Army Intelligence and Security Command (INSCOM) Impersonal Names Index Listing for the INSCOM Investigative Records Repository, 2010 Requested date: 07-August-2010 Released date: 15-August-2010 Posted date: 23-August-2010 Title of document Impersonal Names Index Listing Source of document: Commander U.S. Army Intelligence & Security Command Freedom of Information/Privacy Office ATTN: IAMG-C-FOI 4552 Pike Road Fort George G. Meade, MD 20755-5995 Fax: (301) 677-2956 Note: The IMPERSONAL NAMES index represents INSCOM investigative files that are not titled with the name of a person. Each item in the IMPERSONAL NAMES index represents a file in the INSCOM Investigative Records Repository. You can ask for a copy of the file by contacting INSCOM. The governmentattic.org web site (“the site”) is noncommercial and free to the public. The site and materials made available on the site, such as this file, are for reference only. The governmentattic.org web site and its principals have made every effort to make this information as complete and as accurate as possible, however, there may be mistakes and omissions, both typographical and in content. The governmentattic.org web site and its principals shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damage caused, or alleged to have been caused, directly or indirectly, by the information provided on the governmentattic.org web site or in this file. The public records published on the site were obtained from government agencies using proper legal channels. Each document is identified as to the source. -

Sismi-Telecom» Trial
Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2016”, 5th to 9th of September 2016, Perugia, Italy Conference proceedings CYBER-SECURITY IN ITALY: ON LEGAL ASPECTS OF THE «SISMI-TELECOM» TRIAL Giovanni Luca Bianco, Ph.D. Ionian Departament of Law Economics and Environment University of Bari e-mail: [email protected] Bari, Italy Abstract «SISMI-Telecom scandal», as it is known in Italy, is illegal phone tapping by some people in charge of security at the Telecom Italia Company. The case became common knowledge in September 2006 because 34 people were indicted and there were 21 provisional arrests among many employees at Telecom Italia, among national police and members of the Carabinieri Corps (paramilitary police of the Italian Armed Forces) and of the Guardia di Finanza (Inland Revenue Police)». In 2010, some journalists revealed what was happening and stated that thousands of people had been secretly put under unauthorised surveillance by Telecom Italia and illegal dossiers had been created. People’s lives were monitored as well as their bank accounts; even the data banks of the Italian Ministry of the Interior were accessed. Ultimately, the SISMI-Telecom trial ended with very mild sentences between settlements and state secrets. Yet, in the information age, the SISMI-Telecom scandal can be considered “dead” only from a procedural point of view. According to the interpretation of some experts on the case, the famous law that has destroyed and ordered the destruction of those dossiers, is a suicide law because those files were all in electronic format, and of course continue to circulate and keep producing poisons. -

Report on the Democratic Oversight of the Security Services
Strasbourg, 15 December 2015 CDL-AD(2015)010 Or. Engl. Studies no. 388 / 2006 and no.719/2013 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) REPORT ON THE DEMOCRATIC OVERSIGHT OF THE SECURITY SERVICES Adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007) On the basis of comments by Mr Iain Cameron (Substitute member, Sweden) Mr Olivier Dutheillet de Lamothe (Substitute member, France) Mr Jan Helgesen (Member, Norway) Mr Valery Zorkin (Member, Russian Federation) Mr Ian Leigh (Expert, United Kingdom) Mr Franz Matscher (Expert, Austria) Updated by the Venice Commission at its 102nd Plenary Session (Venice, 20-21 March 2015) On the basis of comments by Mr Iain Cameron (Member, Sweden) This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. http://venice.coe.int CDL-AD(2015)010 - 2 - TABLE OF CONTENTS Executive Summary .................................................................................................................... 4 The need to control security services .......................................................................................... 4 Accountability .............................................................................................................................. 4 Parliamentary Accountability ....................................................................................................... 5 Judicial review and authorisation ................................................................................................ 6 -

Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards And
FREEDOMS FRA Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU and remedies safeguards rights fundamental services: intelligence by Surveillance Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU Mapping Member States’ legal frameworks This report addresses matters related to the respect for private and family life (Article 7), the protection of personal data (Article 8) and the right to an effective remedy and a fair trial (Article 47) falling under Titles II ‘Freedoms’ and VI ‘Justice’ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Photo (cover & inside): © Shutterstock More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). FRA – European Union Agency for Fundamental Rights Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria Tel. +43 158030-0 – Fax +43 158030-699 fra.europa.eu – [email protected] Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 Paper: 978-92-9239-944-3 10.2811/678798 TK-04-15-577-EN-C PDF: 978-92-9239-943-6 10.2811/40181 TK-04-15-577-EN-N © European Union Agency for Fundamental Rights, 2015 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged. Printed in Luxembourg Printed on process chlorine-free recycled paper (PCF) Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU Mapping Member States’ legal frameworks Foreword Protecting the public from genuine threats to security and safeguarding fundamental rights involves a delicate bal- ance, and has become a particularly complex challenge in recent years. -
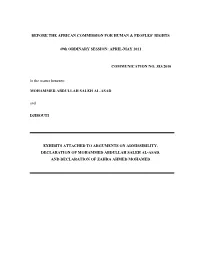
Exhibits Attached to Arguments on Admissibility, Declaration of Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad, and Declaration of Zahra Ahmed Mohamed
BEFORE THE AFRICAN COMMISSION FOR HUMAN & PEOPLES’ RIGHTS 49th ORDINARY SESSION: APRIL-MAY 2011 COMMUNICATION NO. 383/2010 In the matter between: MOHAMMED ABDULLAH SALEH AL-ASAD and DJIBOUTI EXHIBITS ATTACHED TO ARGUMENTS ON ADMISSIBILITY, DECLARATION OF MOHAMMED ABDULLAH SALEH AL-ASAD, AND DECLARATION OF ZAHRA AHMED MOHAMED EXHIBITS The United Republic of Tanzania Departure Declaration Card, 27 December 2003…….A Center for Human Rights and Global Justice, On the Record: U.S. Disclosures on Rendition, Secret Detention, and Coercive Interrogation (New York: NYU School of Law, 2008)………………………………………………………………………………..B Letter to the Attorney General of Djibouti, 31 March 2009…….….…..…….…….….…C United Nations Human Rights Council, 13th Session, Joint Study on Global Practices in Relation to Secret Detention in the Context of Countering Terrorism, U.N. Doc. A/HRC/13/42 (19 February 2010)………………………………………………………. D Republic v. Director of Immigration Services, ex parte Mohammed al-Asad (Habeas Corpus petition), High Court of Tanzania, 17 June 2004………………………………...E Amnesty International, United States of America: Below the radar- Secret flights to torture and ‘disappearance,’ 5 April 2006……………………………………………….F Prepared Remarks of Treasury Secretary John Snow to Announce Joint U.S. and Saudi Action Against Four Branches of Al-Haramain in the Financial War on Terror, JS-1107, 22 January 2004…………………………………………………………………………..G Henry Lyimo, Guardian (Dar es Salaam), Yemenis, Italians Expelled, 30 December 2003…………………………………………………………………………………...….H Roderick Ndomba, Daily News (Dar es Salaam), Dar Deports 2,367 Aliens, 30 December 2003……...……………………………..………………………………………………….I International Committee of the Red Cross, ICRC Report on the Treatment of Fourteen “High Value Detainees” in CIA Custody, 2007…………………………..……….……...J International Seismological Centre Earthquake Data…………………………………….K U.S. -

The Italian Intelligence Establishment: a Time for Reform, 21 Penn St
Penn State International Law Review Volume 21 Article 4 Number 2 Penn State International Law Review 1-1-2003 The tI alian Intelligence Establishment: A Time for Reform Vittorfranco S. Pisano Follow this and additional works at: https://elibrary.law.psu.edu/psilr Part of the International Law Commons Recommended Citation Vittorfranco S. Pisano, The Italian Intelligence Establishment: A Time for Reform, 21 Penn St. Int'l L. Rev. 263 (2003). This Article is brought to you for free and open access by the Law Reviews and Journals at Penn State Law eLibrary. It has been accepted for inclusion in Penn State International Law Review by an authorized editor of Penn State Law eLibrary. For more information, please contact [email protected]. I Articles I The Italian Intelligence Establishment: A Time for Reform? Vittorfranco S. Pisano* I. Introduction In the area of comparative studies, the Italian intelligence establishment should be a matter of interest for jurists, political scientists, and intelligence professionals of various nationalities. Regrettably, this topic has to date drawn primarily the attention of the media, both in Italy and abroad, with a focus on alleged institutional abuses and conspiracy theories.' * Vittorfranco S. Pisano currently teaches intelligence and security courses at the University of Malta's Link Campus in Rome, Italy. A specialist in international security affairs and author of numerous books and articles, Dr. Pisano has been a consultant of the U.S. Senate Subcommittee on Security and Terrorism and a reviewer of courses offered by the U.S. Department of State Anti-Terrorism Assistance Program. A former Senior Legal Specialist with the European Law Division of Library of Congress, he holds a Master of Comparative Law from Georgetown University and a Doctoral Degree in Juridical Science from the University of Rome, with a dissertation in comparative legal systems, and is a graduate of the U.S. -

National Security and Secret Evidence in Legislation and Before the Courts
National Security and Secret Evidence in Legislation and before the Courts: Exploring the Challenges Didier Bigo, Sergio Carrera, Nicholas Hernanz and Amandine Scherrer No. 78/ January 2015 Abstract This study provides a comparative analysis of the national legal regimes and practices governing the use of intelligence information as evidence in the United Kingdom, France, Germany, Spain, Italy, the Netherlands and Sweden. It explores notably how national security can be invoked to determine the classification of information and evidence as 'state secrets' in court proceedings and whether such laws and practices are fundamental rights- and rule of law-compliant. The study finds that, in the majority of Member States under investigation, the judiciary is significantly hindered in effectively adjudicating justice and guaranteeing the rights of the defence in ‘national security’ cases. The research also illustrates that the very term ‘national security’ is nebulously defined across the Member States analysed, with no national definition meeting legal certainty and “in accordance with the law” standards and a clear risk that the executive and secret services may act arbitrarily. The study argues that national and transnational intelligence community practices and cooperation need to be subject to more independent and effective judicial accountability and be brought into line with EU 'rule of law' standards. This document was originally commissioned by the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and published in December 2014. It is available for free downloading on the European Parliament’s website (www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509 991_EN.pdf) and is republished by CEPS with the kind permission of the Parliament. -

Expulsion of Sov Representatives Jan 1987.P65
Foreign Affairs Note United States Department of State Washington, D.C. EXPULSIONS OF SOVIET OFFICIALS WORLDWIDE, 1986 January 1987 Background Highlights Over the years, Soviet diplomats of all ranks-from ambassa- dors and ministers counselor to administrative personnel such Background 1 as library employees, translators, and clerks-have been Expulsions in 1986 2 accused of espionage and expelled from the foreign countries Expulsion Cases: 1970-85 4 to which they had been assigned. Individuals from Soviet Espionage at the UN 13 nondiplomatic occupations have also been expelled, including Bibliography 13 correspondents from TASS, Moscow Radio, Novosti, the Alphabetical List 14 newspapers Pravda, Komsomolskaya Pravda, Izvestiya , Sotsialisticheskaya Industriya, and the weekly magazine New The expulsions of Soviet representatives from foreign Times; Aeroflot and Morflot officials; trade union officials; countries continued throughout 1986. Host governments in UN employees; employees of other international bodies such six countries last year expelled 19 Soviet officials for as the International Wheat Council, the International Cocoa espionage and related activities, down from 57 in 1985, Organization, the International Labor Organization, and the according to publicly available information. All six-France, International Civil Aviation Organization; officials of the Italy, Portugal, Sweden, Switzerland, and the United Moscow Narodny Bank and Soviet state companies States-had expelled Soviet officials in previous years.1 Mashniborintorg and -

Anhang A: Übersicht Über Die Wichtigsten Geheimdienste
Anhang A: Übersicht über die wichtigsten Geheimdienste Afghanistan NDS – National Directorate of Security Ägypten GIS – Jihaz al-Mukhabarat al-Amma Argentinien SIDE – Secretaria de Inteligencia del Estado Australien ASIS – Australian Secret Intelligence Service DSD – Defense Signals Directorate Belgien SGR – Service Generale des Renseingnements Brasilien ABIN – Angecia Brasiliera de Inteligencia Bulgarien NSS – Natsionalja Sluzhba za Sigurnost NIS – Natsionalja Informatsionna Sluzhba Pri Minister- kiya S’vet Chile ANI – Agencia Nacional de Inteligencia China MSS – Guojia Anaquaanbu MID – Zhong Chan Er Bu 3VBA – Zhong Chan San Bu Dänemark FE – Forsvarets Efterretningstjeneste PET – Politiets Efterretningstjeneste Deutschland BND – Bundesnachrichtendienst BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz MAD – Militärischer Abschirmdienst BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech- nik IKTZ der Bundespolizei Das BKA – Bundeskriminalamt und die LKAs – Landeskriminalämter müsste man in Deutschland eigentlich schon mit zu den Diensten zählen. Da unsere verfassungsrechtliche Lage immer stärker aufgeweicht wird von z.B. Politikern wie Wolfgang Schäuble als Minister des Inneren a.D., der das Trennungsgebot von Polizei und Diensten zu umgehen versucht, sehen Kritiker in den Reformen des BKA-Gesetzes eine Aufweichung dieses Grundsatzes, da polizeiliche Maß- nahmen zur Extremismus- und Gefahrenabwehr im Vorfeld exekutiver Maß- nahmen immer stärker den präventiven Beobachtungsauftrag der Verfassungs- schutzbehörden berühren. Hier kann sich das Legalitätsprinzip