Bacillus Subtilis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Rcs Phosphorelay May Regulate the E. Coli Capsule Response to Sublethal Streptomycin Treatment
Journal of Experimental Microbiology and Immunology (JEMI) Copyright © April 2015, M&I UBC The Rcs Phosphorelay May Regulate the E. coli Capsule Response to Sublethal Streptomycin Treatment Iris Luo, Josh Wiebe, Yunan Liu Department of Microbiology and Immunology, University of British Columbia The Escherichia coli colanic acid capsule produced by the cps gene confers resistance in the presence of sublethal antibiotic concentrations. However, the exact mechanism of capsule gene regulation in reaction to the presence of antibiotics is unknown. The two main proposed cps regulation pathways both involve the Rcs phosphorelay system, but differ regarding dependence on RpoS for cps transcription. In this study, we explored the changes in capsule formation and antibiotic resistance in response to treatment with sublethal concentrations of streptomycin using deletion mutants of the two proposed regulation pathways. Wild type, Δ rcsB, Δ rpoS, and Δ cps. E. coli strains were incubated in sublethal concentrations of streptomycin. When examined with MIC assays, the deletion mutants showed higher levels of antibiotic resistance compared to wild type strains of E. coli. We also demonstrated that capsule production was induced under sublethal streptomycin conditions with Maneval staining. Furthermore, qPCR detection of cps transcription indicated downregulation in Δ rcsB strains and upregulation in Δ rpoS after streptomycin treatment. Together, these results suggest that E. coli streptomycin resistance is not dependent on capsule production, and that rcsB and rpoS may both play a role in cps regulation when treated with sublethal doses of streptomycin. Escherichia coli are rod shaped bacteria capable of producing a polysaccharide capsule. The capsule is important for protection from desiccation, survival during oxidative stress, bacterial virulence, and antibiotic resistance (1). -

The Reduction of T7 Phage Adsorption in Escherichia Coli B23 Cells Treated with Sub-Lethal Levels of Kanamycin
Journal of Experimental Microbiology and Immunology (JEMI) Vol. 13:89-92 Copyright © April 2009, M&I UBC The Reduction of T7 Phage Adsorption in Escherichia coli B23 Cells Treated with Sub-Lethal Levels of Kanamycin Joanne Bleackley, Jesse Cooper, Monica Kaminski and Stephanie Sandilands Department of Microbiology & Immunology, UBC The production of capsular material has been implicated as a bacterial defence mechanism against certain antibiotics and against phage adsorption. The capsule acts to block the phage from binding to its receptor on the bacterial cell which effectively inhibits phage adsorption. Previously, it has been shown that exposing Escherichia coli B23 cells to sub-inhibitory levels of the antibiotic kanamycin results in an increase in extracellular polysaccharide production, possibly in the form of a capsule. In the current study, this phenomenon was investigated using T7 phage adsorption as a model to assess the presence of a capsule. Phage adsorption assays were performed on both E. coli B23 cells treated with sub-lethal levels of kanamycin for 1 hour and untreated cells. T7 phage adsorption was shown to be diminished in E. coli treated with antibiotic, as compared to those which had not been treated with antibiotic. This decrease in phage adsorption to the antibiotic treated cells suggests that the induced extracellular polysaccharide produced by these cells is part of the capsule. Thus, this work provides further insight into the likely nature of the induced-extracellular polysaccharide produced by these cells following antibiotic treatment. Bacteria have developed mechanisms to adapt to phage adsorption (17). Binding of T7 phage to LPS changes in their environment. -

Analysis of the Interaction of the Luxr-Type Transcription Factors Bglj and Rcsb and Antagonism of H-NS Mediated Silencing in Escherichia Coli
Analysis of the interaction of the LuxR-type transcription factors BglJ and RcsB and antagonism of H-NS mediated silencing in Escherichia coli I n a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt von Raja Venkatesh Ganesan aus Tamil Nadu, Indien Köln, März 2010 Berichterstatter/in: Prof. Dr. Karin Schnetz Prof. Dr. Jürgen Dohmen Tag der letzten mündlichen Prüfung: 26 April 2010 Acknowledgements I take this opportunity to thank all the people who have helped, encouraged and inspired me during my graduation and made this thesis possible. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to my PhD supervisor Prof. Karin Schnetz for providing me the opportunity to work in her group and sharing her knowledge for the betterment of my life. I am very thankful for her valuable advice, support and teaching me the word “organization”. Thanks for the pushes and constructive criticism which helped me to make this happen. I would like to thank Prof. Dr. Siegfried Roth and Prof. Dr. Jürgen Dohmen for being part of my thesis committee. I thank Dr. Kevin Johnson for agreeing to be part of my thesis committee. I am deeply grateful to Dr. Sabari and Dr. Palani for their immeasurable help and support professionally and personally. I thank Dr. Jain Nayar for his wise words during tougher times. I also thank him for the lighter moments and great movie sessions. Many thanks to Dr. -

Vibrio Vulnificus: Disease and Pathogenesis (2009)
Vibrio vulnificus: Disease and Pathogenesis Melissa K. Jones and James D. Oliver Infect. Immun. 2009, 77(5):1723. DOI: 10.1128/IAI.01046-08. Published Ahead of Print 2 March 2009. Downloaded from Updated information and services can be found at: http://iai.asm.org/content/77/5/1723 These include: http://iai.asm.org/ REFERENCES This article cites 163 articles, 92 of which can be accessed free at: http://iai.asm.org/content/77/5/1723#ref-list-1 CONTENT ALERTS Receive: RSS Feeds, eTOCs, free email alerts (when new articles cite this article), more» on August 28, 2013 by Oregon State University Information about commercial reprint orders: http://journals.asm.org/site/misc/reprints.xhtml To subscribe to to another ASM Journal go to: http://journals.asm.org/site/subscriptions/ INFECTION AND IMMUNITY, May 2009, p. 1723–1733 Vol. 77, No. 5 0019-9567/09/$08.00ϩ0 doi:10.1128/IAI.01046-08 Copyright © 2009, American Society for Microbiology. All Rights Reserved. MINIREVIEW Vibrio vulnificus: Disease and Pathogenesisᰔ Melissa K. Jones and James D. Oliver* Department of Biology, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, North Carolina 28223 Downloaded from Vibrio vulnificus is an opportunistic human pathogen that is BIOTYPES AND GENOTYPES highly lethal and is responsible for the overwhelming majority Biotypes. Strains of V. vulnificus are classified into biotypes of reported seafood-related deaths in the United States (30, 117). This bacterium is a part of the natural flora of coastal based on their biochemical characteristics. Strains belonging to marine environments worldwide and has been isolated from biotype 1 are responsible for the majority of human infections, water, sediments, and a variety of seafood, including shrimp, while biotype 2 strains are primarily eel pathogens (2, 153). -

Viability of Engineered Biocatalysts in Biotransformation
VIABILITY OF ENGINEERED BIOCATALYSTS IN BIOTRANSFORMATION BY LOUISE DAWN HACKETT A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF MASTER OF PHILOSOPHY SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF BIRMINGHAM NOVEMBER 2013 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract This project aims to exploit engineered biofilms as biocatalysts in the biotransformations of enantiomerically pure compounds for fine chemical and pharmaceutical industry. It aims for conditions to be designed which would improve reactions and formation of the engineered biofilms. Tsoligkas et al. (2012) has previously engineered a biofilm to act as a biocatalyst using tryptophan synthase, TrpBA produced from plasmid pSTB7 to catalyse the biotransformation of haloindoles to L-halotryptophans. To build on this work, biofilm formation and how the cells react to the biotransformation were investigated through flow cytometry and analysis of colony forming units (CFU). For biofilms to be formed from Escherichia coli (E. Coli) K-12, it was found that the plasmid pT7-csgD had to be present or the strain required an ompR234 point mutation to allow production of curli for extracellular polymeric substances to form a biofilm. -
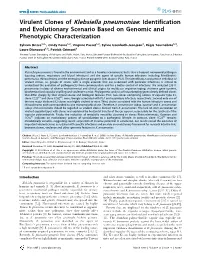
Virulent Clones of Klebsiella Pneumoniae: Identification and Evolutionary Scenario Based on Genomic and Phenotypic Characterization
Virulent Clones of Klebsiella pneumoniae: Identification and Evolutionary Scenario Based on Genomic and Phenotypic Characterization Sylvain Brisse1,2*, Cindy Fevre1,2, Virginie Passet1,2, Sylvie Issenhuth-Jeanjean2,Re´gis Tournebize3,4, Laure Diancourt1,2, Patrick Grimont2 1 Institut Pasteur, Genotyping of Pathogens and Public Health, Paris, France, 2 Institut Pasteur, Biodiversite´ des Bacte´ries Pathoge`nes Emergentes, Paris, France, 3 Institut Pasteur, Unite´ de Pathoge´nie Microbienne Mole´culaire, Paris, France, 4 Unite´ INSERM U786, Institut Pasteur, Paris, France Abstract Klebsiella pneumoniae is found in the environment and as a harmless commensal, but is also a frequent nosocomial pathogen (causing urinary, respiratory and blood infections) and the agent of specific human infections including Friedla¨nder’s pneumonia, rhinoscleroma and the emerging disease pyogenic liver abscess (PLA). The identification and precise definition of virulent clones, i.e. groups of strains with a single ancestor that are associated with particular infections, is critical to understand the evolution of pathogenicity from commensalism and for a better control of infections. We analyzed 235 K. pneumoniae isolates of diverse environmental and clinical origins by multilocus sequence typing, virulence gene content, biochemical and capsular profiling and virulence to mice. Phylogenetic analysis of housekeeping genes clearly defined clones that differ sharply by their clinical source and biological features. First, two clones comprising isolates of capsular type K1, clone CC23K1 and clone CC82K1, were strongly associated with PLA and respiratory infection, respectively. Second, only one of the two major disclosed K2 clones was highly virulent to mice. Third, strains associated with the human infections ozena and rhinoscleroma each corresponded to one monomorphic clone. -

Cyclic AMP and Cyclic AMP-Receptor Protein Are Required for Optimal Capsular Polysaccharide Expression
Journal of Bacteriology and Virology 2015. Vol. 45, No. 1 p.26 – 35 http://dx.doi.org/10.4167/jbv.2015.45.1.26 Original Article Cyclic AMP and Cyclic AMP-Receptor Protein are Required for Optimal Capsular Polysaccharide Expression * Hyeon-Kyu Cho1 and Sung-Heui Shin2 1Department of Emergency Medicine and 2Department of Microbiology, Chosun University Medical School, Gwangju, Korea Vibrio vulnificus causes fatal infections in susceptible individuals. Group 1 capsular polysaccharide (CPS) operon is responsible for CPS expression, which plays an essential role in the pathogenesis of this pathogen. Cyclic AMP (cAMP) and cAMP receptor protein (Crp) complex, which responds to glucose availability and functions as a global regulator, has been known to affect CPS production in this pathogen. This study was undertaken to experimentally verify whether cAMP-Crp directly or indirectly affects CPS production. A mutation in cyaA encoding adenylate cyclase, which is required for cAMP biosynthesis, inhibited V. vulnificus growth and changed opaque colonies to translucent colonies, and these changes were recovered by complementing cyaA or by adding exogenous cAMP. A mutation in crp encoding Crp also inhibited V. vulnificus growth and changed opaque colonies to translucent colonies, and these changes were recovered by complementing crp. Moreover, the crp or cyaA mutation decreased the susceptibility of V. vulnificus against NaOCl. The crp mutation reduced the transcription levels of group 1 CPS operon on a per cell basis. Glucose addition in the absence of Crp stimulated V. vulnificus growth, changed translucent colonies to opaque colonies, and increased the transcription levels of group 1 CPS operon. These results indicate that cAMP or Crp is indirectly involved in optimal CPS production by positively affecting metabolism or V. -
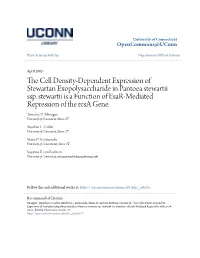
The Cell Density-Dependent Expression of Stewartan Exopolysaccharide in Pantoea Stewartii Ssp
University of Connecticut OpenCommons@UConn Plant Science Articles Department of Plant Science April 2005 The elC l Density-Dependent Expression of Stewartan Exopolysaccharide in Pantoea stewartii ssp. stewartii is a Function of EsaR-Mediated Repression of the rcsA Gene. Timothy D. Minogue University of Connecticut, Storrs CT Aurelien L. Carlier University of Connecticut, Storrs CT Maria D. Koutsoudis University of Connectictut, Storrs CT Susanne B. von Bodman University of Connecticut, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/plsc_articles Recommended Citation Minogue, Timothy D.; Carlier, Aurelien L.; Koutsoudis, Maria D.; and von Bodman, Susanne B., "The eC ll Density-Dependent Expression of Stewartan Exopolysaccharide in Pantoea stewartii ssp. stewartii is a Function of EsaR-Mediated Repression of the rcsA Gene." (2005). Plant Science Articles. 17. https://opencommons.uconn.edu/plsc_articles/17 Blackwell Science, LtdOxford, UKMMIMolecular Microbiology0950-382XBlackwell Publishing Ltd, 2005? 2005561189203Original ArticleQuorum sensing control of stewartan EPST. D. Minogue, A. L. Carlier, M. D. Koutsoudis and S. B. von Bodman Molecular Microbiology (2005) 56(1), 189–203 doi:10.1111/j.1365-2958.2005.04529.x The cell density-dependent expression of stewartan exopolysaccharide in Pantoea stewartii ssp. stewartii is a function of EsaR-mediated repression of the rcsA gene Timothy D. Minogue,1† Aurelien L. Carlier,1† Introduction Maria D. Koutsoudis2 and Susanne B. von Bodman1,2* Bacterial populations communicate and gauge their own 1Departments of Plant Science and 2Molecular and population densities through production and perception of Cellular Biology, University of Connecticut, Storrs, CT self-produced membrane diffusible or secreted autoin- 06269, USA. -

Optogenetic Control of Gut Bacterial Metabolism to Promote Longevity
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.25.964866; this version posted March 26, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 1 Optogenetic control of gut bacterial metabolism to promote longevity 2 Lucas A. Hartsough1, Matthew V. Kotlajich1, Bing Han3,7, Chih-Chun J. Lin3,4, Lauren Gambill2, 3 Meng C. Wang*3,4,5, Jeffrey J. Tabor*,1,2,6 4 5 1Department of Bioengineering, 2Systems, Synthetic, and Physical Biology Program, Rice 6 University, Houston, TX; 3Huffington Center on Aging, 4Department of Molecular & Human 7 Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX; 5Howard Hughes Medical Institute; 8 6Department of Biosciences, Rice University; 7Current Address: Children's Hospital & Institutes 9 of Biomedical Sciences, Fudan University, Shanghai, China, 201102 10 11 *corresponding authors 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.25.964866; this version posted March 26, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 12 Abstract 13 Gut microbial metabolism is associated with host longevity. However, because it requires 14 direct manipulation of microbial metabolism in situ, establishing a causal link between these two 15 processes remains challenging. We demonstrate an optogenetic method to control gene 16 expression and metabolite production from bacteria residing in the host gut. We genetically 17 engineer an Escherichia coli strain that synthesizes and secretes colanic acid (CA) under the 18 quantitative control of light. -

U-Turns and Regulatory Rnas Thomas Franch and Kenn Gerdes*
159 U-turns and regulatory RNAs Thomas Franch and Kenn Gerdes* Conventional antisense RNAs, such as those controlling Escherichia coli chromosome act as promiscuous regulators plasmid replication and maintenance, inhibit the function of that control or modulate the functions of multiple RNAs. their target RNAs rapidly and efficiently. Novel findings show Here we review the importance of the U-turn motif in anti- that a common U-turn loop structure mediates fast RNA sense RNA regulation and the multifaceted regulatory pairing in the majority of these RNA controlled systems. properties of several small RNAs. Usually, an antisense RNA regulates a single, cognate target RNA only. Recent reports, however, show that antisense RNAs Rapid RNA–RNA pairing mediated by U-turn can act as promiscuous regulators that control multiple genes loops in concert to integrate complex physiological responses in The effects of antisense RNAs on their target RNAs are Escherichia coli. proportional to the rate of complex formation. In vitro bi- molecular reactions yield maximum RNA pairing rate Addresses constants of 106–107 M–1s–1 [9–11]. Thus, the interaction Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of between RNA molecules is inherently constrained and Southern Denmark, Campusvej 55, 5230 Odense M, Denmark not simply diffusion limited. From such studies, it was *e-mail: [email protected] inferred that antisense RNAs have evolved structural ele- Current Opinion in Microbiology 2000, 3:159–164 ments that reduce constraints and ambiguity of the pairing reactions. Recently, a comparative sequence analysis of 1369-5274/00/$ — see front matter © 2000 Elsevier Science Ltd. -

Characterization of the Function and Interaction of Proteins Involved in Exopolysaccharide Synthesis in Streptococcus Thermophil
Utah State University DigitalCommons@USU All Graduate Theses and Dissertations Graduate Studies 5-2012 Characterization of the Function and Interaction of Proteins Involved in Exopolysaccharide Synthesis in Streptococcus thermophilus, Streptococcus iniae, and Lactococcus lactis subsp. cremoris Angela D. Cefalo Utah State University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/etd Part of the Biology Commons Recommended Citation Cefalo, Angela D., "Characterization of the Function and Interaction of Proteins Involved in Exopolysaccharide Synthesis in Streptococcus thermophilus, Streptococcus iniae, and Lactococcus lactis subsp. cremoris" (2012). All Graduate Theses and Dissertations. 1424. https://digitalcommons.usu.edu/etd/1424 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate Studies at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in All Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. CHARACTERIZATION OF THE FUNCTION AND INTERACTION OF PROTEINS INVOLVED IN EXOPOLYSACCHARIDE SYNTHESIS IN STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, STREPTOCOCCUS INIAE, AND LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. CREMORIS by Angela D. Cefalo A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Biology Approved: ________________________ ________________________ Dr. Dennis L. Welker Dr. Anne J. Anderson Major Professor Committee Member ________________________ ________________________ -

Transcriptional Control of Rfah on Polysialic and Colanic Acid Synthesis by Escherichia Coli K92 ⇑ Nicolás Navasa, Leandro B
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elsevier - Publisher Connector FEBS Letters 588 (2014) 922–928 journal homepage: www.FEBSLetters.org Transcriptional control of RfaH on polysialic and colanic acid synthesis by Escherichia coli K92 ⇑ Nicolás Navasa, Leandro B. Rodríguez-Aparicio , Miguel Ángel Ferrero, Andrea Monteagudo-Mera, ⇑ Honorina Martínez-Blanco Departamento de Biología Molecular, Área de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de León, Campus de Vegazana, 24071 León, Spain article info abstract Article history: The transcriptional antiterminator RfaH promotes transcription of long operons encoding surface Received 26 September 2013 cell components important for the virulence of Escherichia coli pathogens. In this paper, we show Revised 28 December 2013 that RfaH enhanced kps expression for the synthesis of group 2 polysialic acid capsule in E. coli Accepted 13 January 2014 K92. In addition, we demonstrate for the first time that RfaH promotes cps expression for the syn- Available online 31 January 2014 thesis of colanic acid, a cell wall component with apparently no role on pathogenicity. Finally, we Edited by Renee Tsolis show a novel RfaH requirement for growth at low temperatures. Ó 2014 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. Keywords: Transcriptional antiterminator Thermoregulation Capsular polysaccharides Gene expression 1. Introduction initiation from the promoters [8]. RfaH-dependent operons share a short element termed ops (operon polarity suppressor) that is Bacterial capsules are structures surrounding the cell surface essential for rfaH function [8–10]. The ops sequence recruits RfaH which exhibit extraordinary diversity and confer important advan- and other factors to the RNA polymerase complex, increasing its tages upon micro-organisms.