Geschichte Der Evangelischen Elisabeth Klinik Berlin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Leadership in Social Movements: Evidence from the “Forty-Eighters”
American Economic Review 2021, 111(2): 1–35 https://doi.org/10.1257/aer.20191137 Leadership in Social Movements: Evidence from the “Forty-Eighters” in the Civil War† By Christian Dippel and Stephan Heblich* This paper studies the role of leaders in the social movement against slavery that culminated in the US Civil War. Our analysis is orga- nized around a natural experiment: leaders of the failed German rev- olution of 1848–1849 were expelled to the United States and became antislavery campaigners who helped mobilize Union Army volun- teers. Towns where Forty-Eighters settled show two-thirds higher Union Army enlistments. Their influence worked through local newspapers and social clubs. Going beyond enlistment decisions, Forty-Eighters reduced their companies’ desertion rate during the war. In the long run, Forty-Eighter towns were more likely to form a local chapter of the NAACP. JEL D74, J15, J45, J61, N31, N41 ( ) Between 1861 and 1865, the United States’ North and South fought each other over the issue of slavery in the American Civil War. One in five adult men, 2.2 mil- lion in the North alone, took up arms to fight in the Union Army. Fighting was costly on both sides. In total, 620,000 men lost their lives, as many as in all other American wars combined Hacker 2011, Costa and Kahn 2003 . At the same time, the finan- ( ) cial incentives to fight in the war were low. Union Army privates earned about $13 per month, less than a farmhand Edmunds 1866 , and payment was irregular. In the ( ) South, there were stronger economic motives at least for some, since the war was about the survival of Southern institutions and property Hall, Huff, and Kuriwaki ( 2019 . -

How to Evaluate German Unification?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Zapf, Wolfgang Working Paper How to evaluate German unification? WZB Discussion Paper, No. FS III 00-404 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Zapf, Wolfgang (2000) : How to evaluate German unification?, WZB Discussion Paper, No. FS III 00-404, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/50191 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise -

Elisabeth Crowell and Visiting Nurse Education in Europe, 1917-1925
Elisabeth Crowell and Visiting Nurse Education in Europe, 1917-1925 By Jaime Lapeyre RN, Ph.D. Candidate University of Toronto Canada [email protected] and By Sioban Nelson RN, Ph.D., FCAHS Dean and Professor, Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing University of Toronto Canada [email protected] © 2011 by Jaime Lapeyre and Sioban Nelson The Rockefeller Foundation’s (RF) Commission for the Prevention of Tuberculosis in France (CPTF) was established in 1917 and included the RF’s first involvement with the training of nurses. During the first few years of the war the RF had formed a War Relief Commission and provided aid to Belgium, Serbia and Poland, as well as other war-ravaged countries, as a result of their continued study of conditions in Europe. Upon the U.S.’s entry into the war, and the formation of the War Council under the American Red Cross, the RF withdrew its War Relief Commission and merged its resources with the Red Cross. One of the areas in most need of help was that of tuberculosis prevention in France. After careful study of this field by Dr. Hermann Biggs, New York State Commissioner of Health, and at the invitation of French authorities, the International Health Board (IHB) of the RF formed the Commission for the Prevention of Tuberculosis in France. The work of the Commission included establishing centers for the training of tuberculosis workers and visiting nurses.1 1 The nurse placed in charge of the Commission’s training program for health visitors was Frances Elisabeth Crowell. Crowell was an American, who after completing her training as a nurse, moved to New York to complete her social work education at the New York School of Philanthropy. -

Economic Crises and the European Revolutions of 1848
Economic Crises and the European Revolutions of 1848 HELGE BERGER AND MARK SPOERER Recent historical research tends to view the 1848 revolutions in Europe as caused by a surge of radical ideas and by long-term socioeconomic problems. However, many contemporary observers interpreted much of the upheaval as a consequence of short- term economic causes, specifically the serious shortfall in food supply that had shaken large parts of the Continent in 1845–1847, and the subsequent industrial slump. Applying standard quantitative methods to a data set of 27 European coun- tries, we show that it was mainly immediate economic misery, and the fear thereof, that triggered the European revolutions of 1848. n the 1990s the acceleration of economic and political integration in West- Iern Europe and the democratization of Eastern Europe led to an increasing interest in the turbulent year 1848, when large parts of the Continent experienced a striving for political participation and self-determination.1 The recent sesquicentennial has given rise to a wealth of literature, espe- cially in countries where 1848 meant a first step towards more demo- cratic political institutions, including Germany, Austria, Hungary, and Romania. Many of these studies reflect the scholarly trend away from social history. To be sure, even after the “cultural turn” most historians concede that structural socioeconomic problems contributed to rising popular discontent. But whereas in the 1970s and 1980s long- and short- term socioeconomic determinants were pivotal in explanations of the 1848 revolutions, short-term economic factors now tend to be margin- alized; instead, greater weight is placed on the spread of liberal and dem- ocratic ideas, and on the inflexible and increasingly outdated political institutions of the time, which were ill-suited to cope with the societal The Journal of Economic History, Vol. -

Empress Elisabeth ('Sisi') of Austria and Patriotic Fashionism
VanDemark, Christopher. “Empress Elisabeth (‘Sisi’) of Austria and Patriotic Fashionism.” Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 9 (2016): http://ahea.pitt.edu DOI: 10.5195/ahea.2016.254 Empress Elisabeth (‘Sisi’) of Austria and Patriotic Fashionism Christopher M. VanDemark Abstract: In this article, Christopher VanDemark explores the intersections between nationalism, fashion, and the royal figure in Hungary between 1857 and the Compromise of 1867. Focusing on aesthetics as a vehicle for feminine power at a critical junction in Hungarian history, VanDemark contextualizes Empress Elisabeth’s role in engendering a revised political schema in the Habsburg sphere. Foreseeing the power of emblematic politics, the young Empress adeptly situated herself between the Hungarians and the Austrians to recast the Hungarian martyrology narrative promulgated after the failed revolution of 1848. Eminent Hungarian newspapers such as the Pesti Napló, Pester Lloyd, and the Vasárnapi Újság form the backbone of this article, as publications such as these facilitated the dissemination of patriotic sentiment while simultaneously exulting the efficacy of symbolic fashions. The topic of study engages with contemporary works on nationalism, which emphasize gender and aesthetics, and contributes to the emerging body of scholarship on important women in Hungarian history. Seminal texts by Catherine Brice, Sara Maza, Abby Zanger, and Lynn Hunt compliment the wider objective of this brief analysis, namely, the notion that the Queen’s body can both enhance and reform monarchical power within a nineteenth-century milieu. Keywords: Empress Elisabeth, Habsburg Monarchy, fashion and politics, fashion and nationalism, 1867 Compromise Biography: Christopher VanDemark received his B.A in History and Political Science from the University of Florida, Gainesville. -

Descendant Report
Descendants of Daniel Steinschneider Generation 1 1. DANIEL1 STEINSCHNEIDER was born about 1735 in Prostejov, Czech Republic. He died before 1757 in Prostejov, Czech Republic. He married PLACEHOLDER. Daniel Steinschneider and Placeholder had the following children: i. BENJAMIN-WOLFF2 STEINSCHNEIDER was born in 1730 in Prostejov, Czech Republic. He died in Prostejov, Czech Republic. 2. ii. ARON DANIEL STEINSCHNEIDER was born in 1742 in Prostejov, South Moravia, Czech Republic. He died on 2 Mar 1809 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. He married JUDITH STEINSCHNEIDER. She was born in 1750 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. She died on 5 Jan 1827 in House No. 23, Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. 3. iii. THIRD SON OF DANIEL STEINSCHNEIDER. He married PLACEHOLDER MOTHER OF SALOMON. Generation 2 2. ARON DANIEL2 STEINSCHNEIDER (Daniel1) was born in 1742 in Prostejov, South Moravia, Czech Republic. He died on 2 Mar 1809 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. He married JUDITH STEINSCHNEIDER. She was born in 1750 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. She died on 5 Jan 1827 in House No. 23, Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. Aron Daniel Steinschneider and Judith Steinschneider had the following children: 4. i. DEBORAH3 STEINSCHNEIDER was born in 1767 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. She died on 11 Feb 1850 in Prostějov, Prostějov District, Olomouc Region, Czech Republic. 5. ii. MICHAEL ALEXANDER STEINSCHNEIDER was born in 1782 in Prostejov, Czech Republic. He died in 1831 in Prostejov, Czech Republic. He married NANETTE EHRENSTAMM. -
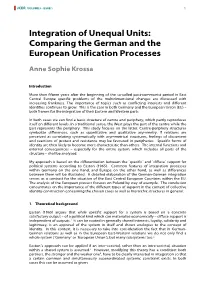
Comparing the German and the European Unification Processes
▌JCER VOLUME 3 • ISSUE 1 1 Integration of Unequal Units: Comparing the German and the European Unification Processes Anne Sophie Krossa Introduction More than fifteen years after the beginning of the so-called post-communist period in East Central Europe specific problems of the multidimensional changes are discussed with increasing frankness. The importance of topics such as conflicting interests and different identities continues to grow. This is the case in both Germany and the European Union (EU) – both frames for the integration of their Eastern and Western parts In both cases we can find a basic structure of centre and periphery, which partly reproduces itself on different levels. In a traditional sense, the West plays the part of the centre while the East represents the periphery. This study focuses on the latter. Centre-periphery structures symbolize differences, such as quantitative and qualitative asymmetry. If relations are perceived as correlating systematically with asymmetrical structures, feelings of discontent and reactions of protest and resistance may be favoured in peripheries. Specific forms of identity are then likely to become more characteristic than others. The internal functions and external consequences – especially for the entire system, which includes all parts of the structure – shall be analysed. My approach is based on the differentiation between the `specific´ and `diffuse´ support for political systems according to Easton (1965). Common features of integration processes within Germany on the one hand, and Europe on the other hand, as well as differences between them will be illustrated. A detailed elaboration of the German-German integration serves as a contrast for the situation of the East Central European Countries within the EU. -

The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria As Icon of Austrian National Identity
Trinity College Trinity College Digital Repository Trinity Publications (Newspapers, Yearbooks, The Trinity Papers (2011 - present) Catalogs, etc.) 2013 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura Trinity College Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers Part of the European History Commons Recommended Citation Gura, Caitlin, "The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity". The Trinity Papers (2011 - present) (2013). Trinity College Digital Repository, Hartford, CT. https://digitalrepository.trincoll.edu/trinitypapers/20 The Austrian Aschenputtel: Empress Elizabeth of Austria as Icon of Austrian National Identity Caitlin Gura uring the post-World War II era, the four Allied Powers restored Dsovereignty and established neutrality in the Second Republic of Austria through the State Treaty of 1955. Among other motivations, this policy was designed to thwart any movement to rebuild the pan-German nation. Austria was charged with the task of creating a new identity to make a clear distinction that it is dissimilar from Germany. The new Austrian republic turned its gaze to the golden age of the Hapsburg Imperial Empire as one of the starting points in creating a new historical narrative for the nation. The local film industry seized upon this idea, which resulted in the Kaiserfilm genre. A prominent example of this variety of film is Ernst Marischka’s late 1950s blockbuster movies: the Sissi trilogy. Within the scope of this analysis, I argue how the films ignited a “Sissi phenomenon” which led to a resurgence and transformation of Empress Elisabeth of Austria as a popular cultural icon and a consequential impact on the reconfiguration of Austrian national identity. -

From the Testimony of Elisabeth Freund About the War Years in Berlin
From the Testimony of Elisabeth Freund about the War Years in Berlin [Elisabeth Freund lived in Berlin. Her husband was an executive in a German corporation who was dismissed in 1933 since he was a Jew. He worked until 1938 as an employee in a firm. Their three children were sent abroad. In 1941, Elisabeth Freund was conscripted to forced labor, first in a laundry and then in a munitions factory. In 1941 they managed to immigrate to Cuba, and from there in 1944 they went on to the United States. She wrote the following report in Cuba in December 1941] … The Aryans have problems with food too, but they may buy at all hours. There is not enough merchandise. In the morning there are long lines of women in front of the shops. It is extremely difficult to find potatoes. The last crop was bad and there are shortages of vegetables…. The Aryans get significantly more than we Jews. We have had a "J" stamped on our ration cards for a long time, so that we could not go and get food under false identity. There are no extra rations for us, no canned food, no fish, no chicken, no smoking materials, no coffee and especially no milk…. Milk is given to Jewish children only when they are very young. I am always angered by the fact that there is no candy for Jewish children. It is so vile. Other children receive very little too, but what difference would it make if Jewish children would get some candy or synthetic honey…. -

Leadership and Social Movements: the Forty-Eighters in the Civil War
NBER WORKING PAPER SERIES LEADERSHIP AND SOCIAL MOVEMENTS: THE FORTY-EIGHTERS IN THE CIVIL WAR Christian Dippel Stephan Heblich Working Paper 24656 http://www.nber.org/papers/w24656 NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 May 2018 We thank the editor and two referees for very helpful suggestions, as well as Daron Acemoglu, Sascha Becker, Toman Barsbai, Jean-Paul Carvalho, Dora Costa, James Feigenbaum, Raquel Fernandez, Paola Giuliano, Walter Kamphoefner, Michael Haines, Tarek Hassan, Saumitra Jha, Matthew Kahn, Naomi Lamoreaux, Gary Libecap, Zach Sauers, Jakob Schneebacher, Elisabeth Perlman, Nico Voigtländer, John Wallis, Romain Wacziarg, Gavin Wright, Guo Xu, and seminar participants at UCLA, U Calgary, Bristol, the NBER DAE and POL meetings, the EHA meetings, and the UCI IMBS conference for valuable comments. We thank David Cruse, Andrew Dale, Karene Daniel, Andrea di Miceli, Jake Kantor, Zach Lewis, Josh Mimura, Rose Niermeijer, Sebastian Ottinger, Anton Sobolev, Gwyneth Teo, and Alper Yesek for excellent research assistance. We thank Michael Haines for sharing data. We thank Yannick Dupraz and Andreas Ferrara for data-sharing and joint efforts in collecting the Civil War soldier and regiments data. We thank John Wallis and Jeremy Darrington for helpful advice in locating sub-county voting data for the period, although we ultimately could not use it. Dippel acknowledges financial support for this project from the UCLA Center of Global Management, the UCLA Price Center and the UCLA Burkle Center. The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the National Bureau of Economic Research. -

Elisabeth D. Sherwin 5016 Greenway Drive North Little Rock, Arkansas 72116 (501) 753 6549 [email protected]
Sherwin Elisabeth D. Sherwin 5016 Greenway Drive North Little Rock, Arkansas 72116 (501) 753 6549 [email protected] EDUCATION 1994 Ph.D., Social Psychology (Social-Clinical Interface), Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. Hope and social identity: An investigation into the relationship between the self and the environment. 1991 M.S., Clinical Psychology, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. Cognitive appraisal and coping with stressors associated with graduate training in Clinical Psychology. 1985 B.A., Major in Psychology and Minors in English Literature and Judaic Studies , Magna Cum Laude, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel 1980 Lieutenant, Israeli Military Academy, Israeli Defense Forces, Israel PROFESSIONAL EXPERIENCE 2010-Present Professor of Psychology, University of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR 2006 Tenure Awarded 2004 Associate Professor 2002-2004 Assistant Professor 1995- 2002 Assistant Professor of Psychology, Georgia Southern University, Statesboro GA 2001 – Tenure Awarded 1998 – Full Graduate Faculty Status 1993-1995 Clinical Psychology Associate, Rehabilitation Unit, HealthSouth Medical Center, Richmond, VA Conducted neuropsychological assessments as well as provided limited, supervised, psychological support to individuals post stroke or with traumatic brain injury PROFESSIONAL DEVELOPMENT 2013 Certificate, Distance Education Professional Development Program, 1 Sherwin University of Wisconsin-Madison. 2013 American Council in Education Regional Women’s -

The Austrian Parliamentary Library on the Web: Transition to the Computer Age Since 1992
World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council 1-9 August 2003, Berlin Code Number: 094-E Meeting: 92. Library and Research Services for Parliaments Simultaneous Interpretation: Yes The Austrian Parliamentary Library on the web: transition to the computer age since 1992 Elisabeth Dietrich-Schulz Library of the Austrian Parliament Vienna, Austria Based on the relevant chapter in the following book, published in 2002 Pech, Christian: Nur was sich ändert, bleibt! : Die österreichische Parlamentsbibliothek im Wandel der Zeit 1869 – 2002 [Nothing endures but change : the Austrian Parliamentary Library in changing times from 1869 to 2002] / Editors: Elisabeth Dietrich-Schulz ; Barbara Blümel. - Vienna : Parliamentary Administration, 2002. - 150 pp. : 24 ill. (col.) - 30 cm. - ISBN 3-901991- 05-0 Summary The road to an online library The era issued in by 1992 was characterised by the countless innovations and changes made. On the one hand, two stages of the planned expansion of the library premises were carried out, which had been planned and required since the 1980s; on the other hand, the running of the library now had to be adapted to suit the changing demands of the information age. Advances in IT presented a conditio sine qua non for the existence of any library. Numerous new means of accessing books were being opened to the users, which led to an increasing need for more staff, as only formal and well ordered collections could be of any use to the library’s users. The benefits were plain for all to see: never before were there such complete and up to date catalogues which, thanks to the internet, are so easily and widely accessible.