Sullivan-Journal Nr. 2 (Dezember 2009)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marion Scott Gleichzeitig Engagierte Sich Marion M
Scott, Marion Marion Scott Gleichzeitig engagierte sich Marion M. Scott musikpoliti- sch in zahlreichen Verbänden und Organisationen, dar- * 16. Juli 1877 in London, England unter die Royal Musical Association, die Royal Philhar- † 24. Dezember 1953 in London, England monic Society und der Forum Club. Eines ihrer Lebens- werke war die Gründung der „Society of Women Musici- Violinistin, Kammermusikerin, Konzertmeisterin, ans“, die sie ab 1911 gemeinsam mit der Sängerin Gertru- Komponistin, Musikwissenschaftlerin, Musikkritikerin, de Eaton und der Komponistin Katharine Eggar aufbau- Förderin (ideell), Musikjournalistin, te – mit eigenem Chor und Orchester, einer Bibliothek (Musik-)Herausgeberin, Konzertorganisatorin, sowie Konzert- und Vortragsreihen. Die Organisation un- Musikpolitikerin, Gründerin und zeitweise Präsidentin terstützte Musikerinnen im britischen Musikleben, führ- der Society of Women Musicians, Schriftstellerin te die Werke von Komponistinnen auf und bemühte sich u. a. darum, die Aufnahme von Musikerinnen in profes- „Unstinted service in the cause of music was the keynote sionelle Orchester zu ermöglichen. Die „Society of Wo- of her life. Countless musicians owe an incalculable debt men Musicians“ blieb bis 1972 bestehen. of gratitude to the fragile little woman who lent them sympathetic and practical aid in their struggles and re- Ab den 1920er-Jahren wandte sich Marion M. Scott dem joiced whole-heartedly in their successes. As a friend she Schreiben über Musik zu. Sie arbeitete als Musikkritike- is irreplaceable.” („Uneingeschränkte Hingabe an die Ar- rin u. a. für die „Musical Times“ und verstärkte mit Arti- beit um der Sache der Musik willen, war der Grundton ih- keln über die Geschichte des Violinspiels, über Auffüh- res Lebens. Unzählige Musiker empfinden der kleinen rungspraxis und Violinliteratur sowie über zeitgenössi- zerbrechlichen Frau gegenüber eine unendliche Dankbar- sche Komponistinnen und Komponisten ihre musikwis- keit, die ihre Arbeit verständnisvoll und tatkräftig unter- senschaftlichen Tätigkeiten. -

Guitar Syllabus
TheThe LLeinsteinsteerr SScchoolhool ooff MusMusiicc && DDrramama Established 1904 Singing Grade Examinations Syllabus The Leinster School of Music & Drama Singing Grade Examinations Syllabus Contents The Leinster School of Music & Drama ____________________________ 2 General Information & Examination Regulations ____________________ 4 Grade 1 ____________________________________________________ 6 Grade 2 ____________________________________________________ 9 Grade 3 ____________________________________________________ 12 Grade 4 ____________________________________________________ 15 Grade 5 ____________________________________________________ 19 Grade 6 ____________________________________________________ 23 Grade 7 ____________________________________________________ 27 Grade 8 ____________________________________________________ 33 Junior & Senior Repertoire Recital Programmes ________________________ 35 Performance Certificate __________________________________________ 36 1 The Leinster School of Music & Drama Singing Grade Examinations Syllabus TheThe LeinsterLeinster SchoolSchool ofof MusicMusic && DraDrammaa Established 1904 "She beckoned to him with her finger like one preparing a certificate in pianoforte... at the Leinster School of Music." Samuel Beckett Established in 1904 The Leinster School of Music & Drama is now celebrating its centenary year. Its long-standing tradition both as a centre for learning and examining is stronger than ever. TUITION Expert individual tuition is offered in a variety of subjects: • Singing and -

OPERA, COMIC OPERA, MUSICAL Box 4/1
Enid Robertson Theatre Programme Collection MSS 792 T3743.R OPERA, COMIC OPERA, MUSICAL Box 4/1 Artist Date Venue, notes Melba, Dame Nellie, with Frederic Griffith 12.11.1902 Direction Mr George (Flute), Llewela Davies (Piano) M. (Second Musgrove Bensaude (Vocal) Signorina Sassoli Concert:15.11) Town Hall, Adelaide (Harp)Louis Arens, (Vocal)Dr. F. Matthew Ennis (Piano) Handel, Thomas, Arditi. Melba, Dame Nellie with, Tom Burke 15.6.1919 Royal Albert Hall, (Tenor), Bronislaw Huberman (Violin) London Frank St. Leger (Piano) Arthur Mason (Organ) Verdi, Puccini, etc. Melba, Dame Nellie 4.10.1921 Manager, John Lemmone, With Una Bourne (Piano), W.F.G.Steele (Second Concert Town Hall, Adelaide (Organ), John Lemmone (Flute) Mozart, 6.10.21) Verdi Melba, Dame Nellie & J.C. Williamson 26.9.1924 Direction, Nevin Tait Grand Opera Season , Aida (Verdi) Theatre Royal Adelaide Conductor Franco Paolantonio, with Augusta Concato, Phyllis Archibald, Nino Piccaluga, Edmondo Grandini, Gustave Huberdeau, Oreste Carozzi Melba, Dame Nellie & J.C. Williamson, 4.10.1924 Direction, Nevin Tait Grand Opera Season, Andrea Chenier, Theatre Royal Adelaide (Giordano) First Adelaide Performance, Franco Paolantonio (Conductor) Nino Piccaluga, Apollo Granforte, Doris McInnes, Antonio Laffi, Oreste Carozzi, Gaetano Azzolini, Luigi Cilla, Luigi Parodi, Antonio Venturi, Alfredo Muro, Vanni Cellini Melba, Dame Nellie & J.C. Williamson, 6.10.1924 Direction, Nevin Tait Grand Opera Season, DonPasquale, Theatre Royal, Adelaide (Donizetti) First Performance in Adelaide, Arnaldo -

Vol. 17, No. 4 April 2012
Journal April 2012 Vol.17, No. 4 The Elgar Society Journal The Society 18 Holtsmere Close, Watford, Herts., WD25 9NG Email: [email protected] April 2012 Vol. 17, No. 4 President Editorial 3 Julian Lloyd Webber FRCM ‘... unconnected with the schools’ – Edward Elgar and Arthur Sullivan 4 Meinhard Saremba Vice-Presidents The Empire Bites Back: Reflections on Elgar’s Imperial Masque of 1912 24 Ian Parrott Andrew Neill Sir David Willcocks, CBE, MC Diana McVeagh ‘... you are on the Golden Stair’: Elgar and Elizabeth Lynn Linton 42 Michael Kennedy, CBE Martin Bird Michael Pope Book reviews 48 Sir Colin Davis, CH, CBE Lewis Foreman, Carl Newton, Richard Wiley Dame Janet Baker, CH, DBE Leonard Slatkin Music reviews 52 Sir Andrew Davis, CBE Julian Rushton Donald Hunt, OBE DVD reviews 54 Christopher Robinson, CVO, CBE Richard Wiley Andrew Neill Sir Mark Elder, CBE CD reviews 55 Barry Collett, Martin Bird, Richard Wiley Letters 62 Chairman Steven Halls 100 Years Ago 65 Vice-Chairman Stuart Freed Treasurer Peter Hesham Secretary The Editor does not necessarily agree with the views expressed by contributors, Helen Petchey nor does the Elgar Society accept responsibility for such views. Front Cover: Arthur Sullivan: specially engraved for Frederick Spark’s and Joseph Bennett’s ‘History of the Leeds Musical Festivals’, (Leeds: Fred. R. Spark & Son, 1892). Notes for Contributors. Please adhere to these as far as possible if you deliver writing (as is much preferred) in Microsoft Word or Rich Text Format. A longer version is available in case you are prepared to do the formatting, but for the present the editor is content to do this. -

Or, the Witch's Curse!
Ruddygore or, The Witch's Curse! An Entirely Original Supernatural Opera in Two Acts Written by W. S. Gilbert Composed by Arthur Sullivan First produced at the Savoy Theatre, London, Saturday 22nd January 1887 under the management of Mr. Richard D'Oyly Carte This edition privately published by Ian C. Bond at 2 Kentisview, Kentisbeare, CULLOMPTON. EX15 2BS. © 1995 RUDDYGORE Of all the Gilbert and Sullivan joint works, RUDDYGORE has been the most unfairly treated. The initial, rather hostile reception, led the partners to make a number of cuts and changes which, under rather more favourable circumstances, would probably not have been so severe. This gradual dissection continued in the 1920’s at the hands of Geoffrey Toye, Harry Norris, Malcolm Sargent and J M Gordon until, by the post-war revival of 1949, RUDDIGORE was, to all intents and purposes, a new work. It is to be hoped that such a thing could not happen today as I would like to think that we have far too much respect for the works of these two men to allow anyone to take such drastic rewrites upon themselves. That the original version of the opera works is evidenced by the considerable number of amateur revivals over the past few years that have attempted to return as closely as possible (given the lack of performing material) to a ‘first night version’ - a trend fuelled by the New Sadler’s Wells revival of 1987. That Gilbert was guilty of one miscalculation is fairly obvious in his placing of “The battle’s roar is over” in Act One. -

FSU ETD Template
Florida State University Libraries 2016 Is There Romance after Schumann: An Analysis and Discussion of Robert Schumann's Three Romances for Oboe and Piano, Op. 94, Clara Schumann's Three Romances for Violin and Piano, Op. 22, and Other Selected Romances for Violin and Piano, Op. 22, and Other Selected Romances Written for Oboe and Piano Casey Leigh Knowlton Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC IS THERE ROMANCE AFTER SCHUMANN? : AN ANALYSIS AND DISCUSSION OF ROBERT SCHUMANN'S THREE ROMANCES FOR OBOE AND PIANO, OP. 94, CLARA SCHUMANN'S THREE ROMANCES FOR VIOLIN AND PIANO, OP. 22, AND OTHER SELECTED ROMANCES WRITTEN FOR OBOE AND PIANO By CASEY LEIGH KNOWLTON A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music © 2016 Casey L. Knowlton Casey Knowlton defended this treatise on April 27, 2016. The members of the supervisory committee were: Eric Ohlsson Professor Directing Treatise Richard Clary University Representative Deborah Bish Committee Member Jeffrey Keesecker Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the treatise has been approved in accordance with university requirements. ii To my parents, Bruce and Debra Knowlton. iii TABLE OF CONTENTS List of Figures ................................................................................................................................. v Abstract ......................................................................................................................................... vi INTRODUCTION ..........................................................................................................................1 1. AN HISTORICAL AND ANALYTICAL COMPARISON OF ROBERT SCHUMANN’S THREE ROMANCES FOR OBOE AND PIANO, OP. 94 AND CLARA SCHUMANN’S THREE ROMANCES FOR VIOLIN AND PIANO, OP. -

Vol. 13, No.2 July 2003
Chantant • Reminiscences • Harmony Music • Promenades • Evesham Andante • Rosemary (That's for Remembrance) • Pastourelle • Virelai • Sevillana • Une Idylle • Griffinesque • Ga Salut d'Amour • Mot d'AmourElgar • Bizarrerie Society • O Happy Eyes • My Dwelt in a Northern Land • Froissart • Spanish Serenade • La Capricieuse • Serenade • The Black Knight • Sursum Corda • T Snow • Fly, Singing Birdournal • From the Bavarian Highlands • The of Life • King Olaf • Imperial March • The Banner of St George Deum and Benedictus • Caractacus • Variations on an Origina Theme (Enigma) • Sea Pictures • Chanson de Nuit • Chanson Matin • Three Characteristic Pieces • The Dream of Gerontius Serenade Lyrique • Pomp and Circumstance • Cockaigne (In London Town) • Concert Allegro • Grania and Diarmid • May S Dream Children • Coronation Ode • Weary Wind of the West • • Offertoire • The Apostles • In The South (Alassio) • Introduct and Allegro • Evening Scene • In Smyrna • The Kingdom • Wan Youth • How Calmly the Evening • Pleading • Go, Song of Mine Elegy • Violin Concerto in B minor • Romance • Symphony No Hearken Thou • Coronation March • Crown of India • Great is t Lord • Cantique • The Music Makers • Falstaff • Carissima • So The Birthright • The Windlass • Death on the Hills • Give Unto Lord • Carillon • Polonia • Une Voix dans le Desert • The Starlig Express • Le Drapeau Belge • The Spirit of England • The Fring the Fleet • The Sanguine Fan • ViolinJULY Sonata 2003 Vol.13, in E minor No.2 • Strin Quartet in E minor • Piano Quintet in A minor • Cello Concerto -

Sullivan-Journal
Sullivan-Journal Sullivan-Journal Nr. 4 (Dezember 2010) Die Wechselbeziehungen von Sullivans Werk und seiner Epoche sowie seine Leistungen und deren Würdigung sind in Deutschland bislang nur ansatzweise erforscht worden. Deshalb wer- fen wir in der neuen Ausgabe des Sullivan-Journals einen Blick auf den Beginn von Sullivans Laufbahn und deren Ausklang, indem wir uns mit seiner Freundschaft mit Charles Dickens und seinen Erfahrungen mit dem Musikfestival in Leeds befassen, insbesondere warum er dort die künstlerische Leitung abgeben musste. Zudem setzen wir uns aus unterschiedlichen Blickwin- keln mit Sullivans populärster Oper, The Mikado, auseinander: Wie sehen Japaner das Werk und steht dieses Stück noch in Einklang mit Sullivans Anforderungen an die Oper? Eine Übersicht über Sullivans Repertoire als Dirigent lenkt die Aufmerksamkeit auf Künstler und Werke, mit denen er sich intensiv auseinandergesetzt hat. Inhalt S. J. Adair Fitzgerald: Sullivans Freundschaft mit Dickens 2 Musical World (1886): Eine japanische Sicht auf The Mikado 4 Meinhard Saremba: Warum vertonte Sullivan The Mikado und The Rose of Persia? 7 Anne Stanyon: Das große Leeds-Komplott 27 Anhang Sullivans Repertoire als Dirigent 43 Sullivans London 48 Standorte der wichtigsten Manuskripte 49 1 S. J. Adair Fitzgerald Sullivans Freundschaft mit Dickens [Erstveröffentlichung in The Gilbert and Sullivan Journal Nr. 2, Juli 1925. Von S. J. Adair Fitzgerald erschien 1924 das Buch The Story of the Savoy Opera.] Charles Dickens hatte stets eine mehr oder weniger starke Neigung zur Musik. Es gibt Hinwei- se von seiner Schwester Fanny, die mit ihm die Lieder einstudierte, die er Bartley, dem Büh- nenmanager am Covent Garden Theatre, vorsingen sollte, als er versuchte, auch selbst auf der Bühne aufzutreten und gegebenfalls Unterhaltungsabende zu bieten wie Charles Mathews seni- or. -

Early Encounters with Mount Royal: Part One
R IOTS :G AVAZZIANDTHEONETHATWASN ’ T $5 Quebec VOL 5, NO. 8 MAR-APR 2010 HeritageNews Montreal Mosaic Online snapshots of today’s urban anglos Tall Tales Surveys of historic Mount Royal and the Monteregian Hotspots The Gavazzi Riot Sectarian violence on the Haymarket, 1853 QUEBEC HERITAGE NEWS Quebec CONTENTS eritageNews H DITOR E Editor’s Desk 3 ROD MACLEOD The Reasonable Revolution Rod MacLeod PRODUCTION DAN PINESE Timelines 5 PUBLISHER Montreal Mosaic : Snapshots of urban anglos Rita Legault THE QUEBEC ANGLOPHONE The Mosaic revisited Rod MacLeod HERITAGE NETWORK How to be a tile Tyler Wood 400-257 QUEEN STREET SHERBROOKE (LENNOXVILLE) Reviews QUEBEC Uncle Louis et al 8 J1M 1K7 Jewish Painters of Montreal Rod MacLeod PHONE The Truth about Tracey 10 1-877-964-0409 The Riot That Never Was Nick Fonda (819) 564-9595 FAX (819) 564-6872 Sectarian violence on the Haymarket 13 CORRESPONDENCE The Gavazzi riot of 1853 Robert N Wilkins [email protected] “A very conspicuous object” 18 WEBSITE The early history of Mount Royal, Part I Rod MacLeod WWW.QAHN.ORG Monteregian Hotspots 22 The other mountains, Part I Sandra Stock Quebec Family History Society 26 PRESIDENT KEVIN O’DONNELL Part IV: Online databases Robert Dunn EXECUTIVE DIRECTOR If you want to know who we are... 27 DWANE WILKIN MWOS’s Multicultural Mikado Rod MacLeod HERITAGE PORTAL COORDINATOR MATTHEW FARFAN OFFICE MANAGER Hindsight 29 KATHY TEASDALE A childhood in the Montreal West Operatic Society Janet Allingham Community Listings 31 Quebec Heritage Magazine is produced six times yearly by the Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN) with the support of The Department of Canadian Heritage and Quebec’s Ministere de la Culture et Cover image: “Gavazzi Riot, Haymarket Square, Montreal, 1853” (Anonymous). -

Recitative in the Savoy Operas
Recitative in the Savoy Operas James Brooks Kuykendall In the early 1870s, London music publisher Boosey & Co. launched a new venture to widen its potential market. Boosey’s repertoire had been domestic music for amateur vocalists and pianists: drawing-room ballads and both piano/vocal and solo piano scores across the range of standard Downloaded from operatic repertory of the day, published always with a singing translation in English and often substituting Italian texts for works originally in French or German. Rossini, Donizetti, Bellini, and Verdi, Auber, Meyerbeer, Gounod, and Lecocq, Mozart, Beethoven, Weber, and Wagner all appeared in Boosey’s Royal Edition of Operas series, together http://mq.oxfordjournals.org/ with a handful of “English” operas by Michael William Balfe and Julius Benedict. The new effort supplemented this domestic repertory with one aimed at amateur theatricals: “Boosey & Co.’s Comic Operas and Musical Farces.” The cartouche for this series is reproduced in figure 1, shown here on the title page of Arthur Sullivan’s 1867 collaboration with Francis C. Burnand, The Contrabandista. Seven works are listed as part of the new imprint, although three by guest on May 11, 2013 of these (Gounod, Lecocq, and Offenbach’s Grand Duchess) had been issued as part of the Royal Edition. Albert Lortzing’s 1837 Zar und Zimmermann masquerades as Peter the Shipwright, and it appeared with an English text only. The new series may well have been the idea of Sullivan himself. He had been retained by Boosey since the late 1860s as one of the general editors for the Royal Edition. -

Download Booklet
HarmoniousThe EchoSONGS BY SIR ARTHUR SULLIVAN MARY BEVAN • KITTY WHATELY soprano mezzo-soprano BEN JOHNSON • ASHLEY RICHES tenor bass-baritone DAVID OWEN NORRIS piano Sir Arthur Sullivan, Ottawa, 1880 Ottawa, Sullivan, Arthur Sir Photograph by Topley, Ottawa, Canada /Courtesy of David B. Lovell Collection Sir Arthur Sullivan (1842 – 1900) Songs COMPACT DISC ONE 1 King Henry’s Song (1877)* 2:23 (‘Youth will needs have dalliance’) with Chorus ad libitum from incidental music to Henry VIII (1613) by William Shakespeare (1564 – 1616) and John Fletcher (1579 – 1625) Andante moderato Recording sponsored by Martin Yates 3 2 The Lady of the Lake (1864)† 3:25 from Kenilworth, ‘A Masque of the Days of Queen Elizabeth’, Op. 4 (or The Masque at Kenilworth) (1864) Libretto by Henry Fothergill Chorley (1808 – 1872) Allegro grazioso 3 I heard the nightingale (1863)‡ 2:59 Dedicated to his Friend Captain C.J. Ottley Allegretto moderato 4 Over the roof (1864)† 3:04 from the opera The Sapphire Necklace, or the False Heiress Libretto by Henry Fothergill Chorley Allegretto moderato Recording sponsored by Michael Symes 4 5 Will He Come? (1865)§ 4:05 Dedicated to The Lady Katherine Coke Composed expressly for Madame Sainton Dolby Moderato e tranquillo – Quasi Recitativo – Tranquillo un poco più lento Recording sponsored by Michael Tomlinson 6 Give (1867)† 4:56 Composed and affectionately dedicated to Mrs Helmore Allegretto – Un poco più lento – Lento Recording sponsored by John Thrower in memory of Simon and Brenda Walton 7 Thou art weary (1874)§ 5:00 Allegro vivace e agitato – Più lento – Allegro. Tempo I – Più lento – Allegro. -
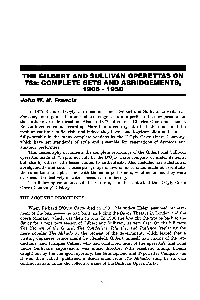
ARSC Journal
THE GILBERT AND SULLIVAN OPERETTAS ON 78s: COMPLETE SETS AND ABRIDGEMENTS, 1906. 1950 John W. N. Francis In 1877 Richard D'Oyly Carte commissioned Gilbert and Sullivan to write The Sorcerer, and organized an ensemble of singer-actors to perform the new piece under the author's artistic direction. Also in 1877, of course, Charles Cros and Thomas Edison invented sound recording. More than a century later both the music and the medium continue to flourish, and indeed they have come together often and success fully--notably in the many complete versions by the D'Oyly Carte Opera Company, which have set standards of style and ensemble for generations of devotees and amateur performers. This discography documents the complete recordings of the Gilbert and Sullivan operettas made at 78 rpm, not only by the D'Oyly Carte company or under its aegis, but also by others with lesser claims to authenticity. Also included are substantial abridgements and sets of excerpts--groups of five or more sides made at essentially the same time and place and with the same performers, whether or not they were ever issued collectively or with consecutive numbering. The following comments set the recordings in the context of the D'Oyly Carte Opera Company's history. THE ACOUSTIC RECORDINGS When Richard D'Oyly Carte died in 1901, his widow Helen assumed manage ment of the businesses he had built, including the Savoy Theatre in London and the opera company, which was then on tour. In 1906 she brought the troupe back to the Savoy for a repertory season of Gilbert and Sullivan, its very first.