Materiály – Documents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Matthias Bernhard Braun auf seinem Weg nach Böhmen“ Verfasserin Anneliese Schallmeiner angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin / Betreuer: Ao Prof. Dr. Walter Krause Inhalt Seite I. Einleitung 4 II. Biographischer Abriss und Forschungslage 8 1. Biographischer Abriss zu Matthias Bernhard Braun 8 2. Forschungslage 13 III. Matthias Bernhard Braun auf seinem Weg nach Böhmen 22 1. Stilanalytische Überlegungen 22 2. Von Stams nach Plass/Plasy – Die Bedeutung des Zisterzienserordens – 27 Eine Hypothese 2.1. Brauns Arbeiten für das Zisterzienserkloster in Plass/Plasy 32 2.1.1. Die Kalvarienberggruppe 33 2.1.2. Die Verkündigungsgruppe 36 2.1.3. Der Bozzetto zur Statuengruppe der hl. Luitgard auf der Karlsbrücke 39 3. Die Statuengruppen auf der Karlsbrücke in Prag 41 3.1. Die Statuengruppe der hl. Luitgard 47 3.1.1. Kompositionelle und ikonographische Vorbilder 50 3.1.2. Visionäre und mysthische Vorbilder 52 3.2. Die Statuengruppe des hl. Ivo 54 3.2.1. Kompositionelle Vorbilder 54 3.2.2. Die Statue des hl. Franz Borgia von Ferdinand Maximilian Brokoff als 55 mögliches Vorbild für die Statue des hl. Ivo 4. Die Statue des hl. Judas Thaddäus 57 5. Brauns Beitrag zur Ausstattung der St. Klemenskirche in Prag 59 5.1. Evangelisten und Kirchenväter 60 5.2. Die Beichtstuhlaufsatzfiguren 63 6. Die Bedeutung des Grafen Franz Anton von Sporck für den Weg von 68 Matthias Bernhard Braun nach Böhmen 6.1. -

Curriculum Vitae Reto Gieré
Curriculum Vitae Reto Gieré Department of Earth and Environmental Science and Center of Excellence in Environmental Toxicology University of Pennsylvania 240 S. 33rd Street, Hayden Hall Philadelphia, PA 19104-6316, USA Office Phone: 215-898-6907 E-mail: [email protected] Department: https://www.sas.upenn.edu/earth Journal of Petrology: http://petrology.oupjournals.org European Journal of Mineralogy: https://www.european-journal-of-mineralogy.net April 2021 Education 1995 Habilitation (Venia Docendi) in Earth Sciences, Universität Basel, Switzerland 1990 Ph.D. in Earth Sciences, ETH Zürich, Switzerland Thesis title: "Quantification of element mobility at a tonalite/dolomite contact (Adamello Massif, Provincia di Trento, Italy)". Supervisors: V. Trommsdorff (ETH Zürich), H.J. Greenwood (UBC Vancouver), and F. Oberli (ETH Zürich) 1988–1989 Visiting Graduate Student, University of British Columbia, Vancouver (Canada). Graduate studies in Thermodynamics. Advisors: H.J. Greenwood, T.H. Brown 1984 Diploma in Earth Sciences, ETH Zürich, Switzerland Thesis title: "Geology and petrography of the eastern Bergell contact aureole" (in German language). Supervisors: V. Trommsdorff (ETH Zürich), V. Dietrich (ETH Zürich), A. Montrasio (Università degli Studi, Milano) Language skills Fluent in five languages: English, German, French, Italian, Romansh Current Position Since 2015 Professor, Department of Earth and Environmental Science, and Member of the Center of Excellence in Environmental Toxicology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA Previous -

Forgotten Baroque Borderland
Originalveröffentlichung in: Wasilewska, Joanna (Hrsg.): Poland - China : art and cultural heritage, Kraków 2011, S. 63-72 , Abb. 1-8 Jan K. Ostrowski Jagiellonian University, Krakow Forgotten Baroque Borderland Manuals on European modern art concentrate extensively on Italy, Flanders, Holland and France. Much less attention is paid to Spain, Germany, Austria, England and Rus sia. Poland receives at best one or two pages with a short and usually superficial de scription of arbitrarily chosen works from its largest centers, such as Krakow and War saw. The present article does not intend to question such a traditional artistic hierarchy. It is only an attempt to draw the attention of foreign art historians to certain artistic phenomena of high quality, or rather to a large artistic region about which one can find hardly any information in international literature on art. First of all, I propose a few definitions and explanations. Ihe notion of Poland of the sixteenth to the eighteenth century includes the present territories of Poland, Lithua nia, Belarus and Ukraine. Analogically, Lithuania embraced present tiny Lithuania, much greater Belarus and even some parts of Greater Russia. The Polish-Lithuanian union was dominated by a Polish-speaking and Roman Catholic population, while a large Eastern portion of the country preserved up to the end a majority which spoke Ruthenian (not Russian!) and belonged to the Eastern Church (not necessarily Ortho dox). In a few words, the territory situated roughly between the present Eastern border of Poland and the Dneper-Dvina line presented in the sixteenth-eighteenth centuries (and even later) an extremely complicated ethnic, religious and cultural picture. -
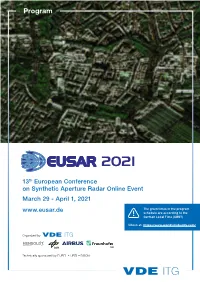
EUSAR 2021 Program
Program 13th European Conference on Synthetic Aperture Radar Online Event March 29 - April 1, 2021 The given times in the program www.eusar.de schedule are according to the German Local Time (CEST) Check at: https://www.worldtimebuddy.com/ Organized by Technically sponsored by EUREL • URSI • DGON Welcome Message of the General Chairman Dear SAR community/EUSAR partners and friends, At this point I would like to thank everybody for your long lasting loyalty in attending the EUSAR confer- A warm welcome to all EUSAR members and ences since more than two decades. followers! Best regards, take care and stay healthy, I´m happy to confirm that the postponed EUSAR Conference will take place from March 29 - April 1, 2021 as a virtual digital conference. In these times of crisis, in particular, the EUSAR board members would like to continue to offer our community a platform for intensive scientific and professional exchange. We feel responsible to give especially all authors the pos- sibility for publishing and presenting their submitted outstanding papers and posters, what means one of © Matthias Weiß the conference values. Besides this, the discussions Michael Loercher, HENSOLDT of the attending industry, research and public sector EUSAR 2021 Conference Chairman leaders inventing and providing ideas and sugges- tions for tomorrow’s innovative technology develop- ments to protect our global world. Please note already in your calendars, that the next EUSAR Conference 2022, hosted from Hensoldt AG, will take place in April 2022 in Leipzig. © Hensoldt EUSAR 2021 Welcome Message of the Technical Chairman It’s a great pleasure to welcome you to the At the closing session on the last day of the confer- 13th European Conference on Synthetic Aperture ence a Best Paper Award, a Best Poster Award, and Radar (EUSAR) 2021 which will be the first virtual three Best Students Awards will be presented. -

LE BAROQUE DE PRAGUE Le Baroque Entre Le Bernin Et Matthias Braun C'est Dans La Bohême Orientale, À Kuks, Que Matthias Braun R
LE BAROQUE DE PRAGUE Le baroque entre Le Bernin et Matthias Braun C'est dans la Bohême orientale, à Kuks, que Matthias Braun réalise, entre 1720 et 1730, son œuvre la plus curieuse, décorant la façade de l'hospice de statues allégoriques des Vertus et des Vices et aménageant tout un secteur de forêt, dit la Crèche ou Bethléem, au moyen de sculptures monumentales taillées dans le rocher, à la manière des monstres de Bomarzo. Ce sont tantôt des reliefs, tantôt des figures isolées, formant une sorte d'immense théâtre pétrifié au milieu de la végétation qui l'envahit. Les petits modèles de Braun (Saint Pierre repentant, 1719, Galerie nationale, Prague, ou La Foi des mêmes années, également à la Galerie nationale de Prague) permettent de bien voir comment Braun recherche tout d'abord une espèce de puissance d'expression emphatique au moyen de silhouettes qui se tordent et de drapés quasi convulsifs. C'est un lieu commun des historiens tchèques de voir en Braun leur Bernin tandis que Brokoff serait leur Algarde ; le parallèle est, comme toujours, discutable, mais il est certain que Braun apporte en Bohême un expressionnisme violent qui lui confère une place spéciale dans son milieu d'adoption. Gian Lorenzo Bernini, Saint Longinus, 1628 Une statue comme le Saint Jude Thaddée (probablement 1712, Galerie nationale, Prague) semble présenter une forte réminiscence du Saint Longin que Bernin avait sculpté pour Saint-Pierre : la pose et le drapé sont analogues, avec quelque chose de plus cassé et de plus anguleux dans les plis chez Braun, dû probablement au fait que sa statue est en bois. -

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk* Dwarfs and Other Curiosities in The
Dwarfs and other curiosities in the european gardens 23 Marzanna Jagiełło-Kołaczyk* Dwarfs and other curiosities in the european gardens Introduction1 Over the last few years the interest in the phe- many gardens today [2], [3], [11], [17], [18], [23], nomenon of garden gnomes has been evidently [29], [33]. growing. Their older brothers – stone dwarfs – are in The monographs on residential complexes with their a way put aside on the margin of these elaborate sculptures of dwarfs proved much more helpful to us. deliberations. So far, however, no monograph has These works brought factual information necessary for been presented which would comprehensively ana- further research [5], [8], [12], [16], [19], [20], [26], [32], lyze all aspects connected with the role played by [34]. stone dwarf figures in the European gardens. The The publications specifically on stone dwarfs regard- monographic studies regarding the subject focused ing a few garden designs such as the one on the dwarf on their historical as well as cultural and anthropo- theater in the Mirabell Gardens, the first known group logical aspects, treating stone dwarfs as a stage lead- of this kind of sculptures in the European gardens, ing to the main subject of the deliberations – ceram- proved definitely most helpful for further deliberations ic, colorful figures wearing red hats which are put in [2]. Dwarfs in antiquity The contradiction regarding placing an adult person Bes2. He was a very popular household deity revered in in a small child’s body caused by a twist of fate has fas- small chapels who protected Egyptians against misfor- cinated people since antiquity. -

Baroque Architecture
Baroque architecture Alena Šolcová Faculty of Information Technology CTU in Prague December 14th, 2018 Baroque architecture • Architectural style originating in late 16th-century Italy and lasting in some regions, notably Germany and colonial South America, until the 18th century. It had its origins in the Counter-Reformation, when the Catholic Church launched an overtly emotional and sensory appeal to the faithful through art and architecture. • Complex architectural plan shapes, often based on the oval, and the dynamic opposition and interpenetration of spaces were favoured to heighten the feeling of motion and sensuality. • Other characteristic qualities include grandeur, drama and contrast (especially in lighting), curvaceousness, and an often dizzying array of rich surface treatments, twisting elements, and gilded statuary. • Architects unabashedly applied bright colours and illusory, vividly painted ceilings. December 14, 2018 Alena Šolcová, CTU in Prague 2 Significant architectors • Outstanding practitioners in Italy included Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno (1556–1629), Francesco Borromini, and Guarino Guarini (1624–83). • Classical elements subdued Baroque architecture in France. In central Europe, the Baroque arrived late but flourished in the works of such architects as the Austrian Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723). • Its impact in Britain can be seen in the works of Christopher Wren. • The late Baroque style is often referred to as Rococo or, in Spain and Spanish America, as Churrigueresque. December 14, 2018 Alena Šolcová, CTU in Prague 3 Bernini and Borromini • Two main architects of the baroque era were Bernini and Borromini. Bernini's first medium was sculpture. He liked to incorporate lots of it into his buildings. -

Alp-Water-Scarce
ISSUE 26, MARCH 2009 AVAILABLE ON-LINE AT www.the-eggs.org EGU matters… Alp-Water-Scarce: Why we need water management in the Alps The PACHIDERME cruise onboard R/V Marion Dufresne of the French Polar Institute THE EGGS | ISSUE 26 | MARCH 2009 3 EGU News 6 News 17 Journal Watch 21 EGU matters… LETTER FROM THE PRESIDENT 22 Alp-Water-Scarce: Why we need water management in the Alps 26 The PACHIDERME cruise onboard R/V Marion Dufresne of the French Polar Institute EDITORS Managing Editor: Kostas Kourtidis Department of Environmental Engineering, School of Engineering Demokritus University of Thrace 36 New books Vas. Sofias 12, GR-67100 Xanthi, Greece tel. +30-25410-79383, fax. +30-25410-79379 email: [email protected] Assistant Editor: Magdeline Pokar Bristol Glaciology Center, 39 Events School of Geographical Sciences, University of Bristol University Road Bristol, BS8 1SS, United Kingdom tel. +44(0)117 928 8186, fax. +44(0)117 928 7878 46 Job Positions email: [email protected] Hydrological Sciences: Guenther Bloeschl Institut fur Hydraulik, Gewasserkunde und Wasserwirtschaft Technische Universitat Wien Karlsplatz 13/223, A-1040 Wien, Austria tel. +43-1-58801-22315, fax. +43-1-58801-22399 email: [email protected] Biogeosciences: Jean-Pierre Gattuso Laboratoire d’Oceanographie de Villefranche, UMR 7093 CNRS- UPMC B. P. 28, F-06234 Villefranche-sur-mer Cedex France tel. +33-(0)493763859, fax. +33-(0)493763834 email: [email protected] Geodesy: Susanna Zerbini Department of Physics, Sector of Geophysics University of Bolo- gna, Viale Berti Pichat 8 40127 Bologna, Italy tel. -
![Programme Guide [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9295/programme-guide-pdf-6529295.webp)
Programme Guide [PDF]
IEEE Geoscience and Remote Sensing Society · https://grss-ieee.org/ Contents Welcome from the General Chairs ..........................................................................................2 Sponsors & Exhibitors ................................................................................................................3 Plenary Speakers .......................................................................................................................7 Organizing Committee ..............................................................................................................8 Technical Program Committee ...............................................................................................11 Theme Coordinators ..................................................................................................11 Session Organizers ....................................................................................................12 Invited Session Organizers ........................................................................................13 Reviewers ...................................................................................................................14 Student Paper Competition ....................................................................................................20 IGARSS 2019 Technical Program .........................................................................................21 1 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium · Virtual · Brussels, -
Steel Construction 2/2015 Design and Research the International Journal for Steel Construction in Research and Practice
Steel Construction 2/2015 Design and Research The international journal for steel construction in research and practice Advertising Deadline: Publishing Date: April 17th 2015 Mai 18th 2015 Focus: Slim Floor Beams Additional Circulation: 15th International Symposium on Tubular Structures 27–29 May 2015, Rio de Janeiro/Brazil 5th Int. Congress on Construction History 3–7 June 2015, Chicago / USA 30. Österreichischer Stahlbautag 11–12 June 2015, Salzburg / Austria 8th Stessa Int. Conference Behavior of Steel Structures in Seismic Areas 1–3 July 2015, Shanghai / China Products & Projects Company news about products and projects in constructional steelwork Deadline for press releases: April 17th 2015 Editorial Content Ulrike Kuhlmann: Editorial: “Slim Floor Beams” Dennis Lam, Xianghe Dai, Ulrike Kuhlmann, Jochen Raichle, Matthias Braun: Ultimate Limit State Design of Slim Floor Construction This paper presents the design method of slim floor construction that comprises of a steel beam and a concrete or composite floor slab in which the beam is integrated within the depth of the slab. The slabs are either supported on a plate attached to the bottom flange or the bottom flange of the beam itself. The main design parameters and load transfer mechanisms are discussed. Plastic analysis has been adopted for the design of the bending capacity at ultimate loads condition and the design procedures described are in accordance with the principles given in the Eurocode 4. Focus is given to the type of shear con- nection between steel and concrete. Mark Lawson, Philippe Beguin, Renata Obiala, Mathias Braun: Slim Floor Construction using Hollow Core and Composite Decking Systems This article reviews the performance characteristics and some recent development of slim floor and integrated beam construction. -

Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning Ii Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning
Contents i Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning ii Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning Picture credits All photographs were taken by the author except those of the North Carolina Center for the Advancement of Teaching, which were taken by Connie Hanna. The view of The Hide, Ohio, was drawn by Jan Heynike. The plans in Chapter 12 are by Sandra-Jasmin Kuhn. Contents iii Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning Christopher McIntosh iv Gardens of the Gods: Myth, Magic and Meaning Published in 2005 by I.B. Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU In the United States and Canada distributed by Palgrave Macmillan, a division of St. Martin’s Press 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 www.ibtauris.com Copyright © Christopher McIntosh The right of Christopher McIntosh to be identified as the author of this work has been asserted by the author in accordance with the Copyright, Designs and Patent Act 1988. All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or any part thereof, may not be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN 1 86064 740 5 EAN 978 1 86064 740 6 A full CIP record for this book is available from the British Library A full CIP record is available from the Library of Congress Library of Congress Catalog Card Number: available Typeset by ITS, Edinburgh Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin Contents v To Ian Hamilton Finlay, who started me on the quest Contents vii CONTENTS List of Illustrations xi Acknowledgements xiii Introduction xv Chapter 1 The symbolic language of gardens The garden as an interface between nature and art. -
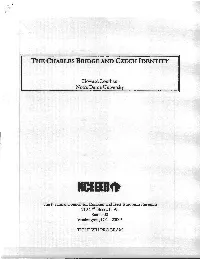
The Charles Bridge and Czech Identity
THE CHARLES BRIDGE AND CZECH IDENTIT Y Howard Louthan Notre Dame University The National Council for Eurasian and East European Researc h 910 17th Street, N.W . Suite 300 Washington, D.C. 20006 TITLE VIII PROGRAM Project Information* Principal Investigator: Howard Louthan Council Contract Number : 817-03g Date : February 10, 2003 Copyright Informatio n Scholars retain the copyright on works they submit to NCEEER . However, NCEEER possesse s the right to duplicate and disseminate such products, in written and electronic form, as follows : (a) for its internal use; (b) to the U.S. Government for its internal use or for dissemination to officials o f foreign governments ; and (c) for dissemination in accordance with the Freedom of Information Ac t or other law or policy of the U .S. government that grants the public access to documents held by the U.S. government. Additionally, NCEEER has a royalty-free license to distribute and disseminate papers submitte d under the terms of its agreements to the general public, in furtherance of academic research , scholarship, and the advancement of general knowledge, on a non-profit basis . All papers distributed or disseminated shall bear notice of copyright . Neither NCEEER, nor the U .S. Government, nor any recipient of a Contract product may use it for commercial sale . The work leading to this reporf was supported in part by contract or grant funds provided by the National Council fo r Eurasian and East European Research, funds which were made available by the U .S . Department of State under Title VIII (The Soviet-East European Research and Training Act of 1983, as amended).