Magier Der Digitalen Welt Wer Bezahlt Die Hackerszene?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
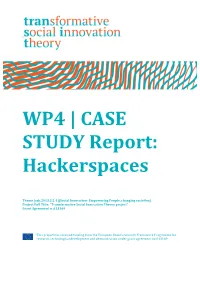
Hackerspaces
d WP4 | CASE STUDY Report: Hackerspaces Theme [ssh.2013.3.2-1][Social Innovation- Empowering People, changing societies] Project Full Title: “Transformative Social Innovation Theory project” Grant Agreement n. 613169 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613169 Suggested citation: Sabine Hielscher, Adrian Smith, Mariano Fressoli (2015) WP4 Case Study Report: Hackerspaces, Report For the TRANSIT FP7 Project, SPRU, University oF Sussex, Brighton. Acknowledgements: We wish to thank everyone in the Hackerspace scene who helped us with our research, whether through interviews, welcoming us to Hackerspaces and events, or putting us in touch with others. We also thank our colleagues in the TRANSIT project, at SPRU, at UNQ and Fundación Cenit For their help and encouragement with the research. Finally, we thank the European Commission and their FP7 research programme For Funding the TRANSIT project. Date: 14 January 2015 Authors: Sabine Hielscher, Adrian Smith, Mariano Fressoli Contact person: Adrian Smith Table of contents 1 Introduction to Hackerspaces 2 Methodology 2.1 Researcher relations to the case 2.2 Methods 3 Analysis of transnational network(ing) 3.1 Transnational networking: Hackerspaces 3.2 Aspects of ‘innovation’ and ‘change’ of the transnational network(ing) 3.3 Aspects of empowerment and disempowerment of the transnational network(ing) 3.4 Other issues about the transnational networking 4 Local initiative -

Transnationality, Morality, and Politics of Computing Expertise
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Transnationality, Morality, and Politics of Co!"#ting Ex"ertise A dissertation s#%!i&ed in partial satis action o t'e re(#ire!ents for t'e degree )octor o P'iloso"'y in Anthro"ology %y L#is Feli"e Rosado M#rillo *+,- . Co"yright by L#is Feli"e Rosado M#rillo 2+,- A/STRACT OF T0E DISSERTATION Transnationality, Morality, and Politics o Co!"#ting E$"ertise %y L#is Feli"e Rosado M#rillo )octor o P'iloso"'y in Anthro"ology Uni1ersity o Cali ornia, Los Angeles, 2+,- Pro essor C'risto"'er M2 Kelty, C'air In this dissertation I e$amine t'e alterglo%alization o co!"#ter e$"ertise 5it' a oc#s on t'e creation o "olitical, econo!ic, !oral, and tec'nical ties among co!"#ter tec'nologists 5'o are identi6ed %y "eers and sel 7identi y as 8co!"#ter 'ac9ers2: ;e goal is to in1estigate 'o5 or!s o collaborati1e 5or9 are created on a local le1el alongside glo%al "ractices and disco#rses on co!"#ter 'ac9ing, linking local sites 5it' an e!ergent transnational do!ain o tec'nical e$c'ange and "olitical action. In order to ad1ance an #nderstanding o the e$"erience and "ractice o 'ac9ing %eyond its !ain axes o acti1ity in <estern Euro"e and the United States, I descri%e and analy4e "ro=ects and career trajectories o program!ers, engineers, and hac9er acti1ists w'o are ii !e!%ers o an international networ9 o co!!#nity s"aces called 8'ac9ers"aces: in the Paci6c region. -

A Topological Space for Design, Participation and Production. Tracking Spaces of Transformation
The Journal of Peer Production New perspectives on the implications of peer production for social change Journal of Peer Production Issue 13: OPEN http://peerproduction.net — ISSN 2213-5316 A TOPOLOGICAL SPACE FOR DESIGN, PARTICIPATION AND PRODUCTION. TRACKING SPACES OF TRANSFORMATION Sandra Álvaro Sánchez ‘Space of transformation’ is a concept borrowed from Serres’ communication theory and here redefined after the evolution of the post-digital milieu and the materialistic critique of the same. Hackerspaces, fablabs, medialabs and other shared machines shops are defined here as spaces of transformation, places for the encounter between humans and non-humans, where disciplines are bridged together, hitherto severed, giving place to collective practices related to education, production and society. Shared machine shops are sited locally but also connected globally. Online, they share innovative forms of production, education and collective organization, giving place to a complex ecosystem. This article presents an analysis of the topology of this ecosystem conducted by means of tracking and visualizing the online interactions between the hackerspaces listed at the platform Hackerspaces.org. The application of network analysis is aimed to answer the research questions: First, how shared machine shops are locally and globally connected? Second, what links hackerspaces among them and these with new social issues? The concept of shared machine shops as spaces of transformation and the study of their mutual relations allows for an understanding of the transformative capacity of these spaces and how they are producing a new space for social innovation through its mutual interchange of information. Keywords: hackerspaces, network analysis, design, social innovation, space of transformation development of new organizational forms related to By Sandra Álvaro Sánchez peer-production, and the prototyping of new material products, linked to entrepreneurship and Download as PDF innovation, as well as, of new educational projects. -

Executive Director's Report
EBD #12.31 CD #23.1 2014-2015 Report to Council and Executive Board June 19, 2015 Keith Michael Fiels Executive Director ALA’s New Chief Financial Officer Mark Leon, CPA, has been appointed to the position of ALA’s Chief Financial Officer. Mark has been the CFO of Neighborhood Housing Services of Chicago since 2010. Prior to that, he served as CFO of the Noble Network of Charter Schools, and as a principal consultant with Diamond Management and Technology, Inc. He has a Bachelor of Science degree from Georgetown University and an MBA from The University of Chicago Graduate School of Business. Mark also spent three years with the U.S. Peace Corps serving in Mali and Mauritania, West Africa, as a Small Business Development Consultant. ALA OFFICES ALA Library and Knowledge Management The new ALA catalog In the past year, the ALA Library staff have migrated the ALA Library’s catalog and related functions to OCLC’s WorldShare®Management Services (WMS). Although record clean-up and resolution of issues identified in the data migration continue, the cut over from the legacy system to WMS was complete in February. In addition to migrating the catalog, the ALA Library staff collaborated with several other units to rebuild the intranet function of the legacy system into “staff only” pages off http://www.ala.org/support/, along with a guide to the online resources managed by the ALA Library, at http://www.ala.org/support/ala-digital-library. In the four months of active usage, inter-library loan requests have increased, with staff requests nearly doubling and requests to borrow, increasing by a third. -

Ethical Considerations for Research on Communal Publics
Selected Papers of #AoIR2017: The 18th Annual Conference of the Association of Internet Researchers Tartu, Estonia / 18-21 October 2017 Tracing Controversies in Hacker Networks: Ethical Considerations for Research on Communal Publics This paper reflects on the ethical implications of research tracing controversies in digital, communal publics. It addresses two interrelated questions: How private or public are communication platforms used by digitally networked communities? And how should Internet researchers assess, define and treat online environments which are technically public, but suggest varying privacy expectations on the part of involved users? These questions are relevant to a wide range of Internet research. Privacy expectations have been discussed with regards to the ethics of using Twitter, Facebook, as well as other social media data (Zimmer and Proferes 2014; Ess 2013, 35ff.; Markham and Buchanan 2012, 6ff.; Zimmer 2010). In this paper, I focus on ethical implications of communal debates on controversial subjects. Specifically, I examine how gender- and diversity-related tensions and incidents have been discussed in hacker communities. I argue that the content reflecting such controversies commonly travels across various platforms which imply different degrees of privacy expectations and therefore require distinct ethical considerations. I particularly highlight the relevance of three factors for ethical decision-making when analysing controversies: the privacy expectations suggested by traversed platforms and users’ interactions; the vulnerability and public/private status of affected individuals; and the (moral) concerns which are at stake in respective debates. Within hacker communities, issues related to gender and diversity have increasingly been subject of controversial discussions. This is on the one hand linked to the emergence of feminist hackerspaces and ‘geek feminism’ (Fox et al. -

1 United States District Court for the District Of
Case 1:15-cv-00999 Document 1 Filed 06/24/15 Page 1 of 16 UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA JASON LEOPOLD, ) ) ) Judge _____________ ) Civil Action No. ____________ and ) ) ) ALEXA O’BRIEN, ) ) ) ) ) vs. ) ) NATIONAL SECURITY AGENCY, ) 9800 Savage Rd. ) Fort Meade, MD 20755, ) ) ) DEPARTMENT OF HOMELAND ) SECURITY, ) 245 Murray Lane, SW ) Washington, DC 20528 ) ) ) DEPARTMENT OF JUSTICE, ) 950 Pennsylvania Ave., NW ) Washington, DC 20530, ) ) DEPARTMENT OF DEFENSE, ) ) 1400 Defense Pentagon ) Washington, DC 20301-1400, ) ) CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, ) Washington, DC 20505 ) ) and ) ) DEPARTMENT OF STATE, ) 2201 C St., NW ) Washington, DC 20520 ) ) ) DEFENDANTS ) 1 Case 1:15-cv-00999 Document 1 Filed 06/24/15 Page 2 of 16 COMPLAINT THE PARTIES 1. Plaintiff Jason Leopold is a citizen of California. 2. Mr. Leopold is an investigative reporter for VICE News covering a wide-range of issues, including Guantanamo, national security, counterterrorism, civil liberties, human rights, and open government. Additionally, his reporting has been published in The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times, Salon, CBS Marketwatch, The Los Angeles Times, The Nation, Truthout, Al Jazeera English and Al Jazeera America. 3. Plaintiff Alexa O’Brien is a citizen of New York. 4. Ms. O’Brien is a national security investigative journalist. Her work has been published in The Cairo Review of Global Affairs, Guardian UK, Salon, and The Daily Beast, and she has been featured on BBC, PBS’ Frontline, On The Media, and Public Radio International. For her “outstanding work” she was shortlisted for the 2013 Martha Gellhorn Prize for Journalism in the UK. 5. -

Founding a Hackerspace
Founding a Hackerspace An Interactive Qualifying Project Report Submitted to: Project Advisor: Francis Hoy Faculty of Worcester Polytechnic Institute in partial fulfillment for the requirement for the Degree of Bachelor of Science Submitted by Joseph Schlesinger Md Monirul Islam Kelly MacNeill Date: Professor Frank Hoy Project Advisor Abstract This report is the written component of our project that explores the hackerspace phenomenon. The report discusses the background and history of hackerspaces along with the social context of the modern hackerspace. Interviews of various hackerspaces were conducted and analyzed in order to gain insight into their operation and management. The research conducted was used to establish a hackerspace as a for-profit business. We describe the process of launching this entity, MakeIt Labs LLC in Lowell, MA. Also included is the business plan created for MakeIt Labs. Acknowledgements We would like to show our gratitude to the many individuals and organizations that helped us with our project by supplying us with data about the hackerspace community. These individuals allowed us know first-hand what it was like to be part of the maker community. Specifically, we would like to thank the founders and members of the following hackerspaces for giving their valuable time and valuable information: Hacker Dojo, NYC Resistor, Sprout & Co, BUILDS, and Noisebridge. Our appreciation goes to all the people who have put information about hackerspaces online. Finally, we would like to thank our project advisor, Frank Hoy, for his assistance and guidance throughout the project experience. Authorship page This project report was produced by Md Monirul Islam, Kelly MacNeill and Joseph Schlesinger. -

Modernity, Capitalism and Liberalism in Hacker Culture
This is r0ket science! Modernity, Capitalism and Liberalism in Hacker Culture By Dunajcsik Péter maxigas Submitted to Central European University Department of Sociology and Social Anthropology In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisors: Jean-Louis Fabiani Jakob Rigi Budapest, Hungary 2012 CEU eTD Collection This is r0ket science! Modernity, Capitalism and Liberalism in Hacker Culture 2011 August, Finowfurt airport, Germany. Around 5000 hackers gather for a week in tents and hangars to celebrate knowledge, sharing and creativity. The conference is called Chaos Communication Camp, and all participants receive a conference badge called the r0ket. It displays your name on an LCD panel, but it does much more than that: it is a primitive computer and wireless device designed to trigger all the cultural allergies of hackers. You can play the famous retro game Space Invaders on it, and the high scores of the game are shared amongst the crowd. Two hours after takeoff the high score system is already hacked: somebody leads the top of the list with -27500 points. Before the end of the conference, the badge is used as a component in a Do It Yourself Geiger counter, as a remote control for drones, as an electronic torch, and a dozen other amazing purposes. It has no price and it cannot be bought, but anybody can build one from basic components following the online documentation. It is a typical result of the work that goes on in more than 500 hackerspaces around the world. CEU eTD Collection A serious attempt to dissect the relevance of the hacker movement should first and foremost start by looking at practice. -

Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet and the Snowden Files Judy Anderson Concordia University - Portland
Concordia University - Portland CU Commons Faculty Research Concordia University Libraries 2015 Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet and The Snowden Files Judy Anderson Concordia University - Portland Follow this and additional works at: https://commons.cu-portland.edu/libfacultyresearch Part of the Library and Information Science Commons CU Commons Citation Anderson, Judy, "Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet and The Snowden Files" (2015). Faculty Research. 27. https://commons.cu-portland.edu/libfacultyresearch/27 This Book Review is brought to you for free and open access by the Concordia University Libraries at CU Commons. It has been accepted for inclusion in Faculty Research by an authorized administrator of CU Commons. For more information, please contact [email protected]. The following review by Judy Anderson covers two books. Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet Julian Assange with Jacob Appelbaum, Andy Moller- Magun, and Jérémie Zimmermann. New York: OR Books, 2012. 186 pp. $16 The Snowden Files Luke Harding. New York: Vintage Books, 2014. 346 pp. $14.95 The continuing saga of WikiLeaks and the fate of Edward Snowden remain a story of conflicting viewpoints. Those interested in exploring the reasoning behind such hacking and exposure will find that Cypherpunks supplies the back- ground and philosophy of the techies who feel strongly that the Internet must remain a free zone for privacy in communication, economic activity, and move- ment/travel. The Snowden Files shows another, more reserved, approach but with the same end—to alert people to the government’s invasion of their per- sonal privacy that, legally, it is only permitted access after proper procedures are followed against specific individuals. -

Peer Production with Use of 3D Printing at Hackerspaces
Vanguard of the 3D printed future: Peer production with use of 3D printing at hackerspaces By Daniel Wykretowicz Submitted to Central European University Department of Sociology and Social Anthropology In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisors: Jakob Rigi Andreas Dafinger CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2013 April 15, 2013. metalab, Vienna Andreas is printing a 3D scanned object. Even though it was a test run, he did not have to alternate the scanned file. He just pressed 'scan' and then 'print'.“It works almost as good as the Replicator from Star Trek” - I thought. In the approximately same time the first fully 3D printed gun called CEU eTD Collection “liberator” was proven functional. It was fabricated for the cost of less than 25$ with an inexpensive desktop 3D printer similar to the one at metalab. It fired 9 rounds. (Forbes 2013) Acknowledgements In a first place, I would like to thank my supervisor Jakob Rigi for encouraging me to explore a reality of hackerspaces. I would also like to thank my second supervisor Andreas Dafinger for the active feedback during my research and afterwards. On behalf of Jascha, one of my informants, I would like to thank NASA and European Space Agency for bringing humans to the space. I dedicate this thesis to all the people who keep the information free. CEU eTD Collection i Table of Contents Acknowledgements...............................................................................................................................i Table of Contents..................................................................................................................................ii -
Le « Hack » Ou Innover L’Adapter À Leurs Besoins
SHOWROOM HEIG-VD – Route de Cheseaux 1 Horaires : 10h-16h L’HISTOIRE DU HACKING Dans l’imaginaire collectif, on associe volontiers les hackers à des pirates, voire à des robins des bois de l’informatique. Mais qu’en est-il réellement ? Cette exposition montre comment le hacking est intimement lié au développement de l’informatique : il propose une vision atypique et souvent disruptive de la technologie qui a influencé, entre autres, la conception de l’ordinateur personnel et d’Internet. Les hackers peuvent être des bidouilleurs, des professionnels, des militants, des pirates, mais aussi des femmes – si elles sont peu nombreuses, elles n’en jouent pas moins un rôle important. Ces différentes figures du hacking partagent une même passion pour défricher les terres inconnues et pour l’innovation. Au cours de son histoire, le hacking a participé à la création de nouvelles technologies et de nouvelles activités professionnelles, comme en témoignent l’Orientation Sécurité informatique et le Pôles Y-Security de la HEIG-VD. Exposition du 22 octobre au 27 novembre 2020 Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains Ce document est sous licence CC BY-SA 4.0 Les crédits pour les illustrations se trouvent en fin de document. LE HACKING, QU’EST-CE QUE C’EST ? Pratiquer le hacking c’est démonter quelque chose pour en Le terme hacking comprendre les différents composants – autrement dit de l’ingénierie est dérivé du verbe inversée. Les hackers veulent mettre les mains dans le cambouis, to hack qui signifie « avoir une expérience de première main. -

Nppd Foia Log - Fy 2015
NPPD FOIA LOG - FY 2015 Request ID Requested Date Requester Name Request Description 2014-NPFO-00396 10/23/2014 Pearson, Sam All staff memos, emails, interagency or congressional correspondence available at the Department of Homeland Securitys National Protection and Programs Directorate dated May 1, 2014 through June 8, 2014, related to the release of the report of the interagency task force on chemical safety ("A Shared Commitment: Improving Chemical Facility Safety and Security") on or around June 6, 2014. 2015-NPFO-00001 10/1/2014 Donaldson, Leslie numbers of vehicles acquired by NPPD in 2012, and of those, how many were electric or hybrid powered 2015-NPFO-00002 10/2/2014 Requesting report # N14003010 dated 09/26/2014 2015-NPFO-00003 10/1/2014 requesting video footage sept 15th 2014 at foley federal courthouse spokane, wa 10/1/2014 requesting incident report # N14003027 for a slip and fall that occur at building 2015-NPFO-00004 (b)(6) 2015-NPFO-00005 10/1/2014 reopen case, 2014-NPFO-00443 requester sent coi 2015-NPFO-00006 10/3/2014 incident report incident occured 08/04/2014 2015-NPFO-00008 10/6/2014 Ross, Shaun Copies of all records pertaining to the firing, termination, resignation of Federal Police Officer who was worked at the Atlanta Airport, and Federal Protective Services. 2015-NPFO-00009 10/7/2014 requesting two citation 4595676 and 459677 issued in July 2014 2015-NPFO-00010 10/7/2014 (b)(6) requesting N14002995 2015-NPFO-00011 10/9/2014 Incident Reports 2015-NPFO-00012 10/15/2014 Santos, Rose hereby request a copy of the following documents identified to HSHQDC13Q00029: 1.