Automobile Klassiker
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
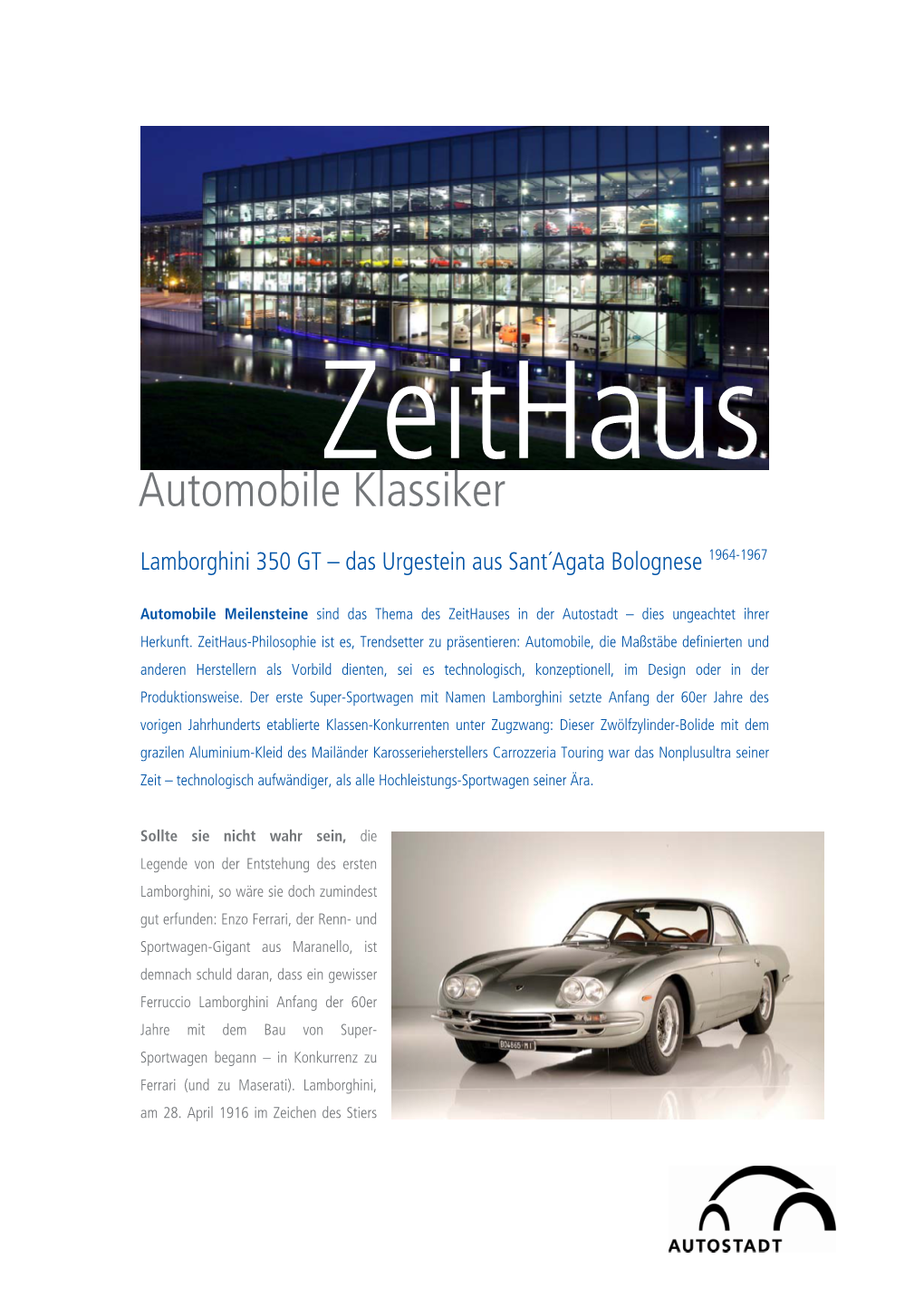
Load more
Recommended publications
-

Lamborghini 350 GT Celebrates Polostorico Restoration EN
Press Release Automobili Lamborghini S.p.A. Lamborghini 350 GT celebrates its PoloStorico restoration by making debut on track Communication Gerald Kahlke Phone number +39 051 6817711 Sant’Agata Bolognese, 13 October 2016 – A Lamborghini 350 GT, which has [email protected] just finished a one-year full restoration by Lamborghini PoloStorico, took its Press Office - Italy and Southern Europe first drive on a race track during the official hand over to its owner. The 350 Clara Magnanini Phone number +39 051 6817711 GT chassis #0121 was returned to its pure, original state with over 1150 [email protected] specialist hours’ work on the body and interior and 780 hours on mechanical Press Office – Corporate and Motorsport and electrical functions, using only Lamborghini Original Spare Parts. Chiara Sandoni Phone number +39 051 6817711 The car was delivered in a special event to the current owner, who wanted to [email protected] test his newly restored car on track for the first time. The car drove 80 Press Office – Events and perfect kilometers on the especially reserved Autodromo di Modena, in the Collezione Automobili Lamborghini Rita Passerini presence of the car’s original owner invited for the emotional occasion. The Phone number +39 051 6817711 track test revealed a perfect balance and performance by the car in general, [email protected] with precise gear changes, responsive braking and, even in the more Press Office - UK and Middle East pressured track driving environment, demonstrated -
Quarter Midget $8000
Item Title Estimate Price € 1957 Wolberg "McNamara Special" Quarter Midget $8,000 - $12,000 12.000 9.000 1959 Autobianchi Bianchina Transformabile Series II $40,000 - $50,000 40.000 30.000 1935 Cadillac V-12 Convertible Sedan $85,000 - $115,000 90.000 67.500 1935 Ford Standard Tudor Sedan $40,000 - $50,000 22.500 16.875 1967 Austin-Healey 3000 Mark III BJ8 Roadster $75,000 - $100,000 85.000 63.750 1931 Cadillac V-12 Town Sedan $100,000 - $125,000 45.000 33.750 1978 Toyota Land Cruiser FJ40 $60,000 - $80,000 70.000 52.500 1959 Jaguar XK150 S 3.4 Roadster $90,000 - $125,000 92.500 69.375 1930 Lincoln Model L Sport Phaeton $80,000 - $110,000 82.500 61.875 1955 Cadillac Series 75 Presidential Parade Limousine $120,000 - $150,000 105.000 78.750 1955 Porsche 356 Speedster $160,000 - $200,000 155.000 116.250 1968 Ferrari 365 GT 2+2 Coupe $110,000 - $130,000 135.000 101.250 1963 Jaguar E-Type Series I 3.8-Liter Fixed Head Coupe $100,000 - $125,000 85.000 63.750 1968 Lamborghini 400GT 2+2 $275,000 - $375,000 255.000 191.250 1953 Allard JR 'Le Mans' Roadster $350,000 - $450,000 550.000 412.500 1958 Mercedes-Benz 300Sc Coupe $300,000 - $350,000 250.000 187.500 1954 Cadillac Eldorado Convertible $150,000 - $200,000 130.000 97.500 1933 Auburn 8-105 Salon Retractable Hardtop Cabriolet $275,000 - $375,000 400.000 300.000 1933 Chrysler Imperial CL Convertible Roadster $550,000 - $750,000 500.000 375.000 1947 Buick Roadmaster Estate Wagon $90,000 - $120,000 67.500 50.625 1968 Jaguar E-Type Series 1½ 4.2-Liter Roadster $140,000 - $170,000 130.000 97.500 -

Audi-Report-2020 Desktop.Pdf
Content Content About the Report Querverweis 0-1 Intro Über den Bericht Audi Report 2020 Foreword 2 Audi Report 2020 Foreword 3 Milestones 1. STRATEGY How is Audi shaping the future? Brief portrait High-level meeting – how Audi is shaping the future The Audi e-tron GT quattro1 is one example of this. As the brand’s 2. OPERATING & INTEGRITYHow is Audi acting profitably and with integrity? progressive new spearhead, it is our first all-electric model A win-win-win situation for humankind, society and the environment manufactured in Germany. The e-tron GT1 stands for emotional Financial position Financial highlights electric mobility and sustainability. Economic environment Production and deliveries Now more than ever, our future success requires that we have a Production holistic understanding of sustainability, comprising the economy, Deliveries environment and society. That is why we are also integrating the Financial performance AG Financial performance financial perspectives and issues related to ESG – Environment, Net worth Social and Governance – into our reporting and are publishing a Financial position AUDI Photo: combined annual and sustainability report this year for the first Employees time. Even following last year’s acquisition of all Audi shares by Markus Duesmann Report on expected developments Dear Volkswagen AG, this approach will allow us to uphold transpar- Cost and investment discipline Chairman of the Board of Management and Member of the Board of Manage- ency as well as explain and classify correlations. Report on risks and opportunities Readers, ment for Product Lines of AUDI AG Report on risks and opportunities Operating principle of opportunities management As a year, 2020 was defined by uncertainty and radical change. -

2018 Lamborghini Polo Storico
Press Release Lamborghini Polo Storico presents latest restoration projects and Automobili Lamborghini S.p.A. V12 4.0 liter engine project at Salon Rétromobile 2018, Paris Head of Communications Gerald Kahlke T +39 051 6817711 [email protected] Sant’Agata Bolognese/Paris 7 February 2018 – Lamborghini Polo Storico is at Salon Rétromobile in Paris, from 7 to 11 February, with a prize-winning Miura Brand & Corporate Communications and a right-hand drive Countach currently undergoing renovation. The heritage Clara Magnanini T +39 051 6817711 department of Automobili Lamborghini also displays examples of newly- [email protected] manufactured V12 4.0 liter engine heads, as part of its ongoing commitment to Corporate Media Events & Motorsport PR original Lamborghini spare parts for classic Lamborghini models. Chiara Sandoni T +39 051 6817711 The 1976 Lamborghini Countach LP400, chassis #1120204, is part-way through [email protected] its complete restoration by Lamborghini Polo Storico. Every part of the vehicle Product Media Events & has been disassembled and overhauled including the matching-numbers Collezione Communications engine. Rita Passerini T +39 051 6817711 [email protected] The car is now being repainted in its original yellow color using paint from manufacturer PPG, and subjected to paint tests and hand polishing before the Lamborghini Squadra Corse Communications car is reassembled. Components are replaced as necessary using Lamborghini Lorenzo Facchinetti T +39 051 6817711 original spare parts ensuring the car’s authenticity. Its interior in original [email protected] Tabacco color is being refurbished. Press Office UK Juliet Jarvis The 1967 Lamborghini Miura P400, chassis #3264, represents a T +44 1933 666560 comprehensive ten-month restoration project carried out by Lamborghini Polo [email protected] Storico. -

December 2020
The official newsletter of The Revs Institute Volunteers The Revs Institute 2500 S. Horseshoe Drive Naples, Florida, 34104 (239) 687-7387 Editor: Eric Jensen [email protected] Assistant Editor: Morris Cooper Volume 26.4 December 2020 Thanks to this month’s Our Volunteer Coordinator Retires contributors: Joe Ryan Jim Claeys Tom Dussault Being asked to write a message for the front Max Trullenque page of the Tappet Clatter is not something to be taken lightly. That space is where the editor Mark Koestner posts the important stuff . the messages he Jane Hamel wants everyone to read. How do I put into words how special working Susan Kuehne with the volunteers at Revs has been and how the experience has Whitney Herod changed me without getting too sappy? Phil Panos What pops into my mind is a memory from a day in June of 2012. I had only been on board a week or so when I noticed a group of volunteers Inside this waiting by reception to lead a group from a local car club through the December Issue: collection. I gathered my courage, walked up, and introduced myself. Volunteer Cruise 3 They were warm, welcoming, gracious, and truly seemed pleased to meet me. Who were they? Lodge McKee, Jim Clarke, Troy Marsh, Ralph Rookery Bay Show 4 Stoesser, Mitch Sayers, Jess Yarger, and Lee McCaskey. Talk about your Lunch at the Museum 7 “A” team! In those early days Paul Kierstein and Joe Leikhim’s offices Christmas on 5th 8 were just steps away from mine and they always took time to answer any questions I had (and there were many). -

Amcham Business Luncheon, Frankfurt, 16
Rupert Stadler Chairman of the Board of Management of AUDI AG 50th jubilee of Lamborghini Sant’Agata Bolognese, 11. May 2013 – Check against delivery – Ladies and Gentlemen! On behalf of the Audi people and my Board of Management colleagues: Welcome to this gala evening! And thank you to everyone responsible for the perfect organization of this event. We are delighted to be here in Sant’Agata Bolognese this evening, and to celebrate Lamborghini’s 50th jubilee with you. We are celebrating a brand that for about 15 years has been a subsidiary and also a strong partner of Audi. We are very proud to have Lamborghini on board! Because I am not exaggerating when I say, that without a doubt, a Lamborghini sets its own benchmark! A Lamborghini is the epitome of a super sports car! I can well remember, when we did the first steps to acquire this new family member from Italy. I was the head of the general staff of Dr. Ferdinand Piëch, who was then the Chairman of the Board of Management of the Volkswagen Group. I experienced close up: how we made contact with Lamborghini for the first time, and discussed supplying engines, how our discussions became more intensive, and how Lamborghini finally became a part of our corporate family. Together with the then CEO of Audi, Franz Josef Paefgen, we signed the contract in London on July 24, 1998. So overnight, we were represented in the segment of super sports cars. And in the whole Group, Lamborghini is today a brightly shining brand. On this occasion, I like to welcome the Chairman of the Board of Management of Volkswagen AG, Professor Martin Winterkorn! Audi develops premium automobiles, which inspire customers all over the world with innovative design, advanced technology and power. -

Prices Realized Total Sold: $129,789,750
Prices Realized Total Sold: $129,789,750 The Pebble Beach Auctions Pebble Beach, California August 20 & 21, 2016 The following prices are in US Dollars and include the buyer’s premium of 10% and are rounded to the nearest dollar. Unsold lots are not shown. Gooding & Company is not responsible for typographical errors or omissions. Lot Description $ Price Lot Description $ Price 1 1989 Ferrari 328 GTB 115,500 50 1948 Maserati A6/1500 Coupe 852,500 2 1968 Lamborghini 400 GT 2+2 390,500 51 1962 Maserati 3500 GT 572,000 3 1954 Alfa Romeo 1900 C Coupe 412,500 52 1937 Cord 812 S/C Phaeton 269,500 4 1933 Packard Eight 1001 Coupe Roadster 214,500 53 1967 Chevrolet Corvette 427/435 Roadster 236,500 5 1984 Ferrari 512 BBi 313,500 54 1914 Marmon Model 41 Speedster 1,017,500 6 1922 Marmon 34B Touring 159,500 55 1972 Ferrari 365 GTB/4 Daytona 825,000 7 2001 Ferrari 550 Barchetta 325,000 56 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 13,500,000 8 1939 Cadillac Series 75 Convertible Coupe 209,000 59 1998 Ferrari 550 Maranello 280,500 9 1967 Toyota 2000 GT 533,500 60 1979 Porsche 935 4,840,000 10 1989 Porsche 911 Carrera 3.2 Club Sport 330,000 61 1968 Ferrari 330 GTC 550,000 11 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 297,000 62 1939 Chevrolet Master DeLuxe Station Wagon 203,500 12 1966 Jaguar E-Type Series I 4.2-Litre Roadster 253,000 63 1985 Lancia Delta S4 Stradale 440,000 13 2011 Porsche 997 GT2 RS 539,000 64 1960 Ferrari 250 GT Coupe 924,000 14 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1,430,000 66 1972 Iso Grifo Series II 511,500 15 2011 Ferrari 458 -

Lamborghini Marzal at GP Historique Monte Carlo EN
Press Release History repeats itself: Automobili Lamborghini S.p.A. the Lamborghini Marzal made its first outing since 1967 at the GP de Monaco Historique driven by Prince Albert of Monaco Head of Communications Gerald Kahlke T +39 051 9597611 Sant’Agata Bolognese/Monte Carlo, 14 May 2018 – Lamborghini Polo Storico [email protected] went back in history taking the Lamborghini Marzal back to Monte Carlo for Brand & Corporate Communications the Grand Prix de Monaco Historique. The first and last car of its kind was Clara Magnanini made in 1967 and last weekend, more than 50 years later, it was once again T +39 051 9597611 [email protected] opening the qualifiers and races of 1966-1972 Formula 1 vehicles at this celebrated event, driven by his Serene Highness Prince Albert of Monaco Corporate Media Events & Motorsport PR Chiara Sandoni accompanied his nephew Andrea Casiraghi. T +39 051 9597611 To celebrate the 50 th anniversary of the Lamborghini Espada, there was also [email protected] an Espada model, chassis #9090, which has just been restored at the Polo Product Media Events & Storico workshop in Sant’Agata Bolognese. Collezione Communications Rita Passerini T +39 051 9597611 In 1967, Lamborghini took its latest creation to Montecarlo on the occasion of [email protected] the Formula 1 Grand Prix. The Lamborghini Marzal is a four-seater GT and an extraordinary futuristic prototype made by Carrozzeria Bertone, with glazed Motorsport Communications Lorenzo Facchinetti gullwing doors offering an almost unimpeded view of the interior, with silver T +39 051 9597611 leather upholstery and a rear transverse engine. -

Auction Results Monterey
Auction Results Monterey Lot Year - Make / Model Chassis # Price Sold 101 2002 AAR Alligator Motorcycle 1D9SB170X2S440004 $17,600.00 Sold 102 1981 AAR Eagle Indianapolis 8104 $38,500.00 Sold 103 1969 AAR Eagle-Santa Ana Indianapolis 702 $104,500.00 Sold 104 1957 Mercedes-Benz 190 SL Roadster 121.042.7500610 $341,000.00 Sold 105 1961 Porsche 356 B 1600 Cabriolet 154790 $176,000.00 Sold 106 1963 Alfa Romeo 2600 Spider AR 106.01 191551 $110,000.00 Sold 107 1967 Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 Sports Convertible H-BJ8-L/41305 $159,500.00 Sold 108 1979 Lamborghini Countach LP400S Series I 1121098 $1,012,000.00 Sold 109 1981 Ferrari 512 BB 35409 $473,000.00 Sold 110 1963 Ferrari 250 GTE 2+2 Series III 4303 GT $473,000.00 Sold 111 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 198.040.5500368 $2,530,000.00 Sold 112 1989 Ferrari Testarossa ZFFSG17A7K0082581 $242,000.00 Sold 113 1961 Jaguar XK150 3.8 Drophead Coupe S 838630 DN $240,000.00 114 1936 Mercedes-Benz 540 K Special Cabriolet 130913 $1,540,000.00 Sold 115 1938 Bugatti Type 57C Stelvio 57597 $770,000.00 Sold 116 1968 Ferrari 330 GTC 10937 $825,000.00 Sold 117 1953 Bentley R-Type Continental Sports Saloon BC20A $1,210,000.00 Sold 118 1964 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta 5233 GT $1,980,000.00 Sold 119 1958 Dual-Ghia Convertible 195 $385,000.00 Sold 120 1960 Aston Martin DB4GT DB4/GT/0119/L $2,090,000.00 Sold 121 1955 Lancia Aurelia B24S Spider America B24S-1134 $1,025,000.00 122 1962 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 198.042.10.002992 $1,127,500.00 Sold 123 1957 Mercedes-Benz 220 S Cabriolet 180.030Z.7512620 -

Lamborghini Polostorico at Retromobile 2017 EN
Press Release Automobili Lamborghini S.p.A. Lamborghini PoloStorico at Rétromobile 2017 with the first restored 350 GT Communications Department Gerald Kahlke Sant’Agata Bolognese, 8 February 2017 – Lamborghini PoloStorico Phone +39 051 6817711 [email protected] participates for the first time at Rétromobile 2017, the international classic car exhibition held in Paris from 8 to 12 February. The Lamborghini 350 GT Press Office - Italy and Southern Europe Clara Magnanini chassis number 0121, one of the first fifteen examples produced by Phone +39 051 6817711 Automobili Lamborghini and the first 350 GT to be restored by Lamborghini [email protected] PoloStorico, is on public display for the first time at the PoloStorico stand. Press Office – Corporate and Motorsport Chiara Sandoni The restoration of the bodywork and interior took 1150 hours, plus 780 Phone +39 051 6817711 additional hours for checking mechanical and electrical functions. These [email protected] operations brought the car back to its original beauty according to a very Press Office – Events and precise philosophy of restoration: Lamborghini PoloStorico always strives to Collezione Automobili Lamborghini Rita Passerini maintain the car’s originality as much as possible, and the conservation work Phone +39 051 6817711 involves exclusive use of original Lamborghini parts, specially reconstructed [email protected] in certain instances. The parts reconstruction process is enhanced where Press Office - UK and Middle East possible by seeking out the historical suppliers and using the original Juliet Jarvis technical drawings and designs. Phone - +44 (0) 7733 224774 [email protected] For the 350 GT on display at Rétromobile 2017, particular attention was given Press Office - North and South America to reworking the engine cooling system, the braking system, and the fuel Jiannina Castro Phone - +1(703)364-7926 system, to ensure safety as well as authenticity. -

Concorso Italiano Award Winners 2008
Concorso Italiano Page 1 of 3 2008 Trophy Presentation Best of Show 1967 Lamborghini 400 GT 2+2 Jorge Bujazan; Tijuana, Mexico/Baja, CA 2008 Coppa Milano-Sanremo Pininfarina Award Hemmings Motor ews Award Award 1957 Ferrari Superamerica 1965 Ferrari 275 GTB Shortnose 1960 Ferrari 250 SWB Berlinetta Family Classic Cars, Peter Read Art McAuley San Juan Capistrano, CA BEST OF MARQUE Alfa Romeo De Tomaso Ferrari http://www.concorso.com/website%20updates/winners08.htm 10/3/2008 Concorso Italiano Page 2 of 3 Alfa Romeo / 1st DeTomaso / 1st Ferrari / 1st 1962 Alfa Romeo Guilietta SS 1969 DeTomaso Mangusta 1972 Ferrari 365 GB4 Sal & Denise Scriandra Tom Galli Alan Cavey Alfa Romeo / 2nd DeTomaso / 2nd Ferrari / 2nd 1965 Alfa Romeo 2600 Spider 1985 DeTomaso Pantera GT5-S 1960 Ferrari 250 SWB Berlinetta Bob Yeager Jim & Carol Coyne Peter Read Alfa Romeo / 3rd DeTomaso / 3rd Ferrari / 3rd 1970 Alfa Romeo Junior Zagato 1973 DeTomaso Pantera 1966 Ferrari 275 TTS Tom Sahines Tom Tjaarda Robert Brower Sr Fiat Iso Lamborghini Fiat/Abarth / 1st Iso / 1st Lamborghini / 1st 1966 Fiat 500 1970 Iso Grifo 1967 Lamborghini 400 GT 2+2 Marty Stitsel Gerd Eckstein Jorge Bujazan Fiat/Abarth / 2nd Iso / 2nd Lamborghini / 2nd 1981 Fiat Spider 1966 Iso Rivolta GT 1994 Lamborghini Diablo VT Frank DeSimone Eric Sands & Teri Ashurst Eric Enos Fiat/Abarth / 3rd Iso / 3rd Lamborghini / 3rd 1968 Fiat Dino 206 Spider 1964 Iso Rivolta GT 1966 Lamborghini 350 GT SuperLeggera Danny Soukup Ted & Jan Hirth Kevin Cogan Lancia Maserati Motorcycle Lancia / 1st Maserati / 1st Motorcycle -

Auction Results the Don Davis Collection
Auction Results The Don Davis Collection Lot Year - Make / Model Chassis # Price Sold 101 1957 Ford Thunderbird Convertible D7FH140526 $85,250.00 Sold 102 1970 Mercedes-Benz 280SL Roadster 113.044.12.014397 $77,000.00 Sold 103 1962 Chevrolet Bel Air Sport Coupe 21637S294496 $110,000.00 Sold 104 1991 Ferrari Testarossa ZFFSG17AXM0087423 $104,500.00 Sold 105 1954 Buick Skylark Convertible A1055968 $143,000.00 Sold 106 1946 Chrysler Town & Country Convertible 7400604 $132,000.00 Sold 107 1974 BMW 3.0 CS 4310374 $110,000.00 Sold 108 1957 Oldsmobile Starfire Ninety-Eight Convertible 579A04375 $165,000.00 Sold 109 1963 Chevrolet Corvette Sting Ray 'Fuel-Injected' Split-Window Coupe 30837S117508 $192,500.00 Sold 110 2005 Ford GT 1FAFP90S85Y400530 $231,000.00 Sold 111 1973 Porsche 911 Carrera RS Touring 9113601108 $506,000.00 Sold 112 1965 Shelby 289 Cobra CSX 2332 $1,001,000.00 Sold 113 1932 Ford Three-Window Custom Coupe 18-1392444 $99,000.00 Sold 114 1961 Mercedes-Benz 300SL Roadster 198.042.10.002839 $935,000.00 Sold 115 1958 Porsche 356A 1600 Cabriolet 150638 $121,000.00 Sold 116 1980 BMW M1 WBS59910004301360 $242,000.00 Sold 117 1957 Cadillac Eldorado Biarritz Convertible 5762076125 $187,000.00 Sold 118 1969 Chevrolet Camaro Z/28 RS Coupe 124379N642448 $115,500.00 Sold 119 1961 Chevrolet Corvette Custom Convertible 10867S108131 $217,250.00 Sold 120 1957 Porsche 356A 1600 Super 'Sunroof' Coupe 100208 $176,000.00 Sold 121 1966 Chevrolet Corvette Sting Ray 427/425 'Big Tank' Coupe 194376S118164 $220,000.00 Sold 122 1950 Oldsmobile 88 Deluxe