LBB 0036 2 0801-0822.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
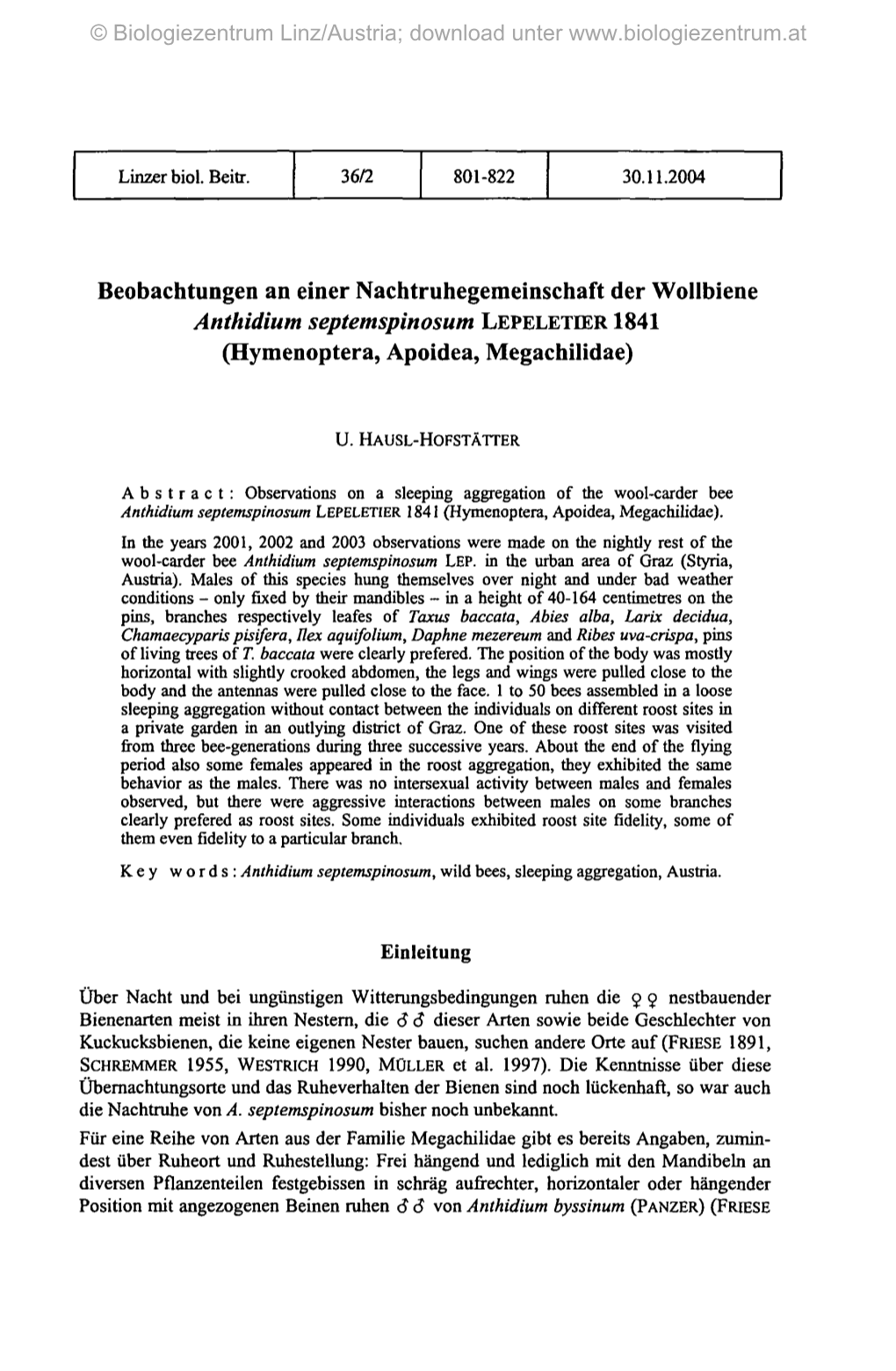
Load more
Recommended publications
-

Actualisation Des Connaissances Sur L'abeille
Actualisation des connaissances sur l’abeille Megachile sculpturalis SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae) Violette Le Féon, David Genoud, Benoît Geslin To cite this version: Violette Le Féon, David Genoud, Benoît Geslin. Actualisation des connaissances sur l’abeille Megachile sculpturalis SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae). OSMIA, Observa- toire des Abeilles, 2021, 9, pp.25-36. 10.47446/OSMIA9.4. hal-03285483 HAL Id: hal-03285483 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03285483 Submitted on 13 Jul 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Revue d’Hyménoptérologie Volume 9 Journal of Hymenopterology 2021 ISSN 2727-3806 https://doi.org/10.47446/OSMIA ARTICLE Actualisation des connaissances sur l’abeille Megachile sculpturalis SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae) Violette LE FÉON1 • David GENOUD2 • Benoît GESLIN3 LE FÉON, V., D. GENOUD & B. GESLIN (2021). Actualisation des connaissances sur l’abeille Megachile sculpturalis SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae). Osmia, 9: 25–36. https://doi.org/10.47446/OSMIA9.4 Résumé Megachile sculpturalis est une abeille originaire de l’est de l’Asie aujourd’hui également présente en Amérique du Nord et en Europe. -
(Hymenoptera, Apoidea, Anthophila) in Serbia
ZooKeys 1053: 43–105 (2021) A peer-reviewed open-access journal doi: 10.3897/zookeys.1053.67288 RESEARCH ARTICLE https://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Contribution to the knowledge of the bee fauna (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila) in Serbia Sonja Mudri-Stojnić1, Andrijana Andrić2, Zlata Markov-Ristić1, Aleksandar Đukić3, Ante Vujić1 1 University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Serbia 2 University of Novi Sad, BioSense Institute, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Serbia 3 Scientific Research Society of Biology and Ecology Students “Josif Pančić”, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Serbia Corresponding author: Sonja Mudri-Stojnić ([email protected]) Academic editor: Thorleif Dörfel | Received 13 April 2021 | Accepted 1 June 2021 | Published 2 August 2021 http://zoobank.org/88717A86-19ED-4E8A-8F1E-9BF0EE60959B Citation: Mudri-Stojnić S, Andrić A, Markov-Ristić Z, Đukić A, Vujić A (2021) Contribution to the knowledge of the bee fauna (Hymenoptera, Apoidea, Anthophila) in Serbia. ZooKeys 1053: 43–105. https://doi.org/10.3897/zookeys.1053.67288 Abstract The current work represents summarised data on the bee fauna in Serbia from previous publications, collections, and field data in the period from 1890 to 2020. A total of 706 species from all six of the globally widespread bee families is recorded; of the total number of recorded species, 314 have been con- firmed by determination, while 392 species are from published data. Fourteen species, collected in the last three years, are the first published records of these taxa from Serbia:Andrena barbareae (Panzer, 1805), A. -

The Bees (Apidae, Hymenoptera) of the Botanic Garden in Graz, an Annotated List 19-68 Mitteilungen Des Naturwissenschaftlichen Vereines Für Steiermark Bd
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 146 Autor(en)/Author(s): Teppner Herwig, Ebmer Andreas Werner, Gusenleitner Fritz Josef [Friedrich], Schwarz Maximilian Artikel/Article: The bees (Apidae, Hymenoptera) of the Botanic Garden in Graz, an annotated list 19-68 Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark Bd. 146 S. 19–68 Graz 2016 The bees (Apidae, Hymenoptera) of the Botanic Garden in Graz, an annotated list Herwig Teppner1, Andreas W. Ebmer2, Fritz Gusenleitner3 and Maximilian Schwarz4 With 65 Figures Accepted: 28. October 2016 Summary: During studies in floral ecology 151 bee (Apidae) species from 25 genera were recorded in the Botanic Garden of the Karl-Franzens-Universität Graz since 1981. The garden covers an area of c. 3.6 ha (buildings included). The voucher specimens are listed by date, gender and plant species visited. For a part of the bee species additional notes are presented. The most elaborated notes concern Hylaeus styriacus, three species of Andrena subg. Taeniandrena (opening of floral buds for pollen harvest,slicing calyx or corolla for reaching nectar), Andrena rufula, Andrena susterai, Megachile nigriventris on Glau cium, behaviour of Megachile willughbiella, Eucera nigrescens (collecting on Symphytum officinale), Xylocopa violacea (vibratory pollen collection, Xylocopa-blossoms, nectar robbing), Bombus haematurus, Nomada trapeziformis, behaviour of Lasioglossum females, honeydew and bumblebees as well as the flowers ofViscum , Forsythia and Lysimachia. Andrena gelriae and Lasioglossum setulosum are first records for Styria. This inventory is put in a broader context by the addition of publications with enumerations of bees for 23 other botanic gardens of Central Europe, of which few are briefly discussed. -

Body Size As an Estimator of Production Costs in a Solitary Bee
Ecological Entomology (2002) 27, 129±137 Body size as an estimator of production costs in a solitary bee 1,2 2 JORDI BOSCH and N A R C IÂ SVICENS 1Biology Department, UtahState University, U.S.A. and 2Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Spain Abstract. 1. Body weight is often used as an estimator of production costs in aculeate Hymenoptera; however, due to differences between sexes in metabolic rates and water content, conversion of provision weight to body weight may differ between males and females. As a result, the cost of producing female progeny may often have been overestimated. 2. Provision weight and body weight loss throughout development were measured in a solitary bee, Osmia cornuta (Latreille), to detect potential differ- ences between sexes in food weight=body weight conversion. 3. Male O. cornuta invest a larger proportion of larval weight in cocoon spinning, and presumably have higher metabolic rates than females during the larval period; however, this is compensated by a slightly longer larval period in females. 4. Overall, body weight loss throughout the life cycle does not differ significantly between sexes. As a result, cost production ratios calculated from provision weights and from adult body weights are almost identical. 5. The validity of other weight (cocoon, faeces) and linear (head width, inter- tegular span, wing length, cocoon length, and cell length) measures as estimators of production costs is also discussed. 6. Valid estimators of production costs vary across species due to differences in sex weight ratio, cocoon shape, provision size in reference to cell size, and adult body size. -

Phylogenetic Systematics and the Evolution of Nesting
PHYLOGENETIC SYSTEMATICS AND THE EVOLUTION OF NESTING BEHAVIOR, HOST-PLANT PREFERENCE, AND CLEPTOPARASITISM IN THE BEE FAMILY MEGACHILIDAE (HYMENOPTERA, APOIDEA) A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Jessica Randi Litman January 2012 ! ! ! ! ! ! ! ! © 2012 Jessica Randi Litman ! PHYLOGENETIC SYSTEMATICS AND THE EVOLUTION OF NESTING BEHAVIOR, HOST-PLANT PREFERENCE, AND CLEPTOPARASITISM IN THE BEE FAMILY MEGACHILIDAE (HYMENOPTERA, APOIDEA) Jessica Randi Litman, Ph.D. Cornell University 2012 Members of the bee family Megachilidae exhibit fascinating behavior related to nesting, floral preference, and cleptoparasitic strategy. In order to explore the evolution of these behaviors, I assembled a large, multi-locus molecular data set for the bee family Megachilidae and used maximum likelihood-, Bayesian-, and maximum parsimony-based analytical methods to trace the evolutionary history of the family. I present the first molecular-based phylogenetic hypotheses of relationships within Megachilidae and use biogeographic analyses, ancestral state reconstructions, and divergence dating and diversification rate analyses to date the antiquity of Megachilidae and to explore patterns of diversification, nesting behavior and floral preferences in the family. I find that two ancient lineages of megachilid bees exhibit behavior and biology which reflect those of the earliest bees: they are solitary, restricted to deserts, build unlined -

Checklist of the Bees in the Czech Republic and Slovakia with Comments on Their Distribution and Taxonomy (Insecta: Hymenoptera: Apoidea)
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 4 Číslo 1, 2004 CHECKLIST OF THE BEES IN THE CZECH REPUBLIC AND slovakia WITH COMMENTS ON THEIR DISTRIBUTION AND taxonomy (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) A. Přidal Received: September 5, 2003 Abstract PŘIDAL, A.: Checklist of the bees in the Czech Republic and Slovakia with comments on their distribu- tion and taxonomy (insecta: Hymenoptera: Apoidea). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2004, LII, No. 1, pp. 29-66 Complete faunistics was compiled in countries surrounding the Czech Republic and Slovakia. The latest checklist of the bee fauna from the then Czechoslovakia being published well over a decade ago, the aim of this paper is to up-date Kocourek’s checklist (hereinafter referred to as only ”the List”) from 1989. In the present paper, inaccuracies occurring in Kocourek’s checklist (e.g. using of junior synonyms or homonyms, spelling of names, incorrect species distribution, etc.) are corrected. In addition, new records according to literature data, findings communicated by colleagues, or own records, are sum- marised. The compilation of this faunistic list required checking of over 750 names of the species group and more than 140 supraspecific names to be used valid and available names. The faunistic revision results in the following findings. In total, 431 bee species range the Bohemian territory (occurrence was approved); of that, the follow- ing species are newly included: 4 species according to records (captured or checked specimen(s)) and 3 species as per literature data. Five species are conditionally removed from the Bohemian fauna, ten species are missing, eleven species are removed from the checklist, and the occurrence of one species is potential. -

Supplementary Figure 1 | an Overview of the Study Site Locations
Supplementary Figure 1 | An overview of the study site locations. Note that some of the symbols are overlapping where a study had temporal (yearly) replicates. Further details of studies are given in Supplementary Table 1. 1 0.5 1 0.4 0.8 0.3 0.6 0.2 0.4 flower visits 5 mostdominant 0.1 0.2 visits totalflower Mean contribution: 0.05 totalofproportionMean 0 0 0 5 10 15 20 25 ofproportionmeanCumulative Species abundance rank order Supplementary Figure 2 | The relationships between the species abundance rank order and the mean (cumulative) proportional contribution of species to the total crop- visitation by wild bee species. Depicted are means (±s.e. indicated by dashed lines) of 90 studies. 2 700 A 600 500 400 300 200 dominant species dominant unique of Number 100 0 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Minimum contribution for species to qualify as dominant 25 B 20 15 10 5 species per study per species 0 Mean number of dominant dominant of number Mean 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Minimum contribution for species to qualify as dominant 1 C 0.8 0.6 0.4 0.2 0 visits by dominant species dominant by visits bee wild total of Proportion 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 Minimum contribution for species to qualify as dominant Supplementary Figure 3 | The relationship between threshold level for identifying dominant crop-visiting bee species and the proportion of the total wild bee visits made by dominant bee species. -

Пчелы Трибы Anthidiini Ashmead, 1899 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) Сибири И Дальнего Востока России
Кавказский энтомол. бюллетень 9(1): 147– 158 © CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULL. 2013 Пчелы трибы Anthidiini Ashmead, 1899 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) Сибири и Дальнего Востока России The bees of the tribe Anthidiini Ashmead, 1899 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) of Siberia and the Russian Far East М.Ю. Прощалыкин M.Yu. Proshchalykin Биолого-почвенный институт ДВО РАН, просп. 100-лет Владивостоку, 159, Владивосток 690022 Россия Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 100-let Vladivostoku av., 159, Vladivostok 690022 Russia. E-mail: [email protected] Ключевые слова: Hymenoptera, Apoidea, Apiformes, таксономия, фауна, Палеарктика. Key words: Hymenoptera, Apoidea, Apiformes, taxonomy, fauna, Palaearctic. Резюме. В фауне Сибири и Дальнего Востока 22 административных субъекта Российской Федерации России выявлено 17 видов из 6 родов пчел трибы общей площадью более 12.7 млн кв. км, что составляет Anthidiini. Icteranthidium fedtschenkoi (Morawitz, 1875) около 75% от территории России (рис.1) [Национальный указывается впервые для фауны России. Данные по атлас..., 2008]. В отношении пчел Сибирь и Дальний распространению Anthidiini в Сибири и на Дальнем Восток изучены весьма неоднородно. Наиболее полные Востоке России существенно расширены. Обозначен данные имеются по Дальнему Востоку и некоторым лектотип для Anthidium comatum Morawitz, 1896. регионам Восточной Сибири (Якутия, Забайкалье), в Предложена новая синонимия Anthidium amurensis то время как данные по Западной Сибири отрывочны -

Die Bienenarten Deutschlands (Hymenoptera, Apidae) Ein Aktualisiertes Verzeichnis Mit Kritischen Anmerkungen
3 Die Bienenarten Deutschlands (Hymenoptera, Apidae) Ein aktualisiertes Verzeichnis mit kritischen Anmerkungen Paul Westrich und Holger H. Dathe Abstract: [The bee species of Germany (Hymenoptera, Apidae). An updated checklist with critical comments. – Mit- teilungen des entomologischen Vereins Stuttgart, vol. 32 (1997): 3-34.] – Exhaustive literature studies and revisions of museum and private collections were made in order to present an updated checklist of the bee species whose past or present occurence we have confirmed within the boundaries of Germany following reunification. The checklist contains 547 species of 40 genera. Critical comments are given on more than a hundred species to confirm or to correct state- ments in the literature, to add new records and to identify the location of deposited material. Zusammenfassung: Nach kritischer Sichtung der Literaturangaben und umfangreichen Nachprüfungen des Belegma- terials in Museen und Privatsammlungen wird eine Liste von 547 Bienenarten aus 40 Gattungen vorgelegt, für die ein ehemaliges oder aktuelles Vorkommen in den heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zweifelsfrei belegt ist. Auf weitere Formen mit umstrittenem oder ungeklärtem Status, auf Fehlermeldungen und glaubhafte Literaturangaben sowie auf den Verbleib von überprüften Belegexemplaren wird in Anmerkungen gesondert eingegangen. n Einleitung Infolge der großen Zahl und schwierigen Unterscheidbarkeit der Bienenarten haben sich die Be- arbeiter weitgehend auf einzelne Gattungen oder Gruppen spezialisiert, so daß sich die Erkennt- nis in eher isolierten Schritten vollzieht und Übersichtsarbeiten nur selten unternommen werden. Schon durch den dadurch bedingten zeitlichen Abstand ist es kaum möglich, ältere Nachweise für Deutschland ohne kritische Prüfung zu übernehmen. In seiner „Fauna Apoideorum Germaniae“ war STOECKHERT (1954) noch in vielen Aussagen auf Literaturangaben angewiesen, ganz abge- sehen von den zahlreichen Veränderungen im taxonomischen und nomenklatorischen Status vieler Arten seitdem. -

Five Years of Citizen Science and Standardized Field Surveys Reveal A
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.10.434823; this version posted March 10, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 1 Five years of citizen science and standardized field surveys reveal 2 a threatened urban Eden for wild bees in Brussels, Belgium 3 4 Nicolas J. Vereecken1*, Timothy Weekers1, Leon Marshall1, Jens D’Haeseleer2, Maarten 5 Cuypers2, Pieter Vanormelingen2, Alain Pauly3, Bernard Pasau4, Nicolas Leclercq1, Alain 6 Tshibungu1, Jean-Marc Molenberg1 & Stéphane De Greef1 7 8 1 Agroecology Lab, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. 9 2 Natuurpunt Studie, Mechelen, Belgium. 10 3 Directorate Taxonomy & Phylogeny, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, 11 Belgium. 12 4 Natagora Bruxelles, Mundo-B, Bruxelles , Belgium. 13 14 15 * Correspondence to: N.J. Vereecken, Agroecology Lab, Université libre de Bruxelles 16 (ULB), Avenue F.D. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles, Belgium. E-mail: 17 [email protected] 18 19 Manuscript title: Five years of citizen science and standardized field surveys reveal a 20 threatened urban Eden for wild bees in Brussels, Belgium 21 Manuscript running title: Urban wasteland and wild bee diversity 22 23 Short communication 24 25 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.10.434823; this version posted March 10, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 26 Abstract. 1. Urbanisation is often put forward as an important driver of biodiversity loss, 27 including for pollinators such as wild bees. -

Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) Described from Crimea, North Caucasus, European Part of Russia and Ural
Number 328: 1-34 ISSN 1026-051X January 2017 http/urn:lsid:zoobank.org:pub:72B3D9DC-5435-42EC-9908-9573C8B1F161 THE SPECIES-GROUP NAMES OF BEES (HYMENOPTERA: APOIDEA, APIFORMES) DESCRIBED FROM CRIMEA, NORTH CAUCASUS, EUROPEAN PART OF RUSSIA AND URAL. PART II. FAMILIES ANDRENIDAE AND MEGACHILIDAE M. Yu. Proshchalykin1), Yu. V. Astafurova2), A. Z. Osytshnjuk 1) Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: [email protected] 2) Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 199034, Russia. E- mail: [email protected] An annotated list of 102 species-group names of bees from 14 genera of families Andrenidae and Megachilidae described by 14 authors from Crimea, North Caucasus, European part of Russia and Ural in 1848–2010 is given. Of them 45 species are valid. For each taxon the data about the types and their depository, current taxonomic status and distribution are given. Lectotypes are designated for 28 nominal taxa: Andrena aberrans Eversmann, 1852, A. ambigua Eversmann, 1852, A. candens Eversmann, 1852, A. caspica Morawitz, 1886, A. consobrina Eversmann, 1852, A. derbentina Morawitz, 1886, A. erythrocnemis Morawitz, 1871, A. eversmanni ciscaspica Popov, 1949, A. fallax Eversmann, 1852, A. figurata Morawitz, 1866, A. floricola Eversmann, 1852, A. fulvitarsis Eversmann, 1852, A. gravida Eversmann, 1852, A. limbata Eversmann, 1852, A. nigrifrons Eversmann, 1852, A. nobilis Mora- witz, 1874, A. quadricincta Eversmann, 1852, A. scabrosa Morawitz, 1866, A. scita Eversmann, 1852, A. senilis Eversmann, 1852, A. xanthothorax Eversmann, 1852, Anthidium pubescens Morawitz, 1872, Osmia grandis Morawitz, 1872, O. -

Behaviour and Life History of a Large Carpenter Bee (Xylocopa Virginica) in the Northern Extent Ofits Range
1 Behaviour and Life History of a Large Carpenter Bee (Xylocopa virginica) in the Northern Extent ofits Range by Sean Michael Prager, B.A. A Thesis submitted to the Department ofBiological Sciences in partial fulfilment ofthe requirements for the degree of Doctor ofPhilosophy Brock University St. Catharines, Ontario © Sean M. Prager, 2008 2 Abstract Large carpenter bees (Hymenoptera: Apidae: Xylocopa) have traditionally been thought ofas exhibiting solitary or occasionally communal colony social organization. However, studies have demonstrated more complex fonns ofsocial behaviour in this genus. In this document, I examine elements ofbehaviour and life history in a North American species at the northern extreme ofits range. Xylocopa virginica was found to be socially polymorphic with both solitary and meta-social or semi-social nests in the same population. In social nests, there is no apparent benefit from additional females which do not perfonn significant work or guarding. I found that the timing oflife-history events varies between years, yet foraging effort only differed in the coldest and wettest year of2004 the study. Finally, I that male X virginica exhibit female defence polygyny, with resident and satellite males. Resident males maintain their territories through greater aggression relative to satellites. 3 Ack'nowledgements A project likethis does not happen without the assistance ofthose who choose to contribute some oftheir intellectual fitness. I only hope they received some indirect fitness. Fiona Hunter was amazing in fighting for me and getting me to defence, I could not have done this without your aid. Jean Richardson provided advice, consul and many hours ofdata checking. To the other members ofmy committee: JeffStuart, Jon Middleton, Miriam Richards and early on Bob Caroline, your help is much appreciated.