INSECTA HELWTICA Fauna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
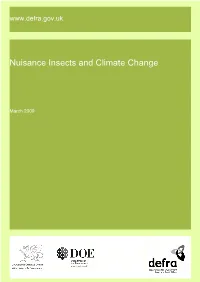
Nuisance Insects and Climate Change
www.defra.gov.uk Nuisance Insects and Climate Change March 2009 Department for Environment, Food and Rural Affairs Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: 020 7238 6000 Website: www.defra.gov.uk © Queen's Printer and Controller of HMSO 2007 This publication is value added. If you wish to re-use this material, please apply for a Click-Use Licence for value added material at http://www.opsi.gov.uk/click-use/value-added-licence- information/index.htm. Alternatively applications can be sent to Office of Public Sector Information, Information Policy Team, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ; Fax: +44 (0)1603 723000; email: [email protected] Information about this publication and further copies are available from: Local Environment Protection Defra Nobel House Area 2A 17 Smith Square London SW1P 3JR Email: [email protected] This document is also available on the Defra website and has been prepared by Centre of Ecology and Hydrology. Published by the Department for Environment, Food and Rural Affairs 2 An Investigation into the Potential for New and Existing Species of Insect with the Potential to Cause Statutory Nuisance to Occur in the UK as a Result of Current and Predicted Climate Change Roy, H.E.1, Beckmann, B.C.1, Comont, R.F.1, Hails, R.S.1, Harrington, R.2, Medlock, J.3, Purse, B.1, Shortall, C.R.2 1Centre for Ecology and Hydrology, 2Rothamsted Research, 3Health Protection Agency March 2009 3 Contents Summary 5 1.0 Background 6 1.1 Consortium to perform the work 7 1.2 Objectives 7 2.0 -

Duplication and Diversification of Dipteran Argonaute Genes, and the Evolutionary Divergence of Piwi and Aubergine
GBE Duplication and Diversification of Dipteran Argonaute Genes, and the Evolutionary Divergence of Piwi and Aubergine Samuel H. Lewis1,4,*, Heli Salmela2, and Darren J. Obbard1,3 1 Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, United Kingdom 2Department of Biosciences, Centre of Excellence in Biological Interactions, University of Helsinki, Helsinki, Finland 3Centre for Immunity, Infection and Evolution, University of Edinburgh, United Kingdom 4Present Address: Department of Genetics, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EH *Corresponding author: E-mail: [email protected]. Downloaded from Accepted: February 1, 2016 Data deposition: This project has been deposited to GenBank under the accession KR012647-KR012696. http://gbe.oxfordjournals.org/ Abstract Genetic studies of Drosophila melanogaster have provided a paradigm for RNA interference (RNAi) in arthropods, in which the microRNA and antiviral pathways are each mediated by a single Argonaute (Ago1 and Ago2) and germline suppression of trans- posable elements is mediated by a trio of Piwi-subfamily Argonaute proteins (Ago3, Aub, and Piwi). Without a suitable evolutionary context, deviations from this can be interpreted as derived or idiosyncratic. Here we analyze the evolution of Argonaute genes across the genomes and transcriptomes of 86 Dipteran species, showing that variation in copy number can occur rapidly, and that there is constant flux in some RNAi mechanisms. The lability of the RNAi pathways is illustrated by the divergence of Aub and Piwi (182– at National Library of Health Sciences on August 10, 2016 156 Ma), independent origins of multiple Piwi-family genes in Aedes mosquitoes (less than 25Ma), and the recent duplications of Ago2 and Ago3 in the tsetse fly Glossina morsitans. -

Is the Y Chromosome of Drosophila an Evolved Supernumerary
Johannes H. P. Hackstein, Ron Hochstenbach, Elisabeth Hauschteck-Jungen and Leo W. Beukeboom Summary The Y chromosomes of most Drosophila species are necessary for male fertility but they are not involved in sex determination. They have many puzzling properties that resemble the effects caused by B chromosomes. Classical genetic and molecular studies reveal substantial affinities between Y and B chromosomes and suggest that the Y chromosomes of Drosophila are not degenerated homologues of the X chromosomes, but rather that their Y chromosomes evolved Accepted as specialized supernumeraries similar to classical B chromosomes. 7 December 1995 Introduction detailed analysis of the gene hierarchies in Drosophila and Sex chromosomes are morphologically distinct chromosomes Caenorhabditisrevealed that the formal mechanisms are not that seem to be correlatedto the sex of the carriehl). Classical conserved either(5).In some instances, such as the house fly examples are the X and Y chromosomes found in mammals, Musca domesfica(6)and poecilid fish(1°-12),different variants Drosophilids and certain plants, and the W and Z chromo- of sex determination systems are realized within one species. somes that are characteristic for many butterflies, reptiles and Classical theories about the evolution of sex chromo- bird^(^-^). The presence of an exceptional chromosome, i.e. somes assume that the heteromorphic chromosomes arose the Y or W, in only one of the two sexes suggests that the het- from their homologous chromosomes after recombinational eromorphic sex chromosomes control sexual differentiation. isolation and a progressive inactivation by Muller’s However, this is generally not the case in invertebrates. In ratchet(’3!l4).In some cases it is obvious that the X and Y or those invertebrates that have been studied genetically, the the W and Z chromosomes are derived from a homologous assumption that the number of homomorphic (i.e. -

Diptera, Drosophilidae)
Redescription of the Alaskan species Drosophila populi (Diptera, Drosophilidae) Autor(en): Vilela, Carlos R. / Bächli, Gerhard Objekttyp: Article Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society Band (Jahr): 82 (2009) Heft 3-4 PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-402994 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE 80: 259-269.2007 Redescription of the Alaskan species Drosophila populi (Diptera, Drosophilidae) Carlos R. Vilela1 & Gerhard Bächli2 1 Departamento de Genètica e Biologia Evolutiva, Institutode Biocièncias, Universidade de Sào Paulo. -

The Evolution and Ecology of Drosophila Sigma Viruses Ben
The evolution and ecology of Drosophila sigma viruses Ben Longdon PhD University of Edinburgh 2011 Declaration The work within this thesis is my own, except where clearly stated. Chapters 2-5 are published or submitted manuscripts and so have kept the use of “we”. Chapters 1 and 6 were written purely as thesis chapters and so use “I”. Ben Longdon ii Thesis abstract Insects are host to a diverse range of vertically transmitted micro-organisms, but while their bacterial symbionts are well-studied, little is known about their vertically transmitted viruses. The sigma virus (DMelSV) is currently the only natural host- specific pathogen to be described in Drosophila melanogaster. In this thesis I have examined; the diversity and evolution of sigma viruses in Drosophila, their transmission and population dynamics, and their ability to host shift. I have described six new rhabdoviruses in five Drosophila species — D. affinis, D. obscura, D. tristis, D. immigrans and D. ananassae — and one in a member of the Muscidae, Muscina stabulans (Chapters two and four). These viruses have been tentatively named as DAffSV, DObsSV, DTriSV, DImmSV, DAnaSV and MStaSV respectively. I sequenced the complete genomes of DObsSV and DMelSV, the L gene from DAffSV and partial L gene sequences from the other viruses. Using this new sequence data I created a phylogeny of the rhabdoviruses (Chapter two). The sigma viruses form a distinct clade which is closely related to the Dimarhabdovirus supergroup, and the high levels of divergence between these viruses suggest that they may deserve to be recognised as a new genus. Furthermore, this analysis produced the most robustly supported phylogeny of the Rhabdoviridae to date, allowing me to reconstruct the major transitions that have occurred during the evolution of the family. -

Mode of Action, Origin and Structure of the Paternal Sex Ratio Chromosome in the Parasitoid Wasp Trichogramma Kaykai
M��� �� ������, ������ ��� ��������� �� ��� P������� S�� R���� ���������� �� ��� ���������� ���� T����������� ������ Promotoren: Prof. dr. J.C. van Lenteren - Hoogleraar in de Entomologie Prof. dr. R.F. Hoekstra - Hoogleraar in de Erfelijkheidsleer Co-promotoren: Dr. J. H. de Jong - Universitair hoofddocent, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer Dr. R. Stouthamer - Associate Professor, Department of Entomology, University of Califor- nia, Riverside, USA Promotiecommissie: Prof. dr. L.W. Beukeboom, Rijksuniversiteit Groningen Dr. J.A.J. Breeuwer, Universiteit van Amsterdam Prof. dr. M.S.M. Sosef, Wageningen Universiteit Prof. dr. M. Dicke, Wageningen Universiteit Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen de onderzoekschool Experimentele Plantenweten- schappen (EPW) J��� J.F.A. ��� V��� M��� �� ������, ������ ��� ��������� �� ��� P������� S�� R���� ���������� �� �� ���������� ���� T����������� ������ Proefschri� ter verkrijging van de graad van doctor op gezag van de rector magnificus van Wageningen Universiteit Prof. dr. ir. L. Speelman in het openbaar te verdedigen op woensdag � Juni ���� des namiddags te vier uur in de Aula Joke J.F.A. van Vugt (����) Mode of action, origin and structure of the Paternal Sex Ratio chromosome in the parasitoid wasp Trichogramma kaykai Thesis Wageningen University - with references - with summary in Dutch ISBN ��-����-���-� � Contents Abstract � Chapter � General introduction � J.J.F.A. van Vugt Chapter � Paternal sex ratio chromosomes in parasitoid wasps: an over- �� view of the ins and outs of these extremely selfish B chromo- somes J.J.F.A. van Vugt & R. Stouthamer Chapter � The paternal sex ratio chromosome in the parasitic wasp Tricho- �� gramma kaykai condenses the paternal chromosomesinto a dense chromatin mass J.F.A. van Vugt, M. Salverda, H. de Jong & R. Stouthamer Chapter � The origin of a selfish B chromosome triggering paternal sex �� ratio (PSR) in the parasitoid wasp Trichogramma kaykai J.J.F.A. -

The Virome of Drosophila Suzukii, an Invasive Pest of Soft Fruit
Edinburgh Research Explorer The virome of Drosophila suzukii, an invasive pest of soft fruit Citation for published version: Medd, NC, Fellous, S, Waldron, FM, Xuéreb, A, Nakai, M, Cross, JV & Obbard, DJ 2018, 'The virome of Drosophila suzukii, an invasive pest of soft fruit', Virus Evolution, vol. 4, no. 1, pp. vey009. https://doi.org/10.1093/ve/vey009 Digital Object Identifier (DOI): 10.1093/ve/vey009 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Publisher's PDF, also known as Version of record Published In: Virus Evolution Publisher Rights Statement: VC The Author(s) 2018. Published by Oxford University Press. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 Virus Evolution, 2018, 4(1): vey009 doi: 10.1093/ve/vey009 Research article The virome of Drosophila suzukii, an invasive pest of soft fruit Nathan C. -

Duplication and Diversification of Dipteran Argonaute Genes, and the Evolutionary Divergence of Piwi and Aubergine
GBE Duplication and Diversification of Dipteran Argonaute Genes, and the Evolutionary Divergence of Piwi and Aubergine Samuel H. Lewis1,4,*, Heli Salmela2, and Darren J. Obbard1,3 1 Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, United Kingdom 2Department of Biosciences, Centre of Excellence in Biological Interactions, University of Helsinki, Helsinki, Finland 3Centre for Immunity, Infection and Evolution, University of Edinburgh, United Kingdom 4Present Address: Department of Genetics, University of Cambridge, Downing Street, Cambridge, CB2 3EH *Corresponding author: E-mail: [email protected]. Accepted: February 1, 2016 Data deposition: This project has been deposited to GenBank under the accession KR012647-KR012696. Abstract Genetic studies of Drosophila melanogaster have provided a paradigm for RNA interference (RNAi) in arthropods, in which the microRNA and antiviral pathways are each mediated by a single Argonaute (Ago1 and Ago2) and germline suppression of trans- posable elements is mediated by a trio of Piwi-subfamily Argonaute proteins (Ago3, Aub, and Piwi). Without a suitable evolutionary context, deviations from this can be interpreted as derived or idiosyncratic. Here we analyze the evolution of Argonaute genes across the genomes and transcriptomes of 86 Dipteran species, showing that variation in copy number can occur rapidly, and that there is constant flux in some RNAi mechanisms. The lability of the RNAi pathways is illustrated by the divergence of Aub and Piwi (182– 156 Ma), independent origins of multiple Piwi-family genes in Aedes mosquitoes (less than 25Ma), and the recent duplications of Ago2 and Ago3 in the tsetse fly Glossina morsitans. In each case the tissue specificity of these genes has altered, suggesting functional divergence or innovation, and consistent with the action of dynamic selection pressures across the Argonaute gene family. -

Funktion Und Evolution Pflanzlicher B-Chromosomen
Funktion und Evolution pflanzlicher B-Chromosomen Habilitationsschrift zur Erlangung des akademischen Grades doctor agriculturarum habilitatus (Dr. agr. habil.) verteidigt am 14.12.2009 an der Naturwissenschaftlichen Fakultät III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg von Dr. agr. Andreas Houben geb. am 06.05.1963 in Magdeburg Gutachter: Prof. Dr. Klaus Pillen (Martin-Luther Universität Halle-Wittenber) Prof. Dr. Thomas Schmidt (Technische Universität Dresden) Prof. Dr. Christian Jung (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät III Prof. Dr. Peter Wycisk Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung und Fragestellung 4 2. Eigene Arbeiten (A1-A20) 7 3. Zusammenfassende Diskussion 29 3.1. Ursprung und Evolution von B-Chromosomen 29 3.2. A- und B-Chromosomen können sich in der Verteilung 33 von Eu- und Heterochromatin-typischen Histonveränderungen unterscheiden 3.3. Meiotische B-Chromosomen zeigen eine veränderte 36 Zellzyklus-abhängige Histon H3-Phosphorylierung 3.4. Segregationsverhalten und Zentromere von 37 B-Chromosomen 3.5. B-Chromosomen zeigen eine schwache 39 Transkriptionsaktivität 3.6. Brachycome dichromosomatica, eine Modellart für die 40 Analyse von B-Chromosomen 3.7. Potentielle Anwendung von B-Chromosomen in der 43 Biotechnologie 4. Zusammenfassung (in Deutsch und Englisch) 44 5. Literaturverzeichnis 52 Danksagung 58 2 Abkürzungsverzeichnis bp Basenpaar Bs B-Chromosomen 2C DNA-Gehalt des diploiden, unreplizierten Chromosomensatzes DAPI 4’,6’-Diamidino-2-Phenylindol FISH Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung -

Drosophila Information Service
.. ......... DROSOPHILA INFORMATION SERVICE Number 60 June 1984 Prepared at the Division of Biological Sciences University of Kansas Lawrence, Kansas 66045 - USNA Pub] ftjtion costs are partly funded by NSF Grant BSR840758 to R.C. Woodruff. For information regarding submission of manuscripts or other contributions to Drosophila Information Service, contact P. W. Hedrick, Editor, Division of Biological Sciences, University of Kansas, Lawrence, Kansas 66045 - USA. June 198 14 DROSOPHILA INFORMATION SERVICE 60 DIS 60 - Table of Contents 60: v ERRATA ....................................... ANNOUNCEMENTS and 25th ANNUAL DROSOPHILA CONFERENCE REPORT ............. 60: vi SPECIAL REPORTS MERRIAM, J. Cloned DNA by chromosome location, May 22, 19814 ............. 60: 1 MERRIAM, J. Chromosome rearrangements available for ''jumping' with one breakpoint known within a cloned sequence, May 31, 19814 ........ 60: 10 MERRIAM, J. Transformed lines available for cloning or deleting DNA at specific chromosome sites, May 25, 19814 ........... 60: 13 TREAT-CLEMONS, L.G. and W.W. DOANE. Biochemical loci of the ''fruit fly'' (Drosophila melanogaster) ...................... 60: 17 RESEARCH NOTES ACHARY, P.M.R., P.K. DUTTA and A.K. DUTTAGUPTA. Repl icon properties of Drosophila genome. I. DNA fibre autoradiography of salivary gland 143 cells held at the mid-part of S-phase ...................... 60: ALBORNOZ, J. A new allele (Hr) at the Hairless locus of Drosophila melanogaster. 60: 1414 ALEXANDROV, I.D. Comparative genetics of neutron- and y-ray-induced lethal b, cn and vg mutations in D.melanogaster . . . . . . . . . . . . . . . . . 60: 145 ALONSO, A. and A. MUNOZ. Biometric characterization of some wing measurement in Drosophila melanogaster ................ 60: 147 ALONSO, A., A. RABASCO and A. MUNOZ. Allele frequencies distribution at the Est-C locus in win cellar populations of Drosophila melanogaster .......... -

Drosophila Suzukii, an Invasive Pest of Soft Fruit
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/190322; this version posted September 18, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. The virome of Drosophila suzukii, an invasive pest of soft fruit Nathan C. Medd1, Simon Fellous2, Madoka Nakai3, Anne Xuéreb2, Jerry V. Cross4 and Darren J. Obbard1,5 1Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, Edinburgh, UK 2INRA, Montpellier, France 3Tokyo University of Horticulture and Technology, Fuchu, Tokyo 4NIAB-EMR, East Malling, Kent, UK 5Centre for immunity infection and evolution, University of Edinburgh, Edinburgh, UK Abstract Drosophila suzukii (Matsumura) is an invasive dipteran pest of soft fruits that causes substantial damage to the horticultural crops of Europe and North America. As conventional control of this pest is challenging, an environmentally benign microbial biopesticide is highly desirable. A lethal virus could prove to be such a control agent. Here we use a metatranscriptomic approach to discover new viruses infecting this fly and its larvae, in both its native (Japanese) and invasive (British and French) ranges. We describe 18 new RNA viruses, including members of the Picornavirales, Mononegavirales, Bunyavirales, Chuviruses, Nodaviridae, Tombusviridae, Reoviridae, and Nidovirales, and discuss their phylogenetic relationships with previously known viruses. We also detect 18 previously described viruses of other Drosophila species that show potential association with D. suzukii in the wild. Importance Drosophila suzukii is one of the most damaging and costly pests to invade temperate horticultural regions in recent history. Current control methods rely heavily on labour intensive cultural control and environmentally harmful chemical controls. -

The Virome of Drosophila Suzukii, an Invasive Pest of Soft Fruit Nathan C
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/190322; this version posted February 15, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. The virome of Drosophila suzukii, an invasive pest of soft fruit Nathan C. Medd1*, Simon Fellous2, Fergal M. Waldron1, Anne Xuéreb2, Madoka Nakai3, Jerry V. Cross4 and Darren J. Obbard1,5 1Institute of Evolutionary Biology, University of Edinburgh, Edinburgh, UK 2INRA, Montpellier, France 3Tokyo University of Horticulture and Technology, Fuchu, Tokyo 4NIAB-EMR, East Malling, Kent, UK 5Centre for immunity infection and evolution, University of Edinburgh, Edinburgh, UK *Corresponding Author: [email protected] bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/190322; this version posted February 15, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. Abstract Drosophila suzukii (Matsumura) is one of the most damaging and costly pests to invade temperate horticultural regions in recent history. Conventional control of this pest is challenging, and an environmentally benign microbial biopesticide is highly desirable. A thorough exploration of the pathogens infecting this pest is not only the first step on the road to the development of an effective biopesticide, but also provides a valuable comparative dataset for the study of viruses in the model family Drosophilidae. Here we use a metatransciptomic approach to identify viruses infecting this fly in both its native (Japanese) and invasive (British and French) ranges. We describe 18 new RNA viruses, including members of the Picornavirales, Mononegavirales, Bunyavirales, Chuviruses, Nodaviridae, Tombusviridae, Reoviridae, and Nidovirales, and discuss their phylogenetic relationships with previously known viruses.