Oktober 1984
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Neuzugänge Bibliothek Am Goetheanum 2014
NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK AM GOETHEANUM 2014 Insgesamt 369 Titel, alphabetisch nach Autor aufgelistet. Anna Iduna Zehnder (1877–1955) - Künstlerin, Ärztin, Anthroposophin / [Hrsg.: Thomas Schmutz ... et al.]. - Zürich : Scheidegger & Spiess ; Aarau : Aargauer Kunsthaus, 2013 Aenis, Hans Georg. - Farben - Formen - Leben [Bildmaterial] : ein Porträt / Hans Georg Aenis ; [mit Beiträgen von Ruedi Bind ... [et al.]. - Stuttgart : Urachhaus, 2014 Allison, John. - A way of seeing : perception, imagination, and poetry / by John Allison. - Great Barrington, Mass. : Lindisfarne Books, 2003 ; Edinburgh : Floris Althaus, Junko. - Die moralische Intuition : Anleitung zu einem Erkenntnisprozess auf Grundlage der "Philosophie der Freiheit" Rudolf Steiners / Junko Althaus. - Zürich : Jakchos Verlag, 2013 Parcours après l'école Waldorf d'anciens élèves = Pathways taken by Waldorf graduates / Julie Archambault ... [et al.] ; trad. Nicolas Walker. - Québec : Les Éditions Perceval, 2009 Archiati, Pietro. - Geisteswissenschaft im 3. Jahrtausend : anlässlich der Erscheinung von SKA Band 5 / Pietro Archiati. - Bad Liebenzell : Rudolf Steiner Ausgaben, 2013 Archiati, Pietro. - Geisteswissenschaft im 3. Jahrtausend : das Ringen um den Geist in der Kultur und im Menschen / Pietro Archiati. - Bad Liebenzell : Rudolf-Steiner-Ausgaben, 2014 Arendt, Hannah 1906-1975. - Ich will verstehen : Selbstauskünfte zu Leben und Werk / Hannah Arendt ; hrsg. von Ursula Ludz : mit einer vollständigen Bibliographie. - München : Piper, 2013 Arendt, Hannah 1906-1975. - Menschen in finsteren Zeiten / Hannah Arendt ; hrsg. von Ursula Ludz. - München ; Zürich : Piper, 2013 Arendt, Hannah 1906-1975. - Das Urteilen : Texte zu Kants Politischer Philosophie : dritter Teil zu "Vom Leben des Geistes" / Hannah Arendt ; aus dem Nachlass hrsg. und mit einem Essay von Ronald Beiner ; aus dem Amerikanischen von Urslula Ludz. - München : Piper, 2013 ; Zürich Arendt, Hannah 1906-1975. - Zwischen Vergangenheit und Zukunft / Hannah Arendt ; hrsg. -

Celebrating 80 Years Camphill School Aberdeen
Celebrating 80 Years Camphill School Aberdeen Compiled by John Richards June 2020 1 Contents Heading Page Introduction and key themes 3 Day 1: June 1st 4 Camphill 80th Celebration Day 2: June 2nd 7 Children/Young People profiles Day 3: June 3rd 10 Co-worker Profiles Day 4: June 4th 16 Art and Creativity Day 5: June 5th 20 Challenges facing Camphill Day 6: June 6th 23 Activities in Camphill Day 7: June 7th 26 Camphill: a Global Movement PR coverage leading up to and during the celebrations 28 2 Introduction and key themes and Canada and today facing the challenge of Covid 19 On 1st June 2020, Camphill School celebrated its 80th Birthday. From humble 7. Camphill Globally: description and beginnings in 1939/40, the Camphill photos of the expansion of Camphill movement has become a worldwide in UK and the world. Visual map movement with 127 communities. showing where the communities are currently situated; narrative The birthday took place at a time when about CSA special links with other there was a global Coronavirus Pandemic Camphill’s and the bi-annual with consequential lockdown in Scotland. Camphill Dialogue The plans that had been made to have a major exhibition of the 80 years, centred on a summer fayre, welcoming past and Feedback from those following the week- present students, staff, former co-workers long celebration of stories was positive and and local dignitaries had to be put on hold. so much so, that we decided to make this We decided instead to have our services publication of the material. -

A Biographic Synopsis
Karl König – A Biographic Synopsis September 25th 1902 birth at Rotensterngasse 4 in Vienna‘s 2nd District, the only child of Aron Ber (Adolf) and Bertha König (née Fischer) February 21st 1910 the family moves to Glockengasse 1, Vienna 2, to the house where the family business was – the shoe shop. July 1920 School Graduation 1920 - 1921 Studies of Latin, mathematics, botany and zoology in Vienna November 1921 Latin examination, giving access to the medical faculty 1921 - 1927 Medical studies an der University of Vienna (Doctorate - M.D. - April 1927) 1921 - 1924 Demonstrator (Assistant) at the "Embryological Institute of Viennna" and first publications about the efficacy of substances after homeopathic dilution March 23rd 1925 Membership in the Anthroposophical Society November 1927 - September 1928 Assistant with Dr. Ita Wegman at the Clinik, Arlesheim and at the curative home "Sonnenhof". Courses for doctors and therapists July 1928: First journey to England (with Ita Wegman) and lecture at the "World Conference on Spiritual Science and its Practical Applications" in London September 1928 - 1936 Co-founding, development and leadership of Schloss Pilgramshain in Silesia, one of the early anthroposophic centres for curative education. Extensive medical work and lecture tours in Germany, Bohemia and Austria 1929 The “old youth group“ begins in Vienna: Hans Schauder, Rudi Lissau, Alex Baum, Sali Gerstler (later Barbara Lipsker), Trude Blau (later Amman), Edy Weisberg, Bronja Hüttner, Liesel Schwalb (later Schauder) and others May 5th 1929 Marriage to Mathilde ("Tilla") Elisabeth Maasberg (1902 – 1983), The first three children are born in Pilgramshain: Renate 3.12. 30, Christoph 8.2. 33, Andreas 23.7. -
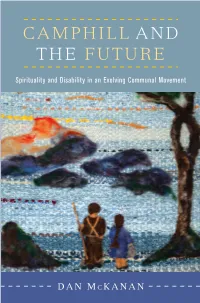
Camphill and the Future
DISABILITY STUDIES | RELIGION M C KANAN THE CAMPHILL MOVEMENT, one of the world’s largest and most enduring networks of intentional communities, deserves both recognition and study. CAMPHILL A ND Founded in Scotland at the beginning of the Second World War, Camphill communities still thrive today, encompassing thousands of people living in more CAMPHILL than one hundred twenty schools, villages, and urban neighborhoods on four continents. Camphillers of all abilities share daily work, family life, and festive THE FUTURE celebrations with one another and their neighbors. Unlike movements that reject mainstream society, Camphill expressly seeks to be “a seed of social renewal” by evolving along with society to promote the full inclusion and empowerment of persons with disabilities, who comprise nearly half of their residents. In this Spirituality and Disability in an Evolving Communal Movement multifaceted exploration of Camphill, Dan McKanan traces the complexities of AND THE the movement’s history, envisions its possible future, and invites ongoing dia- logue between the fields of disability studies and communal studies. “Dan McKanan knows Camphill better than anyone else in the academic world FUTURE and has crafted an absorbing account of the movement as it faces challenges eighty years after its founding.” TIMOTHY MILLER, author of The Encyclopedic Guide to American Inten- tional Communities “This book serves as a living, working document for the Camphill movement. Spirituality and Disability Communal Movement in an Evolving McKanan shows that disability studies and communal studies have more to offer each other than we recognize.” ELIZABETH SANDERS, Managing Director, Camphill Academy “With good research and wonderful empathy, McKanan pinpoints not only Cam- phill’s societal significance but also how this eighty-year-old movement can still bring potent remediation for the values and social norms of today’s world.” RICHARD STEEL, CEO, Karl König Institute DAN MCKANAN is the Emerson Senior Lecturer at Harvard Divinity School. -

Camphill Correspondence May/June 2015
May/June 2015 The Pink Mountain, Deborah Ravetz Poetry isn’t vague uncertainties, it is inexplicable certainties. Gerard Manley-Hopkins Birthday List May – June 2015 Becoming 94 Contents Marianne Gorge, Simeon Houses ...............16 June Becoming 93 Developmental dilemmas. Part one Monica Dorrington, Ringwood ..................20 June Andrew Plant ............................................... 1 Becoming 90 Wera Levin, Überlingen................................8 June Grizel Davidson, Newton Dee ...................29 June Whitsun, then and now Jens-Peter Linde ..........4 Becoming 85 Michael Schmundt, Markus Gemeinshaft....10 June Economics and the Spirit Part 2 Gerda Holbek, Camphill Schools ...............18 June Carlo Pietzner ..............................................5 Becoming 80 Edelgard Übelucker, Weinstein ...................28 May Anthroposophical hotspot Robin Jackson .........7 Ita Bay, Heiligenberg ....................................1 June Becoming 75 The Threefold Social Organism Karl König ......8 Gabriele Macke, Lehenhof .........................22 May Ilsabe Muller, Lehenhof ................................1 June Kaspar Hauser and empathy Jens-Peter Linde ...9 Becoming 70 Allmut ffrench, Rowan, England .................10 May Gay van der Westhuizen, Hermanus Farm ..24 May Obituaries: Turid Engel 10 / Eleanor Shartle 11 Astrid Åkerholm, Vallersund Gård ..............13 June Vreni Glur, Glencraig .................................16 June News from the movement: Any additions or changes, Arts festival at Beaver Run -

Camphill and the Future
1 Camphill Generations All Camphillers would agree that theirs is a multiple-generation movement. But there is no shared understanding of where one Camphill generation ends and the next begins. The concept of a “generation” is inherently fuzzy. Since some people have children at age fifteen and others at age forty-five, three generations might pass in one family during another family’s single generation. Some groups of peo- ple, born at roughly the same time, attain a powerful sense of shared identity— most notably the baby boomers (born between 1946 and 1964) and the millennials (born between 1980 and 1996). There are also events in Camphill’s history that bonded specific generational cohorts together. At least four generations have left powerful imprints on Camphill. I use the term founding generation to include the circle of friends who fled from Vienna to Scotland in 1938 and undertook the shared project of creating a school for children with special needs. These founders were born between 1902 and 1916; all but the Königs were tightly grouped between 1910 and 1916. The second generation, which I refer to as “those who came,” includes children who enrolled in the early Camphill schools and coworkers, some only slightly younger than the founders, who joined the fledgling enterprise in the 1940s and 1950s. Baby boomersconstitute a third Camphill generation of students, villagers, and coworkers. A few arrived in the late 1960s, many more in the 1970s, and others as late as the 1990s or beyond. Because this was the period of most rapid growth, baby boomers became the most sig- nificant generation in Camphill’s history—a position they still hold today. -

November/December 2011
November/December 2011 Wellsprings and the beginnings of Camphill When we were about to leave Kirkton House to enter the small estate near Aberdeen, our men were interned as a result of the drama of Dunkirk in June 1940, leaving six women to carry on and make all decisions. Our situation was precarious, and in addition our relationship to our hosts, the owners of Kirkton House, was a burdened one. We sat around a candle (there was not electricity in this house) in an upper room and tried to sort ourselves out. We had a certain amount of secu- rity in Kirkton House as our hosts supplied us with oats, potatoes and milk; and three of us were for remaining, yet the other three found the situation repressive and wanted to move and to risk going to the new place. This seems to have nothing to do with wellsprings, yet in a subtle way, it did. It was clear that nei- ther three wanted to prevail over the other three. Reason and risk were extremes. So we sat on until we had divested ourselves of all anxieties, reasons, cautions, frus- trations, and were completely at peace. It was then, as though out of the future, that a voice seemed to say: ‘Go into the future—go to Camphill.’ I say this because I very often have the impression that our wellsprings come out of the future, that we are pulled on by the future in a kind of spiritual suction which draws us up and on. From The Wellsprings of Camphill, Anke Weihs, Sylvia-koti, Finland, Blowing a gale, Alexey von Jawlensky, 1916 25 April 1987 Hans Schauder: in celebration of his birth ohn Baum writes: J On November 22 this year it will be a hundred years since Hans Schauder was born. -

Tidsskrift for Camphill-Landsbyene I Norge Nr
Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 8 • VÅREN/SOMMEREN 2006 Leder Landsbyliv Landsbyimpulsen 40 år i Norge er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill – Når vi mennesker runder førti, er det en anledning til et tilbakeblikk: landsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være Hva har jeg opplevd? Hva har jeg gjennomgått? Hva har jeg opp- ”et vindu i verden” for interne og eksterne nådd? Hva har jeg lært? Har jeg holdt meg til mine målsetninger og aktører. Det skal berike miljø, kommuni- idealer? Hvordan går livet videre? Er jeg virkelig blitt det mennesket kasjon og livskvalitet. Landsbyliv kommer jeg ville bli? For noen kan dette føre inn i en 40 års krise. ut fire ganger i året. Redaksjonsgruppen består av: Camphill Landsbystiftelse er også et eget, levende vesen. Vi er noe Jan Bang (ansv. for denne utg.) mer enn en tilfeldig samling av individer. Hvis vi i Camphill landsby- Dag Balavoine ene i Norge stiller oss disse viktige spørsmålene, vil vi da våkne opp Nils Langeland Richard Monsen til at vi egentlig befinner oss i en 40 års krise? Og i tilfelle, hvordan håndterer vi den? Har vi oppnådd å bli den impulsen vi har arbeidet Landsbystiftelsen består av: og levd for? Moses vandret i ørkenen med sitt folk i 40 år før de • Vidaråsen, 3158 Andebu kom til ”det lovede land”. Hva er i så tilfelle Camphill landsbyenes Tel: 33 44 41 00 • Jøssåsen, 7550 Hommelvik lovede land? Eller har det bare vært en ørkenvandring i 40 år? Tel: 73 97 12 22 • Vallersund, 7167 Vallersund Denne utgaven av Landsbyliv gir noen personlige tilbakeblikk, erin- Tel: 72 52 70 80 dringer fra den første helgen på Vidaråsen, da fire mennesker sov • Hogganvik, 5583 Vikedal på gulvet i et forfallent hus, de første dagene på Hogganvik og hvor- Tel: 52 76 01 11 • Kristoffertunet, Hans Collins Vei 5 dan Vallersund begynte sitt liv ute i skjærgården. -

Introduction
Introduction A VISIT TO CAMPHILL Each year I bring students from Harvard University to a Camphill community —usually, either Camphill Village USA in Copake, New York, or Heartbeet Lifesharing in Vermont. At Camphill my students encounter a social world that is different from their own. We travel from the busy streets of Cambridge to dirt roads and mountain valleys, where our passage may be blocked by a herd of cows making their leisurely way to the milking barn. Camphill houses have a unique architectural style, with few right angles and lots of whimsical art. Each house is home to as many as a dozen people—families with children, young volunteers, elders—and the houses are interspersed with craft workshops, chapels, perfor- mance halls, and gardens. People walk easily from home to work to church to artistic performances that sometimes feature world-class performers. Meals open with sung prayers that are familiar to the Camphillers and unknown to my stu- dents. The students must learn the subtle customs of Camphill—a napkin in a ring, for example, signals the usual place of one of the house’s residents, while a napkin folded flat signals a space available for a guest. They learn, sometimes with difficulty, that they should not leap up after a meal to help wash the dishes. Every task is already assigned to someone who performs it with pleasure and pride, and the visitor’s role is to wait for someone to offer tea and conversation. My students learn that Camphill is a community suffused with intentionality: its daily rhythms keep everyone in physical and emotional balance; its gardens and farms keep humans, animals, and plants in creative contact; its economy and decision- making structures are designed to honor the integrity of every person. -

The Camphill Movement. Camphill Initiatives, Asking That This Would Be Artistically Adapted «Logo» Comes from the Greek «Logos»: in the Beginning Was Locally
CA MPHILL 80 Years of Camphill Movement 1940–2020 An Exhibition The Camphill Founders Karl König was born in Vienna in 1902. In his youth he experi- enced very strongly how humanity was suffering through the First World War and how Europe – particularly his home in the Austro- Hungarian Empire – was being destroyed. How could he offer a healing impulse? At an early age he was burning with empathy and a deep feeling of responsibility for his times. Although he was born into a Jewish family, he was always moved by the words of Christ: «What you have done to the least of my brethren, you have done unto me.» He saw the task of healing for the human being, for society and for the earth as one whole and inter- connected task. He studied medi- cine in Vienna and Mathilde (Tilla) König was then assistant 1902-1983 for Dr. Ita Weg- man in the early Tilla Maasberg arrived on the same day as Karl König in Arles- days of anthropo- heim, Switzerland in November of 1927. She was born in Gna- sophic medicine denfrei, a Herrnhut community in Silesia. She was a children‘s and curative edu- nurse and ran a home for children with special needs with her cation in Switzer- sister. She was in Arlesheim to do courses in anthroposophical land. medicine and nursing, where Karl König was to assist. In 1929 he moved to Silesia, where they married and helped found a cura- tive home in the Pilgramshain castle. Her experience in nursing, education and householding was of great benefit for the found- Dr. -

July/August 2015
July/August 2015 Day Dream, Howard Hodgekin Good government is government that teaches us to rule ourselves. Goethe Reading the Signs Above Birthday List July – August 2015 Camphill Road, Copake, New York Becoming 94 Lenie Seyfert Landgraff, Clanabogan ..............8 July the Catskills are just high enough to collect clouds and arrange them Becoming 85 Muriel Engel, Tornadee, Aberdeen .................2 July into the colors of the apocalypse shortly before the day's ending Becoming 75 which leads me towards the thought Kumar Mal, Copake Village ...........................9 July Eric Hoyland, Oaklands Park .................. 28 August that illness, disease and disasters could easily reach us from the west Becoming 70 or else, maybe, in those moments Stephanie Rasher, Lehenhof ...........................2 July Penny Cotterill, Delrow .......................... 11 August of experiencing some form of elation Almuth Schurenberg, Lehenhof .............. 31 August when everything seems to be going well and when euphoria asks for an antidote while on dull days clouds redefine the horizon Any additions or changes, the bleak loneliness of lines awakening please let Sandra Stoddard know: in the soul something akin to a melody [email protected] +44(0)1224 733415 then there are times of leaden clouded skies Cresset magazines look for a new home when the gloom breaks only towards sundown as if a window of hope has just opened up Dear Editor, since 1985 I have been caring for the Föhrenbühl library. Soon I shall turn 81. In this over the mountains - one that runs counter library there is a nearly (not quite) complete set of to all that the day has produced until then The Cresset. -
Camphill Correspondence September/October 2003
September/October 2003 CAMPHILL CORRESPONDENCE Tribute to Rev. Taco Bay on his 70th birthday Julian Sleigh, Camphill Village, South Africa Dear Taco, We are far away from each other : you and caring . You could even share our dif- in the heart of Germany and myself at the ferent approach with those who belonged southern tip of Africa . But I would like to to other streams . I remember you telling address you personally, as though we were me about a discussion on death with together and I could speak to you out of many of your Samaritan colleagues, in my heart . which you put forward the challenging We have been friends for some fifty idea that we live in order to die! years-since the early 1950s-and your . .Your term as the leader of The Chris- friendship has meant a great deal to me . flan Community began, and over the It has always had in it an element of guid- years your forces of heart and your deep ance, in spite of my being six years older: feeling for the realities of life - your love many times, in those early years at of humanity and your ability to devote Camphill in Scotland, our conversations yourself fully to the task in hand - have gave me guide-lines for a deeper connec- shaped your service . Outstanding has tion to Camphill, to anthroposophy and been your way of supporting new candi- to Christianity . In our backgrounds, our dates and leading them through the personalities and our stature we were very different threshold of the Ordination, which you have done with from each other, but just that has led over the years to full authority-exousia .