Mitteilungen DMG 3 L 2017
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mojib Latif
Curriculum Vitae Prof. Dr. Mojib Latif Born 29 September 1954 in Hamburg Married with Elisabeth Latif School 1961 - 1974 1974 Matriculation examination, Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer, Hamburg College/University 1974 - 1976 Business sciences, Hamburg University, 1976 - 1983 Meteorology, Hamburg University, 1983 Diploma in Meteorology Ph.D. 1987 Ph.D. in Oceanography, Hamburg University Habilitation 1989 Qualification as university lecturer in oceanography ('Habilitation'), Hamburg University Professional 1983 - 1985 Scholarship of the Max-Planck-Society experience at the Max-Planck-Institute für Meteorologie (MPI), Hamburg, Germany 1985 - 1988 Scientist at the MPI 1989 - 2002 Senior scientist at the MPI since 2003 Professor at the Institut für Meereskunde since 2004 Professor at the Leibniz Institute of Marine Sciences (former Institut für Meereskunde) since 2012 Professor at the Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) (former Leibniz Institute of Marine Sciences) Awards 2000 Sverdrup Gold Medal of the American Meteorological Society 2000 Max-Planck Award for public Science 2002 Fellow of the American Meteorological Society 2004 DUH-Umwelt-Medienpreis 2004: Kategorie "Lebenswerk" (der Deutschen Umwelthilfe) 2006 NORBERT GERBIER - MUMM International Award 2009 Deutsche Bank-IFM-GEOMAR Meeresforschungspreis 2012 ASLI's Choice Award is an award for the best book of 2012 in the fields of meteorology / climatology / atmospheric sciences Scientific Journals 1993-1998 Editor Monthly Weather Review 1999-2003 Editor Journal of Climate Guest Scientist From 1990 to 1994: Eight visits at Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, California, USA 1995: BMRC, Melbourne, Australia 1996: CIMAS/RSMAS, Miami, Florida, USA 1996, 1998: Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, California, USA Memberships Deutsche Meteorologische Gesellschaft(German Meteorological Society) American Meteorological Society (AMS) Akademie der Wissenschaften in Hamburg Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME since 2012 Deputy Chairman of the German Climate Consortium e.V. -

"Klimaskepsis in Germany." Climate Change Scepticism: a Transnational Ecocritical Analysis
Goodbody, Axel. "Klimaskepsis in Germany." Climate Change Scepticism: A Transnational Ecocritical Analysis. By Greg GarrardAxel GoodbodyGeorge HandleyStephanie Posthumus. London,: Bloomsbury Academic, 2019. 91–132. Bloomsbury Collections. Web. 29 Sep. 2021. <http://dx.doi.org/10.5040/9781350057050.ch-003>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 29 September 2021, 04:07 UTC. Copyright © Greg Garrard, George Handley, Axel Goodbody and Stephanie Posthumus 2019. You may share this work for non-commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. 3 Klimaskepsis in Germany Axel Goodbody Climate scepticism in Germany – surely not? Germans are proud of their country’s reputation for environmental awareness and progressive green legislation, and not without justification. Over the last thirty years, Germany has led the way in reducing pollution from industry, transport and domestic heating, promoting recycling and reducing the volume of waste, decoupling economic growth from resource consumption and carbon emissions, and generally meeting the environmental challenges associated with population growth, urbanization and industrialization. The OECD called the country a ‘laboratory for green growth’ in 2012 and praised its ‘proactive role in environmental policy within the EU and internationally’. Its energy policy in particular had ‘a beacon-like character for many other countries around the world’ (see Uekötter, ch. 1). The Green Party has governed at regional level and, in coalition with the Social Democrats, formed the federal government between 1998 and 2006. More importantly, many of its policies have been adopted by other parties since the 1980s and passed into legislation. -

Coastal Research and Climate Services 2013-2017 Status Report - Volume 2
Coastal Research and Climate Services 2013-2017 Status Report - Volume 2 HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT - CENTRE FOR MATERIALS AND COASTAL RESEARCH Research Field Earth and Environment Status Report Coastal Research and Climate Services at Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research 2013 – 2017 Volume II Helmholtz Association We contribute to solving the major and pressing problems of society, science and industry by conducting high-level research in the strategic Programs of our six research fields: Energy, Earth and Environment, Health, Aeronautics, Space and Transport, Matter,and Key Technologies. We research highly complex systems in cooperation with national and international partners using our large-scale facilities and scientific infrastructure. We are committed to shaping our shared future by combining research and technological developments with innovative applications and prevention strategies. We seek to attract and promote the best people and offer our staff a unique scientific environment and comprehensive support in all stages of their development. HZG – STATUS REPORT 2013 -2017 – Volume II Contents 1 SCIENTIFIC STAFF 5 1.1 RESEARCH UNIT 1: SYSTEM ANALYSIS AND MODELLING .................................................. 5 Prof. Dr. Corinna Schrum ................................................................................................... 5 Dr. Frauke Feser .................................................................................................................. 6 Dr. Birgit Hünicke -

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE Fei-Fei JIN Department of Meteorology, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii 96822, U.S.A. (808) 956-4645, [email protected]. Date of Birth; 4/16/61 Citizenship: USA ACADEMIC POSITIONS Professor, 7/2001—, University of Hawaii Professor, 12/2003—6/2006, Florida State University Associate Professor, 7/1997—6/2001 Assistant Professor, 2/1993—6/1997 Guest Professor, 1/1/2019—, Ocean University of China, Qingdao, China. Guest Professor, 1/1/2016—, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China. Visiting Scientist, Institute of Marine Research, Kiel, Germany, 6-7/02 Visiting Associate Professor, CCSR, University of Tokyo, 3-8/00. Guest investigator, Dept. of Physical Oceanography, WOHI, 12/99-2/00. Visiting Scientist, MPI, Hamburg, Germany, 8/11/99 Visiting Assistant Professor, Dept. of Atmos. Sciences., UCLA, 4-7/97. Assistant Research Scientist, Dept. of Atmos. Sci., UCLA, 5/90–2/93. Post-doctoral Fellow, Dept. of Atmos. Sciences., UCLA, 9/88-4/90. Post-doctoral Fellow, Dept. of Meteor., Univ. of Reading, UK., 9/ 87-8/88. Lecturer, Graduate School, Academia Sinica, PRC, 3/87-7/87. Assistant Researcher, Inst. of Atmos. Phy., Academia Sinica, PRC, 1/86-8/87. EDUCATION Ph.D., 1985, Atmospheric Dynamics, Academia Sinica, Beijing, PRC. B.S., 1982, Meteorology, Nanjing Inst. of Meteor., Nanjing, PRC. RESEARCHING EXPERIENCE a) Research activity The primary research activity has been focused on two areas: (i) understanding the dynamics of ENSO, (ii) the dynamics for climate variability and change. Research interests cover a broad range of topics on the dynamics of large-scale atmospheric and oceanic circulations and as wellclimate variability, such as dynamics of ENSO (El Niño- Southern Oscillation), of atmospheric low-frequency modes of tropics and mid-latitudes, ocean gyre circulation, atmospheric teleconnection, theories for Pacific decadal variability, dynamics of tropical climate mean state and global warming etc. -

Tropical Pacific Decadal Variability and the Subtropical-Tropical Cells
Report No. 352 Observed Nino4 SST and strength of the STCs 1.5 50 1.2 40 0.9 30 0.6 20 0.3 10 n i v l v e 0 0 S K 0.3 10 0.6 20 0.9 30 1.2 40 1.5 50 1875 1900 1925 1950 1975 2000 time (a) Tropical Pacific Decadal Variability and the Subtropical-Tropical Cells by Katja Lohmann • Mojib Latif Hamburg, March 2004 Authors Katja Lohmann Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg, Germany Mojib Latif Institut für Meereskunde Kiel, Germany Max-Planck-Institut für Meteorologie Bundesstrasse 53 D - 20146 Hamburg Germany Tel.: +49-(0)40-4 11 73-0 Fax: +49-(0)40-4 11 73-298 e-mail: <name>@dkrz.de Web: www.mpimet.mpg.de Tropical Pacific Decadal Variability and the Subtropical-Tropical Cells Katja Lohmann Max-Planck-Institut für Meteorologie Bundesstr. 53, 20146 Hamburg, Germany email: [email protected] and Mojib Latif Institut für Meereskunde Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel, Germany email: [email protected] (submitted to Journal of Climate) ISSN 0937-1060 1 Abstract We have analyzed the decadal-scale variability in the Tropical Pacific by means of observations and numerical model simulations. The two leading modes of the sea surface temperature (SST) variability in the central western Pacific are a decadal mode with a period of about 10 years and the ENSO mode with a dominant period of about four years. The SST anomaly pattern of the decadal mode is ENSO-like. The decadal mode, however, explains most variance in the western equatorial Pacific and off the equator. -
Planungsbüro Fahrrinnenanpassung
Int. Umweltrechtstag Hamburg e. V. | Kaiser-Willhelm-Straße 93 | 20355 Hamburg Hamburg International Environmental Law Conference 12th/13th September 2013 12th September National and Regional Climate Protection 8.15 AM Registration 9.00 AM Greetings Jörg Kuhbier, Chairman of the Association "IURT e.V." and Former State Senator, Hamburg Prof. Dr. Hans-Joachim Koch, University of Hamburg, FORUM - Research Centre for Environmental Law Part 1: Opening Address (09.30 – 10.30 AM) 9.30 AM National Contributions for Global Emission Reductions Statement: Prof. Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research and Christian-Albrechts-Universität Kiel, Ger- many 10.30 – 11.00 AM Coffee - Break Part 2: Current National and Regional Climate Protection Law I. Industrialised Countries (11.00 AM – 1.00 PM) Moderation: Prof. Dr. Ivo Appel, University of Hamburg, FORUM - Research Centre for Environmental Law 11.00 AM The Sleeping Giant Awakes? Statement: Prof. David M. Driesen, Syracuse University, College of Law, USA Internationaler Umweltrechtstag Hamburg e.V. Managing Committee c/o Rechtsanwalt Jörg Kuhbier Chairman: Senator a.D. Jörg Kuhbier | Vice Chairman: Martin Huber Kaiser-Willhelm-Straße 93 Tel +49 / 40 341069-0 Kersten Wagner-Cardenal | Prof. Dr. Dr. Joachim Sanden | Dr. Roda Verheyen | Prof. Dr. Ivo Appel D - 20355 Hamburg Fax +49 / 40 341069-22 Scientific Advisory Board www.hielc.org [email protected] Prof. Dr. Hans-Joachim Koch | Prof. Dr. Doris König 11.20 AM Climate Change and the Law in Japan Statement: Prof. Yukari Takamura, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Japan 11.40 PM Legal Framework for Climate Protection in the EU and Germany Statement: Dr. -
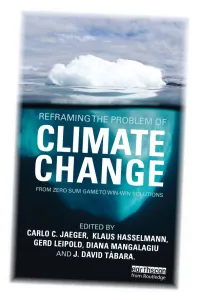
Reframing the Problem of Climate Change Reflects a Deep Belief That Dealing with 7 Climate Change Does Not Have to Be a Zero Sum Game, with Winners and Losers
1111 2 Reframing the Problem 3 4 of Climate Change 5 6 7 8 9 1011 1 2 3111 This book provides an evaluation of the science and policy debates on climate 4 change and offers a reframing of the challenges they pose, as understood by key 5 international experts and players in the field. It also gives an important and original 6 perspective on interpreting climate action and provides compelling evidence of 7 the weakness of arguments that frame climate policy as a win-or-lose situation. 8 At the same time, the book goes beyond providing yet another description 9 of climate change trends and policy processes. Its goal is to make available, in a 20111 series of in-depth reflections and insights by key international figures representing 1 science, business, finance and civil society, what is really needed to link knowledge 2 to action. Different contributions convincingly show that it is time – and possible 3 – to reframe the climate debate in a completely new light, perhaps as a system 4 transformative attractor for new green growth, sustainable development and 5 technological innovation. 6 Reframing the Problem of Climate Change reflects a deep belief that dealing with 7 climate change does not have to be a zero sum game, with winners and losers. 8 The contributors argue that our societies can learn to respond to the challenge it 9 presents and avoid both human suffering and large scale destruction of ecosystems; 30111 and that this does not necessarily require economic sacrifice. Therefore, it is vital 1 reading for students, academics and policy-makers involved in the debate 2 surrounding climate change. -

Hamburg International Environmental Law Conference 12Th/13Th September 2013
journal for european environmental & planning law 11 (2014) 71-76 brill.com/jeep Hamburg International Environmental Law Conference 12th/13th September 2013 Kerstin Gröhn / Christin Mielke 1 Opening Session Just as the First Hamburg International Environmental Law Conference in 2011, this year’s conference war organized by the private association “Internationaler Umweltrechtstag Hamburg e.V. (IURT Hamburg e.V.)” under the scientific conduct of Prof. Dr. Hans-Joachim Koch, University of Hamburg, FORUM – Research Centre for Environmental Law and Prof. Dr. Doris König, Bucerius Law School, Hamburg. The conference’s first day focused on national and regional climate protection, while the second day´s emphasis laid on marine environmental protection and world nutrition. Jutta Blankau, Secretary of Urban Development and Environment held the opening speech and welcomed the international audience to the city of Hamburg. She was followed by welcome addresses held by Jörg Kuhbier, Chairman of “IURT Hamburg e.V.” and former State Senator, Hamburg, and Prof. Dr. Hans-Joachim Koch, University of Hamburg, FORUM – Research Centre for Environmental Law. 2 The First Conference Day: National and Regional Climate Protection The first part was moderated by Professor Dr. Ivo Appel, University of Hamburg, FORUM – Research Centre for Environmental Law, who pointed out that regional and national programs have become more important since the prog- ress at international level came to a virtual standstill. He gave the floor to Professor Dr. Mojib Latif, GEOMAR -

Downloaded 09/29/21 03:33 PM UTC 3762 JOURNAL of CLIMATE VOLUME 17
1OCTOBER 2004 RODGERS ET AL. 3761 Tropical Paci®c Decadal Variability and Its Relation to Decadal Modulations of ENSO KEITH B. RODGERS Laboratoire d'OceÂanographie Dynamique et de Climatologie, Paris, France PETRA FRIEDERICHS Meteorologisches Institut, Bonn, Germany MOJIB LATIF Institut fuer Meereskunde, Kiel, Germany (Manuscript received 29 January 2003, in ®nal form 18 November 2003) ABSTRACT A 1000-yr integration of a coupled ocean±atmosphere model (ECHO-G) has been analyzed to describe decadal to multidecadal variability in equatorial Paci®c sea surface temperature (SST) and thermocline depth (Z20), and their relationship to decadal modulations of El NinÄo±Southern Oscillation (ENSO) behavior. Although the coupled model is characterized by an unrealistically regular 2-yr ENSO period, it exhibits signi®cant modulations of ENSO amplitude on decadal to multidecadal time scales. The authors' main ®nding is that the structures in SST and Z20 characteristic of tropical Paci®c decadal variability (TPDV) in the model are due to an asymmetry between the anomaly patterns associated with the model's El NinÄo and La NinÄa states, with this asymmetry re¯ecting a nonlinearity in ENSO variability. As a result, the residual (i.e., the sum) of the composite El NinÄo and La NinÄa patterns exhibits a nonzero dipole structure across the equatorial Paci®c, with positive perturbation values in the east and negative values in the west for SST and Z20. During periods when ENSO variability is strong, this difference manifests itself as a recti®ed change in the mean state. For comparison, a similar analysis was applied to a gridded SST dataset spanning the period 1871±1999. -

Curriculum Vitae
HOME PUBLICATIONS CV RESEARCH TEACHING PROGRAMS Curriculum vitae Born 1965 in Göttingen, Germany. School Theodor-Heuss-Gymnasium, Göttingen, Germany Civil Service 1984-1986, Martinsclub, Wangerooge, Germany. Voluntary work Ornithological station (Mellumrat) in Wangerooge, Germany 1986: Work in the Kibbuz Afek, Israel Since 1989: Akademie für Ost-West-Begegnungen, member of the Federal Agency for Civic Education. Since 2010 in the board of directors. Universities 1986-1992: Physics, Mathematics, Chemistry and Paedagogics at the Georg-August-University of Göttingen and Philipps University Marburg. 1988: Undergraduate degree (similar to B.S.) in Physics and Mathematics at the Philipps University of Marburg/Lahn 1989-1992: Scholarship of the ''Hoechst Foundation'' . 1990: Diploma Examinations (similar to M.S.) in Physics, University of Marburg/Lahn Scientific and Teaching Assistant in the Department for Statistical Physics and Mathematics . 1992: Diploma thesis ''Stability of stochastic dynamical systems'' (Theoretical Physics). Supervisor is Prof. W. Maaß. Ph.D. 1992 - 1995: Research associate at the Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research in Bremerhaven, Germany. Ph.D. work under the guidance of Dr. Rüdiger Gerdes, Prof. Dirk Olbers, and Prof. Deliang Chen (University of Gothenburg) . 1993: July-Oct Expedition to the Laptev Sea on Research vessel ''Polarstern'' . 1994: Visiting Scientist at the Earth Science Center, University of Gothenburg, Sweden. Scholarship of the German Academic Exchange Service ''Deutscher Akademischer Austauschdienst''. 1995: Defence at the University of Bremen, Germany. Thesis: ''Stability of the Thermohaline Circulation in analytical and numerical models''. 1996: Dr. rer. nat., similar to Doctor of Philosophy (Ph.D.) Post-doc 1996 - 2000: Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, Germany. -

Press Release Prof. Mojib Latif
22nd September 2015 “A scientist who creates knowledge and translates complex issues into accessible language” German Environmental Award 2015: Individual commendation of Prof. Mojib Latif “He captivates, he galvanizes people. He stimulates and encourages both Contact Press Office normal citizens and experts to engage with the challenges of climate change. Franz-Georg Elpers - Press Officer - He is one of the outstanding personalities in the field of climate research: a Jana Nitsch scientist who creates knowledge and translates complex issues into an Anneliese Grabara accessible language. A climate expert who provides paths to solutions as an expression of his personal concern and his personal commitment.” This is Contact DBU: how Dr. Heinrich Bottermann, Secretary General of the Deutsche An der Bornau 2 Bundesstiftung Umwelt (DBU), today announced the choice of Prof. Mojib 49090 Osnabrück Latif (60) from the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel as the Phone: 0049541|9633521 Fax: 0049541|9633198 recipient of the 2015 German Environmental Award. German President Gauck [email protected] will present him with the award in Essen on November 8. His prize money: www.dbu.de 245,000 euros. Bottermann described Latif as one of Germany's best-known climate experts, who had written numerous specialist articles and books. His publications were directed at experts and a broad target audience that included children and youth, Bottermann said, adding Latif thus showed his high scientific standards and his aspiration to write books in such a way that their contents were more easily accessible to a wide public readership. His writings perfectly complemented his public appearances as a speaker, the secretary general went on, mentioning that Latif gave lectures and children's universities and schools, as well as being a sought-after expert on various science shows and supplying scientific articles for numerous printed media outlets. -

North Atlantic Oscillation Response to Anomalous Indian Ocean SST in a Coupled GCM
5382 JOURNAL OF CLIMATE VOLUME 18 North Atlantic Oscillation Response to Anomalous Indian Ocean SST in a Coupled GCM JÜRGEN BADER Institute of Geophysics and Meteorology, University of Cologne, Cologne, and Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany MOJIB LATIF Leibniz-Institute for Marine Sciences, University of Kiel, Kiel, Germany (Manuscript received 23 November 2004, in final form 4 April 2005) ABSTRACT The dominant pattern of atmospheric variability in the North Atlantic sector is the North Atlantic Oscillation (NAO). Since the 1970s the NAO has been well characterized by a trend toward its positive phase. Recent atmospheric general circulation model studies have linked this trend to a progressive warm- ing of the Indian Ocean. Unfortunately, a clear mechanism responsible for the change of the NAO could not be given. This study provides further details of the NAO response to Indian Ocean sea surface temperature (SST) anomalies. This is done by conducting experiments with a coupled ocean–atmosphere general circulation model (OAGCM). The authors develop a hypothesis of how the Indian Ocean impacts the NAO. 1. Introduction changes in the ocean that feed back on the atmosphere. In atmospheric general circulation model (AGCM) ex- The North Atlantic Oscillation (NAO) is a large- periments, Rodwell et al. (1999) and Latif et al. (2000) scale alternation of atmospheric mass with centers of found an oceanic control of decadal North Atlantic sea action near the Icelandic low and the Azorian high. It is level pressure variability in winter. Using atmospheric the dominant pattern of atmospheric variability in the general circulation models Hoerling et al.