Bachelorarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Samsung Gear 2 Product Specifications
Samsung Gear 2 Product Specifications: Display 1.63” Super AMOLED (320 x 320) AP 1.0 GHz Dual Core Processor OS Tizen based wearable platform Gear 2 : 2.0 Megapixel Auto Focus (1920x1080, 1080x1080, 1280x960) Camera Gear 2 Neo : N/A Codec: H.264(AVC), H.263 Video Format: 3GP, MP4 HD(720p, @30fps) Playback & Recording Codec: MP3/AAC/ AAC+/eAAC+ Audio Format: MP3, M4A, AAC, OGG Camera Auto Focus Camera, Sound & Shot, Location Tags, Signature Features Fitness Features: 1. Heart Rate sensor 2. Pedometer 3. Exercise Standalone Modes: Running, Walking Companion Modes: Cycling, Hiking 4. Sleep Music Player with Bluetooth® Headset and Speaker WatchON Remote: Remote Controller via IrLED Sensor Additional Basic Features: Features - Bluetooth Call, Camera, Notification(SMS, E-mail, Apps), Voice Memo, Contact, Find My Device, Gallery, Logs, Media Controller, Schedule, Smart Relay, S Voice, Stopwatch, Timer, Weather More Features(Downloadable): - Calculator, ChatON, Flashlight, Quick Settings Changeable Strap Color Options: - Gear 2 : Charcoal Black, Gold Brown and Wild Orange - Gear 2 Neo : Charcoal Black, Mocha Grey and Wild Orange IP67 Dust and Water Resistant, Noise Cancellation Samsung Services Samsung Apps Connectivity Bluetooth® v4.0 LE, IrLED Sensor Accelerometer, Gyroscope, Heart Rate RAM: 512MB Memory Storage: 4GB Internal Memory Gear 2 : 36.9 x 58.4x 10.0 mm, 68g Dimension Gear 2 Neo : 37.9 x 58.8 x 10.0mm, 55g Standard Battery, Li-ion 300mAh Battery Typical Usage 2~3 days, Low Usage up to 6 days About Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd. is a global leader in technology, opening new possibilities for people everywhere. -

Presentación De Powerpoint
Sergio Foncillas García Sales Manager Hospitality Agenda . Experiencia Mobility Hotel Samsung . Mercado Wearables . Características Wearables Samsung . Gear Fit . Gear 2 Neo / Gear . Aplicaciones actuales . Aplicaciones en desarrollo . Futuro wearables Samsung . Talent Program Gear 2 . Prueba de producto Experiencia Mobility Samsung Hotel https://www.youtube.com/watch?v=QmBHRLzJNXY La ‘Wearable Technology’ –o “tecnología para llevar puesta”- busca la integración y adaptación de la tecnología más avanzada a dispositivos que puedan llevarse encima de una manera cómoda. Se trata de gafas, relojes, anillos y pulseras que representan el futuro tecnológico y que, según las previsiones, tendrán un valor de mercado en el año 2018 superior a los 12.000 millones de dólares. Fuente: 1st Wearable Technology Conference Wearables Samsung Mide pulsaciones Aviso de llamadas, mensajes, emails… Conectado por Bluetooth a tu smartphone Samsung Fotografías (Gear 2) Resistente al agua y polvo (IP67) Llamadas de teléfono Aplicación S Health Podómetro, ejercicio, sueño, cuenta atrás, cronómetro, buscar dispositivo… Mando a distancia Sistema operativo Tizen Tarjeta de Embarque . Ejercicio . Nivel de stress . Sueño . SIMBAND: sensores modulares . Nueva plataforma de software . Presión arterial . Respiración . Frecuencia cardíaca . Nivel de hidratación … Aplicaciones en desarrollo Presente Geolocalización Realidad aumentada Códigos QR Acceso a parques temáticos, resorts… … Futuro Tarjeta SIM/MicroSIM incorporada NFC … Madrid, Abril de 2014 – Anunciamos una nueva edición de nuestro Talent Program, un concurso para desarrolladores con el objetivo de fortalecer el mercado de aplicaciones para wearables, como complemento de la iniciativa internacional “Samsung Gear App Challenge”. Mediante esta iniciativa, en Samsung queremos animar a los desarrolladores de aplicaciones a trabajar en proyectos para enriquecer las posibilidades de los dispositivos wearables como Samsung Gear 2 a través del SDK específico de Tizen. -

Samsung Gear 2 Pro Instructions the Gear Fit2 Pro Is Referred to As the Gear in This Manual
Samsung Gear 2 Pro Instructions The Gear Fit2 Pro is referred to as the Gear in this manual. • The items supplied 2 On another mobile device, launch Samsung Gear to connect to your Gear. 2. Tap Gear connection _ Remote connection. Note: You must connect the Gear to Wi-Fi and sign in to your Samsung account on the smartphone to enable. This app displays Google Navigation instructions on your Samsung Gear Fit2 smartwatch. It automatically installs the companion app on your Gear Fit2. To get Swim.com on your Samsung Gear Fit2 Pro or Galaxy Fit, you'll the watch for 2 seconds until the lock has been confirmed as disabled. Samsung Gear 2 Pro Instructions Click Here --> Refer user manual for troubleshooting instructions. Not all Samsung Gear Fit 2 Pro SM-R365 Smart Fitness Band (SM-R365NZKAXAR) Liquid Black - Large. No information is available for this page.Learn why Manuals and User Guides for Samsung Gear Fit2 Pro. We have 2 Samsung Gear Fit2 Pro manuals available for free PDF download: User Manual, Quick Start. Buy Samsung Gear Fit 2 Pro Fitness Tracker - UK Version - Black at Amazon UK. So when you are out on a cycle the watch does not give you directions. This is the Instruction manual for the Argos Product SAMSUNG GEAR FIT 2 PRO SMARTWATCH (759/6706) in PDF format. Product support is also available. your Gear Fit2 Pro to find manuals, specs, features, and FAQs. You can also register your product to gain access to Samsung's world-class customer support. From the Apps screen of the smartphone, tap Samsung Gear. -

Electronic 3D Models Catalogue (On July 26, 2019)
Electronic 3D models Catalogue (on July 26, 2019) Acer 001 Acer Iconia Tab A510 002 Acer Liquid Z5 003 Acer Liquid S2 Red 004 Acer Liquid S2 Black 005 Acer Iconia Tab A3 White 006 Acer Iconia Tab A1-810 White 007 Acer Iconia W4 008 Acer Liquid E3 Black 009 Acer Liquid E3 Silver 010 Acer Iconia B1-720 Iron Gray 011 Acer Iconia B1-720 Red 012 Acer Iconia B1-720 White 013 Acer Liquid Z3 Rock Black 014 Acer Liquid Z3 Classic White 015 Acer Iconia One 7 B1-730 Black 016 Acer Iconia One 7 B1-730 Red 017 Acer Iconia One 7 B1-730 Yellow 018 Acer Iconia One 7 B1-730 Green 019 Acer Iconia One 7 B1-730 Pink 020 Acer Iconia One 7 B1-730 Orange 021 Acer Iconia One 7 B1-730 Purple 022 Acer Iconia One 7 B1-730 White 023 Acer Iconia One 7 B1-730 Blue 024 Acer Iconia One 7 B1-730 Cyan 025 Acer Aspire Switch 10 026 Acer Iconia Tab A1-810 Red 027 Acer Iconia Tab A1-810 Black 028 Acer Iconia A1-830 White 029 Acer Liquid Z4 White 030 Acer Liquid Z4 Black 031 Acer Liquid Z200 Essential White 032 Acer Liquid Z200 Titanium Black 033 Acer Liquid Z200 Fragrant Pink 034 Acer Liquid Z200 Sky Blue 035 Acer Liquid Z200 Sunshine Yellow 036 Acer Liquid Jade Black 037 Acer Liquid Jade Green 038 Acer Liquid Jade White 039 Acer Liquid Z500 Sandy Silver 040 Acer Liquid Z500 Aquamarine Green 041 Acer Liquid Z500 Titanium Black 042 Acer Iconia Tab 7 (A1-713) 043 Acer Iconia Tab 7 (A1-713HD) 044 Acer Liquid E700 Burgundy Red 045 Acer Liquid E700 Titan Black 046 Acer Iconia Tab 8 047 Acer Liquid X1 Graphite Black 048 Acer Liquid X1 Wine Red 049 Acer Iconia Tab 8 W 050 Acer -
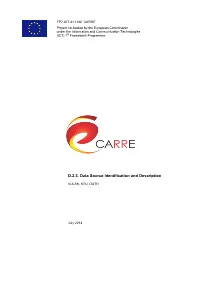
D.2.3 Update #1
FP7-ICT-611140 CARRE Project co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technologies th (ICT) 7 Framework Programme D.2.3. Data Source Identification and Description VULSK, KTU, DUTH July 2014 D.2.3: Data Source Identification & Description CARRE Contacts Project Coordinator: Eleni Kaldoudi [email protected] Project Manager: George Drosatos [email protected] DUTH Eleni Kaldoudi [email protected] Democritus University of Thrace OU John Domingue [email protected] The Open University BED: Enjie Liu [email protected] Bedfordshire University VULSK: Domantas Stundys [email protected] Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos KTU Arūnas Lukoševičius [email protected] Kaunas University of Technology PIAP Industrial Research Institute for Automation Roman Szewczyk [email protected] & Measurements Disclaimer This document contains description of the CARRE project findings, work and products. The authors of this document have taken any available measure in order for its content to be accurate, consistent and lawful. However, neither the project consortium as a whole nor the individual partners that implicitly or explicitly participated in the creation and publication of this document hold any sort of responsibility that might occur as a result of using its content. In case you believe that this document harms in any way IPR held by you as a person or as a representative of an entity, please do notify us immediately. The content of this publication is the sole responsibility of CARRE consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. CARRE is a Specific Targeted Research Project partially funded by the European Union, under FP7-ICT-2013-10, Theme 5.1. -

Digital Forensic Analysis of Smart Watches
TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Information Technologies Kehinde Omotola Adebayo (174449IVSB) DIGITAL FORENSIC ANALYSIS OF SMART WATCHES Bachelor’s Thesis Supervisor: Hayretdin Bahsi Research Professor Tallinn 2020 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Kehinde Omotola Adebayo (174449IVSB) NUTIKELLADE DIGITAALKRIMINALISTIKA Bachelor’s Thesis Juhendaja: Hayretdin Bahsi Research Professor Tallinn 2020 Author’s declaration of originality I hereby certify that I am the sole author of this thesis. All the used materials, references to the literature and the work of others have been referred to. This thesis has not been presented for examination anywhere else. Author: Kehinde Omotola Adebayo 30.04.2020 3 Abstract As wearable technology is becoming increasingly popular amongst consumers and projected to continue to increase in popularity they become probable significant source of digital evidence. One category of wearable technology is smart watches and they provide capabilities to receive instant messaging, SMS, email notifications, answering of calls, internet browsing, fitness tracking etc. which can be a great source of digital artefacts. The aim of this thesis is to analyze Samsung Gear S3 Frontier and Fitbit Versa Smartwatches, after which we present findings alongside the limitations encountered. Our result shows that we can recover significant artefacts from the Samsung Gear S3 Frontier, also more data can be recovered from Samsung Gear S3 Frontier than the accompanying mobile phone. We recovered significant data that can serve as digital evidence, we also provided a mapping that would enable investigators and forensic examiners work faster as they are shown where to look for information in the course of an investigation. We also presented the result of investigating Fitbit Versa significant artefacts like Heart rate, sleep, exercise and personal data like age, weight and height of the user of the device, this shows this device contains artefacts that might prove useful for forensic investigators and examiners. -

Planning Budget Target Data Creative Production Post Smart Ways To
WWW.BINFO.CO.UK ISSUE119 THE WORKPLACE & TECHNOLOGY MAGAZINE FOR SMES ING B ANN UDG PL ET WOW T A R G E T T D S A T O A P N O I C T R C E U A D T O I V R E INVOICE P REMITTANCE SMS SMART WAYS TO MANAGE MULTI-CHANNEL COMMUNICATIONS Cloud Storage • Flexible Working • Dictation • Employment Law ING B ANN UDG PL ET WOW T A R G E T T D S A T DOCUMENT PREP CAN O A P N O I C T R C E U A D T O I V R E INVOICE P REMITTANCE DRAIN SMS YOUR SMART WAYS TO MANAGE PROFITS… MULTI-CHANNEL COMMUNICATIONS DOCUMENT MAIL MATERIAL SCANNING AUTOMATION HANDLING Introducing the Universal Document Capture Workstation that provides a real ROI: Document prep is the largest single expense in any mail room or document scanning operation. Falcon eliminates this unnecessary expense by combining labour-intensive processes into a seamless One-Touch platform. OPEX WORLD HEADQUARTERS OPEX FRANCE OPEX GERMANY OPEX UNITED KINGDOM WWW.OPEX.COM 17351_OPEX_DrainUK-FullPgAd_305x218mm_wBleeds.indd 1 9/23/14 11:56 AM ING B ANN UDG PL ET WOW T A R G E T FOR THE LATEST INDUSTRY NEWS VISIT: WWW.BINFO.CO.UK Editor: James Goulding 0780 308 7228 · [email protected] Business Info is a controlled circulation magazine. Applications for free copies T Advertising Director: Ethan White 01732 759725 · [email protected] will be considered upon receipt of a completed and signed readerD info card S or online form. -

EASE UNLIMITED Die Reduktion Von Komplexität
Ausgabe 3 EASE UNLIMITED Die Reduktion von Komplexität CONNECTED CARS Das Auto der Zukunft denkt mit 1:0 FÜR DIE IT Allianz Arena geht vernetzt in die Zukunft EXPERTENINTERVIEW MANFRED DANGELMAIER (FRAUNHOFER-INSTITUT) Virtuelle Realität statt Prototypen 02 || 03 Editorial und Inhalt 02| 0303| EDITORIAL INHALT In Kürze Eintauchen Welten Liebe Leserinnen und Leser, 04 Branchen-News 18 Titelstory: Ease Unlimited 30 Einfach digital wie viele E-Mails, Chat-Nachrichten, Mit der Economy Class ins All? | Big Data | E-Books Die Reduktion von Komplexität Transformation zum smarten Unternehmen Posts, Newsfeed-Updates und Tweets auf dem Vormarsch | Luxus-Toaster | Mit SSD auf gehen wohl gerade bei Ihnen ein, der Datenwelle reiten | BYOD: effizientes Arbeiten während Sie sich in die Lektüre des | Internet der Dinge | Crowdfunding-Welle | Jedes Samsung Business Life Magazins 6. Unternehmen „offline“ vertiefen? Sicher einige, denn die Digitalisierung der Arbeitswelt führt immer mehr dazu, dass wir rund Erfahren um die Uhr mit Informationen versorgt werden. In dieser Ausgabe finden Sie zahlreiche Tipps, Expertenkommentare und Fachbeiträge, 06 Wow oder Wau? die verraten, wie intelligente Technologien uns dabei unterstützen, Komplexe IT spielerisch begreifen 36 IT-Lösungen, die das die zunehmende Komplexität und Vielfalt in Arbeits- und Privatleben Arbeitsleben vereinfachen positiv zu nutzen. 07 1:0 für die IT Allianz Arena geht vernetzt in die Zukunft Der Schlüssel zu einer produktiven Arbeitsweise und effizienten Prozessen ist die Reduktion von Komplexität, erklärt Autor und 10 Auto mobil Coach Helgo Bretschneider in der Titelgeschichte. Die Trend- forscher der Agentur TrendOne haben hierfür den Begriff „Ease Unlimited“ geprägt. Doch gerade in der IT ist Vereinfachung nicht immer möglich. -

Lian Li PC-Q16: Эффективная Миниатюризация MSI
#10 (666) 2014 Еженедельный компьютерный журнал LianLian LiLi PC-Q16:PC-Q16: эффективнаяэффективная миниатюризацияминиатюризация MSIMSI GT70GT70 2PE:2PE: десктопыдесктопы нене уу делдел JBLJBL FLIPFLIP II:II: бубнилкабубнилка вв трубочкетрубочке SteelSeriesSteelSeries Rival:Rival: современнаясовременная классикаклассика 1 UPGRADE / содержание № 10 (666) 2014 http://upweek.ru Editorial .........................................................................................3 Новости ........................................................................................6 Портативная колонка JBL FLIP II .....................................11 Мышь SteelSeries Rival ..........................................................15 Наушники JBL J88i ..................................................................18 Корпус Lian Li PC-Q16 ...........................................................22 Ноутбук MSI GT70 2PE Dominator Pro ..........................26 Сканер Xerox Travel Scanner 100 .....................................34 USB Wi-Fi адаптер Netis WF-2116 ...................................37 Будильник SleepBot: как переспать с андроидом ..............................................40 Удалить! Да, я уверен! ..........................................................47 Стартовые страницы для Chrome в стиле Metro ..................................................53 2 UPGRADE / edit / содержание № 10 (666) 2014 http://upweek.ru Мы сами удивились!!! (Лучшего названия для этого текста придумать нельзя. – Прим. редакции.) Где-то месяц назад -

Ditio: Trustworthy Auditing of Sensor Activities in Mobile & Iot Devices
Ditio: Trustworthy Auditing of Sensor Activities in Mobile & IoT Devices Saeed Mirzamohammadi, Justin A. Chen, Ardalan Amiri Sani, Sharad Mehrotra, Gene Tsudik Department of Computer Science University of California, Irvine [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] ABSTRACT in Mobile & IoT Devices. In Proceedings of SenSys ’17, Delft, Netherlands, Mobile and Internet-of-Things (IoT) devices, such as smartphones, November 6–8, 2017, 14 pages. tablets, wearables, smart home assistants (e.g., Google Home and https://doi.org/10.1145/3131672.3131688 Amazon Echo), and wall-mounted cameras, come equipped with various sensors, notably camera and microphone. These sensors 1 INTRODUCTION can capture extremely sensitive and private information. There Mobile and Internet-of-Things (IoT) devices, such as smartphones, are several important scenarios where, for privacy reasons, a user tablets, wearables, voice-activated smart home assistants (e.g., Google might require assurance about the use (or non-use) of these sensors. Home and Amazon Echo), and wall-mounted cameras, incorporate For example, the owner of a home assistant might require assur- various sensors, notably cameras and microphones. These sensors ance that the microphone on the device is not used during a given can capture extremely sensitive and private information, such as time of the day. Similarly, during a confidential meeting, the host video and audio. There are increasingly important scenarios, where needs assurance that attendees do not record any audio or video. it is essential for these devices to provide assurance about the use Currently, there are no means to attain such assurance in modern (or non-use) of these sensors to their owners or even to a third party. -

(1) BCS Lower School Electronic Device Policy 2021
July 2021 Dear Parents of BCS Lower School Students, We want to remind you of our cell phone and electronic device policy found in our Lower School Handbook. This policy states: Cell phones and other electronic communication devices must be powered off and stored in the student’s book bag during school hours. The use of these devices is prohibited during school hours. The use of these devices is prohibited during school hours, which include dismissal and carpool, after school care and study hall, and BCS shuttle transportation. We want to clarify that this policy states and includes the statement “ other electronic communication devices”. Here are some examples of personal ELECTRONIC DEVICES that are NOT allowed to be used or “ powered on” during school hours: Gaming devices, iPods, iPads, tablets, Smart watches (i.e.: Apple’s iWatch, Moto 360, Samsung Gear 2, Gizmos, VTech, watches and all other smart watch brands with Internet access), MP3 players, Game Boys, Nooks, Kindles, cameras, recorders or other electronic devices. This includes any device that allows for email, messaging, photography, videoing or texting. (This does not include devices such as cell phones that are used to monitor severe health issues. Medical devices of this nature must be approved by school administrators on a case by case basis. This also does not include devices that we will use at school or for remote learning. Rules and regulations will be forthcoming regarding school issues devices.) Please note that students may not wear any type of “Smart Watch” even if the cell phone or other device that “powers” the watch is turned off. -
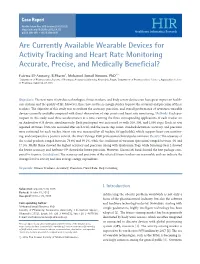
Are Currently Available Wearable Devices for Activity Tracking and Heart Rate Monitoring Accurate, Precise, and Medically Beneficial?
Case Report Healthc Inform Res. 2015 October;21(4):315-320. http://dx.doi.org/10.4258/hir.2015.21.4.315 pISSN 2093-3681 • eISSN 2093-369X Are Currently Available Wearable Devices for Activity Tracking and Heart Rate Monitoring Accurate, Precise, and Medically Beneficial? Fatema El-Amrawy, B.Pharm1, Mohamed Ismail Nounou, PhD1,2 1Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Alexandria University, Alexandria, Egypt; 2Department of Pharmaceutical Sciences, Appalachian College of Pharmacy, Oakwood, VA, USA Objectives: The new wave of wireless technologies, fitness trackers, and body sensor devices can have great impact on health- care systems and the quality of life. However, there have not been enough studies to prove the accuracy and precision of these trackers. The objective of this study was to evaluate the accuracy, precision, and overall performance of seventeen wearable devices currently available compared with direct observation of step counts and heart rate monitoring. Methods: Each par- ticipant in this study used three accelerometers at a time, running the three corresponding applications of each tracker on an Android or iOS device simultaneously. Each participant was instructed to walk 200, 500, and 1,000 steps. Each set was repeated 40 times. Data was recorded after each trial, and the mean step count, standard deviation, accuracy, and precision were estimated for each tracker. Heart rate was measured by all trackers (if applicable), which support heart rate monitor- ing, and compared to a positive control, the Onyx Vantage 9590 professional clinical pulse oximeter. Results: The accuracy of the tested products ranged between 79.8% and 99.1%, while the coefficient of variation (precision) ranged between 4% and 17.5%.