Stefan Riese Astronaut R. Buckminster Fuller
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bucky Fuller & Spaceship Earth
Ivorypress Art + Books presents BUCKY FULLER & SPACESHIP EARTH © RIBA Library Photographs Collection BIOGRAPHY OF RICHARD BUCKMINSTER FULLER Born in 1895 into a distinguished family of Massachusetts, which included his great aunt Margaret Fuller, a feminist and writer linked with the transcendentalist circles of Emerson and Thoreau, Richard Buckminster Fuller Jr left Harvard University, where all the Fuller men had studied since 1740, to become an autodidact and get by doing odd jobs. After marrying Anne Hewlett and serving in the Navy during World War I, he worked for his architect father-in-law at a company that manufactured reinforced bricks. The company went under in 1927, and Fuller set out on a year of isolation and solitude, during which time he nurtured many of his ideas—such as four-dimensional thinking (including time), which he dubbed ‘4D’—and the search for maximum human benefit with minimum use of energy and materials using design. He also pondered inventing light, portable towers that could be moved with airships anywhere on the planet, which he was already beginning to refer to as ‘Spaceship Earth’. Dymaxion Universe Prefabrication and the pursuit of lightness through cables were the main characteristics of 4D towers, just like the module of which they were made, a dwelling supported by a central mast whose model was presented as a single- family house and was displayed in 1929 at the Marshall Field’s department store in Chicago and called ‘Dymaxion House’. The name was coined by the store’s public relations team by joining the words that most often appeared in Fuller’s eloquent explanations: dynamics, maximum, and tension, and which the visionary designer would later use for other inventions like the car, also called Dymaxion. -

Buckminster Fuller’S Dymaxion Car
Darienite News for Darien https://darienite.com Buckminster Fuller's Dymaxion Car, Produced in Bridgeport in the 1930s: Cameron on Transportation Author : David Gurliacci Categories : Opinion, Transportation Tagged as : Buckminster Fuller, Cameron on Transportation, Cameron on Transportation 2019, Cameron on Transportation History, Cameron on Transportation History 2019, Dymaxion Car, Jim Cameron's Transportation Column, Jim Cameron's Transportation Column 2020 Date : December 26, 2019 Did you know that Bridgeport was once the home of “the car of the future?” It was the Tesla of its era, but only three were ever built. This mystery vehicle? The Dymaxion Car. The designer? Buckminster Fuller. Best known for pioneering the 1940s architectural design of the geodesic dome, Fuller was already inventing other things a decade earlier. It was the 1930s and the country was struggling through the Depression. Fuller saw the need for innovation, for “doing more with less,” and conceived of a mass-produced, pre-fabricated 1 / 4 Darienite News for Darien https://darienite.com circular house modeled after a grain silo. Built with aluminum, Fuller only saw two prototypes of the dwelling constructed, and even they weren’t actually built until 1945. Fuller called his design The Dymaxion House — Dy for dynamic, Max for maximum and Ion for tension. It was a major flop. Next, Fuller moved on to transportation, conceiving of the Dymaxion Car, an 11-person, three-wheeled vehicle that he hoped could fly using what he called “jet stilts.” And this was decades before the invention of the jet engine. Indeed, the Dymaxion Car looked a lot like a stubby zeppelin with a forward-facing cockpit and tapered, aerodynamic tail. -
Brochure Exhibition Texts
BROCHURE EXHIBITION TEXTS “TO CHANGE SOMETHING, BUILD A NEW MODEL THAT MAKES THE EXISTING MODEL OBSOLETE” Radical Curiosity. In the Orbit of Buckminster Fuller September 16, 2020 - March 14, 2021 COVER Buckminster Fuller in his class at Black Mountain College, summer of 1948. Courtesy The Estate of Hazel Larsen Archer / Black Mountain College Museum + Arts Center. RADICAL CURIOSITY. IN THE ORBIT OF BUCKMINSTER FULLER IN THE ORBIT OF BUCKMINSTER RADICAL CURIOSITY. Hazel Larsen Archer. “Radical Curiosity. In the Orbit of Buckminster Fuller” is a journey through the universe of an unclassifiable investigator and visionary who, throughout the 20th century, foresaw the major crises of the 21st century. Creator of a fascinating body of work, which crossed fields such as architecture, engineering, metaphysics, mathematics and education, Richard Buckminster Fuller (Milton, 1895 - Los Angeles, 1983) plotted a new approach to combine design and science with the revolutionary potential to change the world. Buckminster Fuller with the Dymaxion Car and the Fly´s Eye Dome, at his 85th birthday in Aspen, 1980 © Roger White Stoller The exhibition peeps into Fuller’s kaleidoscope from the global state of emergency of year 2020, a time of upheaval and uncertainty that sees us subject to multiple systemic crises – inequality, massive urbanisation, extreme geopolitical tension, ecological crisis – in which Fuller worked tirelessly. By presenting this exhibition in the midst of a pandemic, the collective perspective on the context is consequently sharpened and we can therefore approach Fuller’s ideas from the core of a collapsing system with the conviction that it must be transformed. In order to break down the barriers between the different fields of knowledge and creation, Buckminster Fuller defined himself as a “Comprehensive Anticipatory Design Scientist,” a scientific designer (and vice versa) able to formulate solutions based on his comprehensive knowledge of universe. -

The Best Way to Predict the Future Is to Design It Exploration in Future Possibilities from an Industrial Design Perspective
The best way to predict the future is to design it Exploration in future possibilities from an Industrial Design perspective Alexander Jayko Fossland Department of Product Design Norwegian University of Science and Technology ABSTRACT The main problem discussed is what one should design towards in general terms and what rationale can back up designing in general. The article is aimed at professional designers and students of design looking to broaden their philosophical basis for design practice. R. Buckminster Fuller’s literature is assessed. Critical questions are raised about the industrial design profession, constructive and destructive abilities are discovered. Through Fuller’s perspectives, open source, open design, digital fabrication and the blockchain are found to be potential remedies for humanity’s shortcomings in sustainably operating Spaceship Earth. KEYWORDS: R. Buckminster Fuller, Industrial Design, Total human success, Spaceship Earth, Ephemeralization, Real Wealth, Open Source, Open Design, the Blockchain, Digital Fabrication. 1. INTRODUCTION consideration, in addition the analyses of digital fabrication, open source, open design and This article discusses perspectives, principles and blockchain technology is assessed through implications of R. Buckminster Fuller´s philosophy published articles. in the light of modern industrial design. It tries to establish a consensus about what we should 1.1 Origins design towards, and what a designer’s responsibility and contributions could be. Finally In exploring the role of industrial designers, a it looks at concepts in contemporary technology preliminary understanding of the origins of the relevant to Fullers visions and ideas. Industrial Design profession is required. The question of whether Industrial Designers are true This article reviews literature from the following advocates for innovation or profit-driven stylists texts by R. -

Links Away the Institution’S Forward to the Present Day
Gain perspective. Get inspired. Make history. THE HENRY FORD MAGAZINE - JUNE-DECEMBER 2019 | SPACESUIT DESIGN | UTOPIAN COMMUNITIES | CYBERFORMANCE | INSIDE THE HENRY FORD THE HENRY | INSIDE COMMUNITIES | CYBERFORMANCE DESIGN | UTOPIAN | SPACESUIT 2019 - JUNE-DECEMBER MAGAZINE FORD THE HENRY MAGAZINE JUNE-DECEMBER 2019 THE PUSHING BOUNDARIES ISSUE What’s the unexpected human story behind outerwear for outer space? UTOPIAN PAGE 28 OUTPOSTS OF THE ‘60S, ‘70S THE WOMEN BEHIND THEATER PERFORMED VIA DESKTOP THE HENRY FORD 90TH ANNIVERSARY ARTIFACT TIMELINE Gain perspective. Get inspired. Make history. THE HENRY FORD MAGAZINE - JUNE-DECEMBER 2019 | SPACESUIT DESIGN | UTOPIAN COMMUNITIES | CYBERFORMANCE | INSIDE THE HENRY FORD THE HENRY | INSIDE COMMUNITIES | CYBERFORMANCE DESIGN | UTOPIAN | SPACESUIT 2019 - JUNE-DECEMBER MAGAZINE FORD THE HENRY MAGAZINE JUNE-DECEMBER 2019 THE PUSHING BOUNDARIES ISSUE What’s the unexpected human story behind outerwear for outer space? UTOPIAN PAGE 28 OUTPOSTS OF THE ‘60S, ‘70S THE WOMEN BEHIND THEATER PERFORMED VIA DESKTOP THE HENRY FORD 90TH ANNIVERSARY ARTIFACT TIMELINE HARRISBURG PA HARRISBURG PERMIT NO. 81 NO. PERMIT PAID U.S. POSTAGE U.S. PRSRTD STD PRSRTD ORGANIZATION ORGANIZATION NONPROFIT NONPROFIT WHEN IT’S TIME TO SERVE, WE’RE ALL SYSTEMS GO. Official Airline of The Henry Ford. What would you like the power to do? At Bank of America we are here to serve, and listening to how people answer this question is how we learn what matters most to them, so we can help them achieve their goals. We had one of our best years ever in 2018: strong recognition for customer service in every category, the highest levels of customer satisfaction and record financial results that allow us to keep investing in how we serve you. -

Buckminster Fuller's Critical Path
The Oil Drum: Australia/New Zealand | Buckminster Fuller\'s Critical Path http://anz.theoildrum.com/node/5113 Buckminster Fuller's Critical Path Posted by Big Gav on February 16, 2009 - 5:57am in The Oil Drum: Australia/New Zealand Topic: Environment/Sustainability Tags: book review, buckminster fuller, critical path, geodesic dome, geoscope, world game [list all tags] Critical Path was the last of Buckminster Fuller's books, published shortly before his death in 1983 and summing up his lifetime of work. Buckminster "Bucky" Fuller was an American architect, author, designer, futurist, inventor and visionary who devoted his life to answering the question "Does humanity have a chance to survive lastingly and successfully on planet Earth, and if so, how?". He is frequently referred to as a genius (albeit a slightly eccentric one). During his lifelong experiment, Fuller wrote 29 books, coining terms such as "Spaceship Earth", "ephemeralization" and "synergetics". He also developed and contributed to a number of inventions inventions, the best known being the geodesic dome. Carbon molecules known as fullerenes (buckyballs) were so named due to their resemblance to geodesic spheres. Bucky was awarded the Presidential Medal of Freedom by Ronald Reagan in 1981. There is no energy crisis, only a crisis of ignorance - Buckminster Fuller Critical Path Humanity is moving ever deeper into crisis - a crisis without precedent. First, it is a crisis brought about by cosmic evolution irrevocably intent upon completely transforming omnidisintegrated humanity from a complex of around-the-world, remotely-deployed-from-one-another, differently colored, differently credoed, differently cultured, differently communicating, and differently competing entities into a completely integrated, comprehensively interconsiderate, harmonious whole. -

Buckminster Fuller and His Fabulous Designs
GENERAL ARTICLE Buckminster Fuller and his Fabulous Designs G K Ananthasuresh Richard Buckminster Fuller was an American designer who created fantastic designs. His non-conformist creative design ability was augmented with an urge to realize the prototypes not only for practical demonstration but also for widespread use. His creations called for new vocabulary such as synergy, tensegrity, Dymaxion, and the eponymous Fullerene. He had G K Ananthasuresh is a design science philosophy of his own. He thought beyond the Professor of Mechanical design of artifacts. He strived for sustainable living in the Engineering and Coordi- global world long before these concepts became important nator of the Bioengineer- ing Programme at IISc, for the world to deal with. He is described as a comprehensive Bengaluru. His principal anticipatory design scientist. In this article, only his physical area of interest is optimal design artifacts that include two of his lasting design contri- design of stiff structures butions, namely, the tensegrity structures and the geodesic and elastically deformable compliant mechanisms, domes are discussed. which have applications in product design, Good designs bring a positive change in the world and the way we microelectromechanical live. And great designs remain unchanged for decades, or even systems, biomechanics of centuries, because nothing greater came along after them. Al- living cells, and protein though everyone enjoys the benefits of good designs, the process design. This is his third article for Resonance, of design itself is not understood by many because designing is an extolling the works of intensely creative and intellectual activity. Most often, great great designs appear to be realized as a flash of an idea, a radical new engineers. -

Instructions for Buckyball
Zometool Project Series: the world’s most powerful Includes detailed instructions START HERE! (and fun!) modeling system. Kids, educators, and by Dr. Steve Yoshinaga WHAT IS A BUCKYBALL? Nobel-prize winning scientists all love Zometool: • it’s unique, brilliant, beautiful A buckyball is a spheri- made of carbon atoms, and 90 edges, the discovered buckyballs, but his name lives • all kits are compatible— more parts, more power! cal molecule made bonds between the carbons. on: a whole class of molecules related to • guaranteed for life! entirely of carbon buckyballs are now called fullerenes. “The mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions.” – Oliver Wendell Holmes atoms — the roundest and (some say) most Fullerenes beautiful of all known BUCKYBALLS! Hailed as a breakthrough, molecules. Scientists believe it may be buckyballs have exciting uses in every- thing from medical research to optics, one of the most useful, too. Slicing 12 “points” truncates the icosahedron metallurgy, electronics and energy. Find out how they stimulate human It’s for kicks A buckyball has much more in common research and imagination: with a soccer ball than just looks. It spins, • Molecule of the Year in 1991! bounces against hard surfaces, and when • Lighter than plastic; stronger than steel! squeezed and released, springs back to its • How will this beautiful molecule original shape. Buckyballs are so strong, change your future? they’ve survived 15,000 mph collisions! After the C601 buckyball was discovered in Have a ball with this Wild Science 1985, scientists found more fullerenes. Discovery! Why bucky? Made entirely of carbon, they form spheres (buckyballs), ellipsoids (C70) or tubes Buckyballs were named (buckytubes, or nanotubes2), and have MADE IN USA US Patents RE after the visionary design from kid-safe materials 33,785; 6,840,699 chemical properties more similar to graphite B2. -

Autonomous Lightweight Houses: Learning from Yurts
PLEA2006 - The 23rd Conference on Passive and Low Energy Architecture, Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006 Autonomous Lightweight Houses: Learning from Yurts Katarina Mrkonjic Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spain ABSTRACT: The paper investigates the possibilities and limitations of the interpretation and interpolation of the traditional architectural principles into the contemporary architecture, in order of achieving a higher level of sustainability and autonomy. It is based on a comparison between a traditional and a twentieth century house. Yurt, traditional nomad tent from the Central Asia responds to many sustainability criteria set for a sustainable house such as natural cooling and ventilation, dematerialization, maximum volume enclosed by the minimum surface, use of innocuous materials, minimum disturbance of the terrain, use of local materials. The Dymaxion House (designed by R. B. Fuller between 1927 and 1946) bares numerous resemblances with yurts, i.e. the form, volumes/surface ratio, ventilation system, etc. On the other hand, it was designed as an entirely industrially produced artefact, implying the use of different kind of materials (mainly of them recyclable metals), etc. The traditional principles can be successfully applied in the new buildings in order to make them more energetically efficient and effective, but some adjustments are needed to be done in order to integrate them in the contemporary building processes and uses. Keywords: yurt, design principles, sustainable and autonomous house 1. INTRODUCTION transport and the growing network of highways improved the accessibility to the new areas. Autonomy and lightness are characteristics of The situation of emergency, and scarcity of both the transportable dwellings in general. -
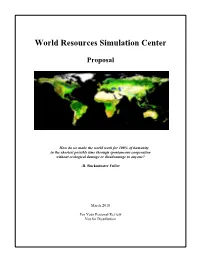
Business Plan and Supporting Documents with Feedback from Partners and Advisors
World Resources Simulation Center Proposal How do we make the world work for 100% of humanity in the shortest possible time through spontaneous cooperation without ecological damage or disadvantage to anyone? -R. Buckminster Fuller March 2010 For Your Personal Review Not for Distribution Table of Contents 1.0 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................... 3 DEVELOPMENT STAGES ............................................................................................................................................. 4 MISSION OBJECTIVES ................................................................................................................................................ 5 CENTER LOCATION WITHIN EXISTING STRUCTURE .................................................................................................... 5 2.0 WORLD RESOURCES SIMULATIO CETER ITRODUCTIO ........................................................... 7 MAJOR FUNCTIONS .................................................................................................................................................... 7 THE CENTER .............................................................................................................................................................. 7 CAPABILITIES ............................................................................................................................................................ 8 USER -

Fullerene: Fussballförmige Moleküle Mit Erfolgversprechenden Eigenschaften
Research Collection Report Fullerene: fussballförmige Moleküle mit erfolgversprechenden Eigenschaften Author(s): Brauckmann, Barbara Publication Date: 2001 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-004398079 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Fullerene: Fussballförmige Moleküle mit erfolgversprechenden Eigenschaften Informationen und Experimente: Texte Allgemeine Besucherwesen: Prof. Dr. François Diederich, Dr. Carlo Hintergrundinformationen: Valérie Sebbaâ Thilgen Dr. Barbara Brauckmann ETHZ Hönggerberg Laboratorium für Organische Chemie ETHZ Hönggerberg Departement Chemie ETHZ Hönggerberg Departement Chemie Assistenz Kommunikation Departement Chemie Leiterin Kommunikation CH- 8093 Zürich CH- 8093 Zürich CH- 8093 Zürich email: email: [email protected] [email protected] Inhaltsverzeichnis • C-Modifikation aus Fünf- und Sechsringen • Platonische und archimedische Körper in der Natur • Nobelpreis für die Entdeckung und Herstellung • Viele Anwendungsmöglichkeiten sind denkbar • Fulleren-Forschung an der ETH Zürich • Experimentelle Herstellung von Fullerenen aus Graphit • Wer gab den Fullerenen ihren Namen? • Verwendete Literatur C-Modifikation aus Fünf- und Sechsringen Die Fullerene sind neben Diamant und Graphit eine weitere Modifikation des Kohlenstoffs. Es gibt Fullerene mit den Formeln C60, C70, C76, C78, C84 sowie etliche andere. -

Entropic Migrant Conditions
614 Re.Building Entropic Migrant Conditions FAREH GARBA Rensselaer Polytechnic Institute Mobility as an impetus for architectural design pro- The intent of the projects developed within Entropic cesses has many implications including its capacity Migrant Conditions is to explore the potentials of to transform the conception, production, fabrica- mobility in architecture and invent dynamic topo- tion, occupation and interaction of the architecture, graphic, geometric and programmatic architectural its occupants and its environment. The notion of organizations in search of a new typology which designing an architecture which responds dynami- sustains the capacity to accommodate oscillations cally to its environment is one which must be in- which arise from existence within a contemporary vestigated and defined through various modalities environment. Rather than anticipate a decline in the in order to reveal new and emergent models. Mo- role of mobility specifically that of the car, between bility in architecture refers to a dynamic perfor- home and work, the premise of the two projects, mance which is defined by what the architecture detailed in Entropic Migrant Conditions is one which does, how it acts, its cultural, socio-economical ef- capitalizes on and intensifies the notion of mobility. fects and its aesthetic value. It is a concept which is applicable and can be modulated at many scales, Entropic Infrastructures and the EM-House, are within varying material conditions and in response projects through which I propose a new model for different conditions. Mobile architectures possess the dwelling and its relationship to the development dynamic characteristics which include but are not of the contemporary landscape as an emergent, limited to the ability to be adaptive/adaptable, flex- performance driven and user defined network.