Debatte – Wissenstransfer 2 0 1 6
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
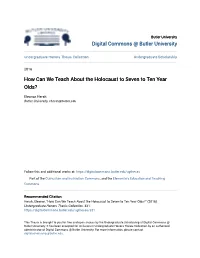
How Can We Teach About the Holocaust to Seven to Ten Year Olds?
Butler University Digital Commons @ Butler University Undergraduate Honors Thesis Collection Undergraduate Scholarship 2016 How Can We Teach About the Holocaust to Seven to Ten Year Olds? Eleanor Hersh Butler University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.butler.edu/ugtheses Part of the Curriculum and Instruction Commons, and the Elementary Education and Teaching Commons Recommended Citation Hersh, Eleanor, "How Can We Teach About the Holocaust to Seven to Ten Year Olds?" (2016). Undergraduate Honors Thesis Collection. 331. https://digitalcommons.butler.edu/ugtheses/331 This Thesis is brought to you for free and open access by the Undergraduate Scholarship at Digital Commons @ Butler University. It has been accepted for inclusion in Undergraduate Honors Thesis Collection by an authorized administrator of Digital Commons @ Butler University. For more information, please contact [email protected]. How Can We Teach About the Holocaust to Seven to Ten Year Olds? By: Ellie Hersh Introduction Determining what is the appropriate age to teach school children about the Holocaust, or to be taught about other difficult historical events, is a decision that has been debated among many. Some academics believe it is appropriate to start teaching the topic to students as young as Kindergarten, while others believe that it is more appropriate to wait until students are in high school. I believe that there are lessons that can be taken from the Holocaust—acceptance, understanding and appreciating differences, and helping others—which are more than appropriate to start teaching in a Kindergarten classroom. However, I do not believe that teaching the details of the Holocaust is appropriate. -

World War II: People, Politics, and Power / Edited by William L Hosch
Published in 2010 by Britannica Educational Publishing (a trademark of Encyclopædia Britannica, Inc.) in association with Rosen Educational Services, LLC 29 East 21st Street, New York, NY 10010. Copyright © 2010 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica, and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc. All rights reserved. Rosen Educational Services materials copyright © 2010 Rosen Educational Services, LLC. All rights reserved. Distributed exclusively by Rosen Educational Services. For a listing of additional Britannica Educational Publishing titles, call toll free (800) 237-9932. First Edition Britannica Educational Publishing Michael I. Levy: Executive Editor Marilyn L. Barton: Senior Coordinator, Production Control Steven Bosco: Director, Editorial Technologies Lisa S. Braucher: Senior Producer and Data Editor Yvette Charboneau: Senior Copy Editor Kathy Nakamura: Manager, Media Acquisition William L. Hosch: Associate Editor, Science and Technology Rosen Educational Services Hope Lourie Killcoyne: Senior Editor and Project Manager Joanne Randolph: Editor Nelson Sá: Art Director Matthew Cauli: Designer Introduction by Therese Shea Library of Congress Cataloging-in-Publication Data World War II: people, politics, and power / edited by William L Hosch. p. cm.—(America at war) “In association with Britannica Educational Publishing, Rosen Educational Services.” Includes index. ISBN 978-1-61530-046-4 (eBook) 1. World War, 1939–1945—Juvenile literature. I. Hosch, William L. II. Title: -

ARCHIV-VERSION Dokserver Des Zentrums Für Zeithistorische Forschung Potsdam E.V. Daniel U
ARCHIV-VERSION Dokserver des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. http://zeitgeschichte-digital.de/Doks Daniel Uziel “Juden unter sich”. The Propaganda Companies and the Jewish Ghettos in Occupied Poland https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1750 Archiv-Version des ursprünglich auf dem Portal Visual-History am 20.04.2020 mit der URL: https://visual- history.de/2020/04/20/propaganda-companies-and-the-jewish-ghettos-in-occupied-poland/ erschienenen Textes Copyright © 2020 Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V. und Autor/in, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist zum Download und zur Vervielfältigung für nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben. Es darf jedoch nur erneut veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der o.g. Rechteinhaber vorliegt. Dies betrifft auch die Übersetzungsrechte. Bitte kontaktieren Sie: <[email protected]> Für die Neuveröffentlichung von Bild-, Ton- und Filmmaterial, das in den Beiträgen enthalten ist, sind die dort jeweils genannten Lizenzbedingungen bzw. Rechteinhaber zu beachten. 1 von 17 Online-Nachschlagewerk für VISUALHISTORY die historische Bildforschung 20. April 2020 Daniel Uziel Thema: Zweiter Weltkrieg “JUDEN UNTER SICH” The Propaganda Companies and the Jew ish Ghettos in Occupied Poland One of the most influential anti-Semitic propaganda actions produced in the “Third Reich” in the years 1939-1941 w as based on images and reports from various ghettos in occupied Poland. Large portion of the raw material required for the anti-Semitic propaganda w as collected and delivered by the Propagandakompanien (PK) of the Wehrmacht.[1] In order to analyze and understand the significance of this contribution, it is necessary to look not only at the propaganda materials, but also at the historical contexts in w hich they w ere produced. -

Presenting Eichmann: One Man, Many Murders
Chapman University Chapman University Digital Commons War and Society (MA) Theses Dissertations and Theses Summer 8-2021 (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders Nina Handjeva-Weller Chapman University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.chapman.edu/war_and_society_theses Part of the Holocaust and Genocide Studies Commons, Other Film and Media Studies Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Handjeva-Weller, Nina. "(Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders." Master's thesis, Chapman University, 2021. https://doi.org/10.36837/chapman.000303 This Thesis is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at Chapman University Digital Commons. It has been accepted for inclusion in War and Society (MA) Theses by an authorized administrator of Chapman University Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders A Thesis by Nina Handjeva-Weller Chapman University Orange, CA Wilkinson College of Arts, Humanities, and Social Sciences Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in War and Society August 2021 Committee in charge: Stephanie Takaragawa, Ph.D., Jeffrey Koerber, Ph.D. Nam Lee, Ph.D. The thesis of Nina Handjeva-Weller is approved. Stephanie Takaragawa, Ph.D., Chair Jeffrey Koerber, Ph. D Nam Lee, Ph.D. July 2021 (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders Copyright © 2021 by Nina Handjeva-Weller III ABSTRACT (Re)Presenting Eichmann: One Man, Many Murders by Nina Handjeva-Weller This thesis argues that the act of recording the trial of Adolf Eichmann was an interpretation by director Leo Hurwitz, and that at the time it was recorded, and since then, the material has been used by different actors for different purposes. -

Roman Law and the Idea of Europe
Roman Law and the Idea of Europe Introduction Kaius Tuori This book explores the controversial role of ancient Rome and its legal heritage, Roman law, in the making of the idea of a shared European legal tradition. This derives from the use of the memory of the classical past in the political upheavals of the early twentieth century. For example, the classical civilization was often used to provide legitimacy to contemporary political causes by seeking parallels between historical examples and current policies. This reaching to the past for guidance for the future has, as a phenomenon, a long history, especially in times of crises. This book argues that a group of émigré scholars who fled totalitarianism had a crucial role in the formation of the European project that lead to integration after the war. While the Nazi and fascist states had legitimated their rule through references to the classical past, in the field of law and the example of ancient Roman law, these scholars would reinterpret the past to demonstrate how the Roman legal heritage was in fact in complete opposition to the totalitarian theories of law.1 One of the most beloved historians writing about the ancient world, Jérôme Carcopino (1881‒1970), published in 1940 his still popular La vie Quotidienne à Rome à l’Apogée de l’Empire (Daily Life in Ancient Rome) during the height of the Second World War. In it, he paints an engaging picture of life in ancient Rome during its height, describing it from the viewpoint of the individual on the street. What is less known is that after the fall of France in June 1940, Carcopino became a supporter of the Vichy regime that collaborated with the German occupiers. -
The Second World War Edited by Richard Bosworth , Joseph Maiolo Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-1-107-03407-5 — The Cambridge History of the Second World War Edited by Richard Bosworth , Joseph Maiolo Frontmatter More Information THE CAMBRIDGE HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR War is often described as an extension of politics by violent means. With contributions from twenty-eight eminent historians, Volume ii of The Cambridge History of the Second World War examines the relationship between ideology and politics in the war’s origins, dynamics and consequences. Part i examines the ideologies of the combatants and shows how the war can be understood as a struggle of words, ideas and values, with the rival powers expressing divergent claims to justice and controlling news from the front in order to sustain morale and influence international opinion. Part ii looks at politics from the perspective of pre-war and wartime diplomacy, as well as examining the way in which neutrals were treated and behaved. The volume con- cludes by assessing the impact of states, politics and ideology on the fate of individuals as occupied and liberated peoples, collabor- ators and resistors, and as British and French colonial subjects. Richard J. B. Bosworth is Senior Research Fellow at Jesus College, Oxford. Joseph A. Maiolo is Professor of International History in the Department of War Studies at King’s College London and Visiting Research Professor at the Norwegian Defence Intelli- gence School, Oslo. © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-1-107-03407-5 — The Cambridge History of the Second World War Edited by Richard Bosworth , Joseph Maiolo Frontmatter More Information THE CAMBRIDGE HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR GENERAL EDITOR evan mawdsley, Honorary Professorial Research Fellow and formerly Professor of International History at the University of Glasgow. -

Alicia: My Story Lesson Plan for Chapter 10 “In Chortkov Prison”
1 Alicia: My Story Lesson Plan for Chapter 10 “In Chortkov Prison” TITLE: Keeping the Faith: Keeping Kosher on Nazi Ghetto Rations RATIONALE: In order to gain a deeper, more holistic understanding of the events and effects of the Holocaust, students must be able to delve appropriately and respectfully into the lives of the victims. An often-neglected element of Holocaust studies is the daily routines and lives of those Jewish and political prisoners who were relegated to living within the walls of ghettos in major cities throughout Europe. By applying the seemingly innocuous and mundane task of cooking food as a context for their study of the Holocaust, students will be able to apply a real-world lens to their view of the victims’ lives. In analyzing the Jewish dietary restrictions of kashrut and juxtaposing them with the availability of food and living conditions in the ghettos, students will gain a deeper understanding of the social, religious and cultural difficulties the victims underwent. If executed with the utmost respect for the victims and with a deep level of engagement from the students, this lesson can serve to bridge the gap for students who may find the Holocaust hard to understand emotionally. OBJECTIVES: Students will be able to: • Identify many of the hardships incurred by those who lived in ghettos and concentration camps during the Holocaust. • Students will be able to understand the basics of Jewish dietary laws/restrictions and the impact they had on adapting to life in ghettos and concentration camps during the Holocaust. • Students will analyze informal recipes and accompanying stories by survivors of the Holocaust’s ghettos. -

Disalle, ’57 Assured Him There Would Be Time for That
NAA Trichter Der Nürnberger Trichter, sicher und schnell, macht die Köpfe hell! The NAA Funnel reliably and quickly makes one brighter. Vol. 21, No. 3 Nürnberg Alumni Association, Inc. Winter 2009 A publication by and for the alumni, faculty, and staff of the former Nürnberg American High School Release of Hitler Photos Provoke Memories Spirit of Hitler Lived On after the War By Bob McQuitty influence on the Germans would have after the end of the war. Indeed, I NAA historian been thoroughly obliterated. suppose you could say it lives on even Germany’s Wehrmacht was so Such was not the case. Although today. thoroughly defeated by the Allied forces their cities were in ruins and the The pictures recently released by and Adolph Hitler’s bizarre and brutal occupying Allied forces were Life magazine, some of which vision for Germany so thoroughly everywhere in Germany, the spirit of accompany this article, attest to his, still discredited, one would think that his Hitler lived on, especially in the decade ominous, presence. To see more of these Continued on page 12 Excited crowds greet Hitler at Fallersleben Volkswagen Motorworks cornerstone ceremony, near Wolfsburg, Germany, June 25, 1938. Copyrighted Photo: Hugo Jaeger/Time & Life Pictures/Getty Images/Reprinted with permission. 2 NAA Trichter, Winter 2009 Vol. 21, No. 3 NAA Trichter Oberammergau Passion Volume 21, No. 3 Winter 2009 The Trichter is published three times a year by the Nürnberg Alumni Play trip planned Association, Inc., a 501(c)7 not-for- profit organization, for the enjoy- Joan K. (McCarter) Adrian ’47, is and will not be presented again until ment of its members. -

Featuring David Darlow and Linda Gillum
Tadeusz’s Słobodzianek’s Our Class Field Guide Remy Bumppo, April 2014 Featuring David Darlow and Linda Gillum Greenhouse Theater Center, 2257 N. Lincoln Ave, Chicago www.RemyBumppo.org / 733-404-7336 Field Guide created by Michael Dalberg 1 Table of Contents Production Diary OUR CLASS Uniforms (Costume Design)………… …… 3 OUR CLASSroom (Set Design)…………………………... 6 OUR CLASS Schedule (Timeline)……………………………… 9 A History Lesson (Poland)………………………………………. 11 A Way of Life (The Shtetl)………………………………………. 14 The Neighborhood (Jedwabne)………………………………… 18 OUR CLASS Homework (A Bibliography)…………………….. 25 2 Tadeusz’s Słobodzianek’s Our Class Field Guide Remy Bumppo, April 2014 OUR CLASS Uniforms An Interview with Jeremy Floyd Jeremy’s rendering for Wladek. Jeremy Floyd, Costume Designer for OUR CLASS, is originally from the Deep South (Alabama to be exact). Having started his long academic journey at the University of South Alabama where he earned his BFA in Costume Design and Technology, he took a break for a few years of sun in LA as a makeup artist, and later attended the University of Kentucky where he received an MA in Theatre. Immediately thereafter, he continued his education at Northwestern University, where he earned an MFA in Costume Design. He has worked as a costume designer all along that path, and has been based in Chicago since 2007. Having been drawn to working with the Remy Bumppo Theatre Company due to the smart and insightful theatre created there, and the attention the company pays to having a thoughtful and educational approach to theatre, Jeremy took on the costume design for OUR CLASS. Despite being quite busy, Jeremy was able to take a moment and answer a few questions regarding his approach to the costume design. -

Brands with Nazi Ties That We All Use
Brands With Nazi Ties That We All Use By Gabe Paoletti Published October 6, 2017 Updated February 6, 2019 These companies made fortunes and grew to what they are today with help from Hitler. Nazi Links with IBM, Coca Cola Fanta, Hugo Boss, The Associated Press, Prett, Kellogg, Kodak, Volkswagon, Adidas, Puma and Bayer Pharmaceuticals Hugo Jaeger/Timepix/The LIFE Picture Collection/Getty ImagesAustrian automobile manufacturer Ferdinand Porsche (left, in dark suit) presents a newly designed convertible Volkswagen car to Adolf Hitler for his 50th birthday. Berlin, Germany. April 20, 1939. Nowadays, we rightly view the Nazi regime as an evil empire, horrific in their actions and despicable in their ideology. However, Nazi Germany was not always viewed as such. In fact, many major corporations that have survived to this day did business with the Nazis both before and during World War II. Furthermore, many business leaders at the time were sympathetic to Nazi ideology and even collaborated with the Nazi government for ideological reasons. Other businesses simply saw a chance to make a profit, ideology aside. Whatever their motivations, some of these Nazi collaborators provided materials that even helped to organize or carry out the Holocaust itself, while other Nazi collaborators used the slave labor from concentration camps to build their products. Some companies just supplied the Nazi populace and troops during wartime. While some of these companies were German corporations that were controlled or created by the Nazis, many were foreign companies that went out of their way to work with the Nazis. Either way, these companies both contributed to and benefitted from the immeasurable human suffering caused by the Nazis. -

Monumental Shifts in Memory the Evolution of German War Memorials from the Great War to the End of the Cold War
MONUMENTAL SHIFTS IN MEMORY THE EVOLUTION OF GERMAN WAR MEMORIALS FROM THE GREAT WAR TO THE END OF THE COLD WAR A Thesis by Sarah Elaine Lavallee Bachelor of Arts, Wichita State University, 2011 Bachelor of Fine Arts, Wichita State University, 2010 Submitted to the Department of History and the faculty of the Graduate School of Wichita State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts May 2014 © Copyright 2014 by Sarah Elaine Lavallee All Rights Reserved MONUMENTAL SHIFTS IN MEMORY THE EVOLUTION OF GERMAN WAR MEMORIALS FROM THE GREAT WAR TO THE END OF THE COLD WAR The following faculty members have examined the final copy of this thesis for form and content, and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts, with a major in History. ______________________________________ John Dreifort, Committee Chair ______________________________________ Jay Price, Committee Member ______________________________________ Donald Gilstrap, Committee Member iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my adviser, John Dreifort, for his continuous support and advice during my years at Wichita State. I am also grateful for the assistance of Jay Price. Their guidance throughout my graduate career has been invaluable. I would also like to thank my committee member, Donald Gilstrap, for his helpful suggestions during my thesis research. I am also very grateful for my friends and family who have supported me throughout this project. Specifically, I would like to thank Shanna Brown for proofreading several drafts of this thesis. Additionally, I owe a debt of gratitude to Benny Knoblauch for his endless patience and understanding. -

Face to Face/FINAL.Qxd
Face to Face SUMMER 2005 My Favourite Portrait by Harriet Walter BP Portrait Award 2005 shortlist announced The World’s Most Photographed exhibition explored Special offer to join the Friends of The Fleming Collection From the Director I have been very pleased with the reception of the Lee Miller: Portraits exhibition, which has already been enjoyed by more than 40,000 visitors. Although we knew the outstanding quality of her work, we could not know quite how many people would be drawn in by articles and reviews or by word of mouth. The comments from visitors have ranged from those who have been struck by the wit that runs through many of the portraits to an admiration for her brilliant ability to create wonderful formal compositions outside the studio, with subjects framed by their surroundings and objects to hand. COVER The judging of the 2005 BP Portrait Award and exhibition has just been completed, and Joan Collins although I cannot reveal the winner yet, I can say that we had a record entry once again by Cornel Lucas, 1959 (over 900 portraits submitted) and some works of outstanding quality. The styles remain © Cornel Lucas as various as ever, with everything from expressionist to precisionist renderings of mothers, fathers, lovers and friends (with pets in some cases). I look forward to your own comments and reactions to the exhibition itself. Membership of the National Portrait Gallery is now over 2,500 and growing. Do remember to tell friends and colleagues of the advantages of being a Member (including free admission to ticketed exhibitions).