Das Bundesjugendorchester in Zahlen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
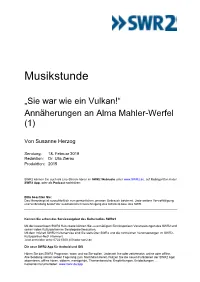
Annäherungen an Alma Mahler-Werfel (1)
Musikstunde „Sie war wie ein Vulkan!“ Annäherungen an Alma Mahler-Werfel (1) Von Susanne Herzog Sendung: 18. Februar 2019 Redaktion: Dr. Ulla Zierau Produktion: 2015 SWR2 können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de, auf Mobilgeräten in der SWR2 App, oder als Podcast nachhören: Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2- Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Die neue SWR2 App für Android und iOS Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, online oder offline. Alle Sendung stehen sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app SWR2 Musikstunde mit Susanne Herzog 18. Februar – 23. Februar 2019 „Sie war wie ein Vulkan!“ Annäherungen an Alma Mahler-Werfel (1) Mit Susanne Herzog. „Sie war wie ein Vulkan“ hat Anna Mahler über ihre Mutter Alma Mahler-Werfel gesagt und ihre „Begeisterungsfähigkeit für alles Künstlerische“ betont. Den Facetten der schillernden Persönlichkeit von Alma Mahler-Werfel und ihren Beziehungen zu so vielen großen Künstlern des 20. Jahrhunderts ist die SWR 2 Musikstunde diese Woche auf der Spur. -

-

Mahler's Symphony No. 10
SCHEDULE OF EVENTS WEDNESDAY, MAY 17, 7:30PM [Concert] Gordon Gamm Theater at The Dairy Center • G. Kurtág: Signs, Games, Messages (Jelek, Játékok és Üzenetek) • D. Matthews: Romanza for Violin and Piano, op 119a (U.S. Premiere) • G. Mahler/A. Schnittke: Piano Quartet in a (fragments) • F. Schubert: String Quintet in C, D. 956, Op. posth. 163 THURSDAY, MAY 18, 1:30PM [Master Class] Boulder Public Library • The Conducting Fellows, Kenneth Woods, David Matthews and Mahler specialists. • Mahler: Lieder eines fahrenden Gesellen– Chamber version (Schoenberg) FRIDAY, MAY 19, 2:00PM [FILM] BOEDECKER THEATRE AT THE DAIRY CENTER, BOULDER • Ken Russell’s Mahler SATURDAY, MAY 20, [Symposium] (speaker order subject to change) • Morning Session – 8:30am – C-199 – Imig Building, CU Boulder • Frans Bouwman ”Transcribing Mahler 10: what does it show?” • David Matthews ”Mahler’s 10th Symphony – Restored to Life” • Kenneth Woods, Artistic Director and Conductor, Colorado MahlerFest “A Conductor’s Perspective on the Tenth Symphony” • Jerry Bruck assisted by Louise Bloomfield In“ Search of Mahler: A Personal Recollection” • Lunch – Atrium Lobby, ATLAS building, University of Colorado • Afternoon Session – 1:30pm - Rm 102 – ATLAS Building, CU Boulder • Panel Discussion with David Matthews, Kenneth Woods and Donald Fraser • Jason Starr’s “For the Love of Mahler – The Inspired Life of Henry-Louis de La Grange” Presented in Memory of Henry-Louis de La Grange SATURDAY, MAY 20, 7:30 PM [Orchestral Concert] Macky Auditorium, University of Colorado SUNDAY, MAY 21, 3:30 PM [Orchestral Concert] Macky Auditorium, University of Colorado • Sir Edward Elgar (arr. David Matthews): String Quartet in e, opus 83 – arranged for string orchestra (2010) (US Premiere) • Gustav Mahler: Symphony No. -

Mahler's Third Symphony and the Languages of Transcendence
Mahler’s Third Symphony and the Languages of Transcendence Megan H. Francisco A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts University of Washington 2016 Stephen Rumph, Chair JoAnn Taricani Program Authorized to Offer Degree: Music ©Copyright 2016 Megan H. Francisco University of Washington Abstract Mahler’s Third Symphony and the Languages of Transcendence Megan H. Francisco Chair of the Supervisory Committee: Professor Stephen Rumph Music History A work reaching beyond any of his previous compositional efforts, Gustav Mahler’s Third Symphony embodies cultural, political, and philosophical ideals of the Viennese fin-de- siècle generation. Comprising six enormous movements and lasting over ninety minutes, the work stretches the boundaries of symphonic form while simultaneously testing the patience of its listeners. Mahler provided a brief program to accompany his symphony, which begins with creation, moves through inanimate flowers to animals, before finally reaching humanity in the fourth movement. In this movement, Mahler used an excerpt from Friedrich Nietzsche’s Also sprach Zarathustra to introduce spoken language into the symphony. The relationship of music and language plays an integral role in Mahler’s expressive design of the Third Symphony, specifically in his vision of transcendence. Mahler creates a subtle transformation from elevated language (the fourth) to a polytextuality of folksong and onomatopoeia (the fifth) that culminates in the final, transcendent sixth movement. Throughout these last three movements, Mahler incorporates philosophical concepts from Nietzsche and his beloved Arthur Schopenhauer. In studying the treatment of language in these culminating movements, this thesis shows how Nietzsche’s metaphysical philosophies help listeners encounter and transcend Schopenhauer’s Will at the climactic end of the Third Symphony. -

Camera Lucida Symphony, Among Others
Pianist REIKO UCHIDA enjoys an active career as a soloist and chamber musician. She performs Taiwanese-American violist CHE-YEN CHEN is the newly appointed Professor of Viola at regularly throughout the United States, Asia, and Europe, in venues including Suntory Hall, the University of California, Los Angeles Herb Alpert School of Music. He is a founding Avery Fisher Hall, Alice Tully Hall, the 92nd Street Y, the Metropolitan Museum of Art, member of the Formosa Quartet, recipient of the First-Prize and Amadeus Prize winner the Kennedy Center, and the White House. First prize winner of the Joanna Hodges Piano of the 10th London International String Quartet Competition. Since winning First-Prize Competition and Zinetti International Competition, she has appeared as a soloist with the in the 2003 Primrose Competition and “President Prize” in the Lionel Tertis Competition, Los Angeles Philharmonic, Santa Fe Symphony, Greenwich Symphony, and the Princeton Chen has been described by San Diego Union Tribune as an artist whose “most impressive camera lucida Symphony, among others. She made her New York solo debut in 2001 at Weill Hall under the aspect of his playing was his ability to find not just the subtle emotion, but the humanity Sam B. Ersan, Founding Sponsor auspices of the Abby Whiteside Foundation. As a chamber musician she has performed at the hidden in the music.” Having served as the principal violist of the San Diego Symphony for Chamber Music Concerts at UC San Diego Marlboro, Santa Fe, Tanglewood, and Spoleto Music Festivals; as guest artist with Camera eight seasons, he is the principal violist of the Mainly Mozart Festival Orchestra, and has Lucida, American Chamber Players, and the Borromeo, Talich, Daedalus, St. -

Holover-Opera-Part-1.Pdf
J & J LUBRANO MUSIC ANTIQUARIANS Item 69 Catalogue 82 OPERA SCORES from the Collection of Jerome Holover (1943-2013) Part 1: A-L 6 Waterford Way, Syosset, NY 11791 USA Telephone 516-922-2192 [email protected] www.lubranomusic.com CONDITIONS OF SALE Please order by catalogue name (or number) and either item number and title or inventory number (found in parentheses preceding each item’s price). Please note that all material is in good antiquarian condition unless otherwise described. All items are offered subject to prior sale. We thus suggest either an e-mail or telephone call to reserve items of special interest. Orders may also be placed through our secure website by entering the inventory numbers of desired items in the SEARCH box at the upper right of our homepage. We ask that you kindly wait to receive our invoice to insure availability before remitting payment. Libraries may receive deferred billing upon request. Prices in this catalogue are net. Postage and insurance are additional. An 8.625% sales tax will be added to the invoices of New York State residents. We accept payment by: - Credit card (VISA, Mastercard, American Express) - PayPal to [email protected] - Checks in U.S. dollars drawn on a U.S. bank - International money order - Electronic Funds Transfer (EFT), inclusive of all bank charges (details at foot of invoice) - Automated Clearing House (ACH), inclusive of all bank charges (details at foot of invoice) All items remain the property of J & J Lubrano Music Antiquarians LLC until paid for in full. v Please visit our website at www.lubranomusic.com where you will find full descriptions and illustrations of all items Fine Items & Collections Purchased v Members Antiquarians Booksellers’ Association of America International League of Antiquarian Booksellers Professional Autograph Dealers’ Association Music Library Association American Musicological Society Society of Dance History Scholars &c. -

-

Anna Mahler Y Tina Modotti: Plenitud Y Ruptura Viena Y México Como
90 - 103 Revista Nuestra América nº1 Enero - Julio 2006 ISSN: 1646-5024 Anna Mahler y Tina Modotti: Plenitud y ruptura Viena y México como centros de innovación cultural en la narrativa de Marlene Streeruwitz y Elena Poniatowska María Teresa Medeiros-Lichem* El movimiento artístico de la Secesión (1897) dio el ímpetu inicial a una era de innovación estética en la que la ciudad de Viena jugó un rol protagónico en las transformaciones profundas del vanguardismo internacional en música, pintura y las artes. A su vez, la ciudad de México de los 1920 y 1930 fue un centro cosmopolita de gran dinamismo, abierto a la interacción cultural donde se produjeron también cambios signifi cantes en las estructuras sociales, en los conceptos culturales y en la producción de las artes. Este trabajo30 se propone trazar un paralelo entre el ambiente cultural de estas dos épocas y su impacto en la vida y obra de dos artistas mujeres, Anna Mahler (1904-1988) y Tina Modotti (1896-1942), vistas a través de las narrativas de Marlene Streeruwitz (1950) y Elena Ponia- towska (1933). I. El mundo artístico de Viena a inicios del siglo XX La fermentación artística en la Viena Moderna, que se prolongó hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial, fue posible gracias a la inter-polinización entre una diversidad de impulsos culturales en que fi guras venidas de distintas regiones del Imperio Austro-Húngaro como Sig- mund Freud, o los compositores Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg, el arquitecto funcionalista Adolf Loos, el pintor expresionista Oskar Kokoschka y el escritor Franz Werfel convergieron en un polo de intercomunicación creativa. -

Conference Programme with Abstracts (Updated: 26 July 2013)
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) Conference Programme with abstracts (updated: 26 July 2013) Saturday, 27 July 9.00–13.00 IAML Board meeting Board members only 14.00–17.00 IAML Board meeting Board members only Sunday, 28 July 10.00–11.30 Ad Hoc Committee on Electronic Voting Working meeting (closed) Chair: Roger Flury (President, IAML) 14.00–16.30 IAML Council: 1st session All IAML members are cordially invited to attend the two Council sessions. The 2nd session will take place on Thursday at 16.00 Chair: Roger Flury (President, IAML) 19.30 Opening reception City Hall Monday, 29 July IAML Vienna 2013 – Conference Programme with abstracts (updated: 26 July 2013) Monday, 29 July 9.00–10.30 Opening session Announcements from the Conference organizers Music libraries in Vienna Strauss autographs – sources for research and musical interpretation Abstract: The Vienna City Library is holding by far the world's largest collection of manuscripts and printed material pertaining to the fabled Strauss family (Johann I-III, Josef, Eduard). Centerpiece is the collection of holographic music manuscripts. Treasured across the world, they are, however, not to be regarded as mere 'trophies', but provide key information for the understanding of the biographies of the said composers and their creative output. The presentation is to highlight some of the most telling examples. Speaker: Thomas Aigner (Wienbibliothek im Rathaus, Wien) The Archives, the Library and the Collections of the ‘Gesellschaft der Musikfreunde in Wien’ Speaker: Otto Biba (Gesellschaft der Musikfreunde, Wien) The Imperial Hofmusikkapelle of Vienna and its traces in the Music Department of the Austrian National Library Abstract: The year 1498 is regarded as the founding year of the Imperial Court Chapel of Vienna, when Emperor Maximilian I. -

Mahler-Werfel Papers Ms
Mahler-Werfel papers Ms. Coll. 575 Finding aid prepared by Violet Lutz. Last updated on June 23, 2020. University of Pennsylvania, Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts 2006 Mahler-Werfel papers Table of Contents Summary Information....................................................................................................................................4 Biography/History..........................................................................................................................................5 Scope and Contents..................................................................................................................................... 34 Administrative Information......................................................................................................................... 40 Controlled Access Headings........................................................................................................................41 Other Finding Aids......................................................................................................................................42 Collection Inventory.................................................................................................................................... 43 Correspondence to and from Alma Mahler, Franz Werfel, and Adolf Klarmann.................................43 Correspondence between Alma Mahler and Franz Werfel...................................................................45 Writings by Alma -
MS22 Mahler's Conducting Scores
1 MS22 Mahler’s conducting scores SCHONBERG, Arnold xx M 272.S35 (String quartet no. 1 in D minor, op.7) Quartet für zwei Violinen, Viola und Violoncello, op. 7 (von) Arnold Schönberg [Berlin, Birnbach, 1907?] Pl. no. 624 Miniature score Inscribed to Gustav Mahler by Schoenberg 73-032603 BEETHOVEN, Ludwig van xx M 302.B4 (Symphony no. 1 in C major, op.21) Erste Symphonie, (von) L. van Beethoven, op.21 Liepzig Peters [18- ]. Pl. no. 5442 Full score. Followed by: Beethoven, L. van. Symphony no. 2. q.v. Gustav Mahler’s copy 73-032452 BEETHOVEN, Ludwig van xx M 302.B4 (Symphony no. 2 in D major, op.36) Zweite Symphonie, (on) L. van Beethoven, op.36 Leipzig, Peters [18- ] Pl. no.5443 Full score. Gustav Mahler’s copy, with his markings Bound with: Beethoven, L. van. Symphony no. 1, q.v. BEETHOVEN, Ludwig van xx M 302.B4 (Symphony no.3 in E flat major (“Eroica”), op.55) Dritte Symphonie (Eroica), (von) L.v. Beethoven, op.55 Leipzig Peters [18- ] Pl. no.5444 Full score. Gustav Mahler’s copy, with his markings Followed by: Beethoven, L. van. Symphony no. 4, q.v. 73-032443 BEETHOVEN, Ludwig van xx M 302.B4 (Symphony no.9 in D minor (“Choral”), op.125) Neunte Symphonie, mid Schlusschor über Schiller’s Ode an die Freude, (von) L. van Beethoven, op.125 Leipzig, Peters [18- ] Pl. no.5450 Full score. Gustav Mahler’s copy, with his autograph markings 73-032425 1 2 BEETHOVEN, Ludwig van xx M 302.B4 (Symphony no.9 in D minor (“Choral”), op.125) Neunte Symphonie, mid Schlusschor über Schiller’s Ode an die Freude, (von) L. -

Alma Mahler and Vienna: the City That Loved Her Angela Dilkey
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2005 Alma Mahler and Vienna: The City That Loved Her Angela Dilkey Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC ALMA MAHLER AND VIENNA: THE CITY THAT LOVED HER By ANGELA DILKEY A Treatise submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2005 The members of the Committee approve the treatise of Angela Dilkey defended on March 18, 2005. ______________________________ Douglas Fisher Professor Directing Treatise ______________________________ Carolyn Bridger Outside Committee Member ______________________________ Larry Gerber Committee Member ______________________________ Jerrold Pope Committee Member The Office of Graduate Studies has verified and approved the above named committee members. ii TABLE OF CONTENTS ABSTRACT……………………………………………………………………….……………...iv FIN-DE-SIÈCLE VIENNA.……………………………………………………....….....…..….….1 ALMA MAHLER…………………………………………………………………...………….…9 Appendices A. ALMA’S LOVERS AND HUSBANDS……...……………………………………...28 B. ALMA’S CHILDREN……………………………………………....………………..29 C. ALMA’S SONGS………………………………...…………………………………..30 BIBLIOGRAPHY……………………………………………………………………….……….31 BIOGRAPHICAL SKETCH…………………………………………………………………….33 iii ABSTRACT From the peak of the Habsburg dynasty, fin-de-siècle Vienna offered the Viennese bourgeoisie a unique place to broaden their intellectual and artistic creativity. Artists of such caliber as Gustav Mahler and Arnold Schoenberg flocked to this enticing city at the turn of the twentieth century. Alma Mahler was a strong woman and a product of her time. Other women wanted her in their circle of friends and men desired her. The list of her acquaintances, friends, and lovers includes some of the most brilliant artists of the twentieth century.