Ten Brink.Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Symbiosis and Strife: Where Is the Sino–American Relationship Bound?
SYMBIOSIS AND STRIFE WHERE IS THE SINO–AMERICAN RELATIONSHIP BOUND? An Introduction to the APL Series “Measure Twice, Cut Once: Assessing Some China–US Technology Connections” National Security Report Richard Danzig | Lorand Laskai SYMBIOSIS AND STRIFE: WHERE IS THE SINO–AMERICAN RELATIONSHIP BOUND? An Introduction to the APL Series “Measure Twice, Cut Once: Assessing Some China–US Technology Connections” Richard Danzig Lorand Laskai Copyright © 2020 The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory LLC. All Rights Reserved. The views in this document reflect the opinions of the authors alone and do not represent any institutional position held by APL. NSAD-R-20-070 SYMBIOSIS AND STRIFE: WHERE IS THE SINO–AMEricaN RElatioNSHIP BOUND? iii Contents Foreword ....................................................................................................................................................................................v Summary ..................................................................................................................................................................................vii A Search for Strategy between the Poles ...................................................................................................... 2 Seductive “Lessons” from Soviet Experiences .............................................................................................. 6 Conjoined Siblings ........................................................................................................................................... -

PLANNING for INNOVATION Understanding China’S Plans for Technological, Energy, Industrial, and Defense Development
PLANNING FOR INNOVATION Understanding China’s Plans for Technological, Energy, Industrial, and Defense Development A report prepared for the U.S.-China Economic and Security Review Commission Tai Ming Cheung Thomas Mahnken Deborah Seligsohn Kevin Pollpeter Eric Anderson Fan Yang July 28, 2016 UNIVERSITY OF CALIFORNIA INSTITUTE ON GLOBAL CONFLICT AND COOPERATION Disclaimer: This research report was prepared at the request of the U.S.-China Economic and Security Review Commission to support its deliberations. Posting of the report to the Commis- sion’s website is intended to promote greater public understanding of the issues addressed by the Commission in its ongoing assessment of US-China economic relations and their implications for US security, as mandated by Public Law 106-398 and Public Law 108-7. However, it does not necessarily imply an endorsement by the Commission or any individual Commissioner of the views or conclusions expressed in this commissioned research report. The University of California Institute on Global Conflict and Cooperation (IGCC) addresses global challenges to peace and prosperity through academically rigorous, policy-relevant research, train- ing, and outreach on international security, economic development, and the environment. IGCC brings scholars together across social science and lab science disciplines to work on topics such as regional security, nuclear proliferation, innovation and national security, development and political violence, emerging threats, and climate change. IGCC is housed within the School -

Read the 3-26-2021 Issue In
VOLUME 21 • ISSUE 6 • MARCH 26, 2021 IN THIS ISSUE: Semiconductor Scandals A Concerning Backdrop to Xi’s Pursuit of “Core Technologies” By Elizabeth Chen………………………………………………….pp. 1-7 China’s 2027 Goal Marks the PLA’s Centennial, Not an Expedited Military Modernization By Brian Hart, Bonnie S. Glaser and Matthew P. Funaiole……………………...pp. 8-14 China and the Myanmar Junta: A Marriage of Convenience By Sudha Ramachandran…………………………………………………………...pp. 15-20 Potential Military Implications of Pingtan Island’s New Transportation Infrastructure By Kristian McGuire………………………………………………….………..pp. 21-28 Beijing Speaks on the Proposed Group of Seven Expansion By Jagannath Panda…………………………………………………………..pp. 29-34 Semiconductor Scandal A Concerning Backdrop to Xi’s Pursuit of “Core Technologies” By Elizabeth Chen Introduction China’s leadership has signaled the country’s dedication towards pursuing self-sufficiency in “core technologies“ including integrated circuits. During the Fifth Plenum last fall, the Chinese Communist Party (CCP) reinforced its belief in innovation being the core driver of China’s continuing development and pursuing a high-tech transformation of the manufacturing sector. The impetus for this structural transformation of the 1 ChinaBrief • Volume 21 • Issue 6 • March 26, 2021 economy was first established in the 2006 Medium and Long Term Plan for Science and Technology and emphasized in the 13th Five Year Plan (2016-2020). The 14th Five Year Plan (FYP) (2021-2025), unveiled on March 5 during the annual legislative Two Sessions meetings, described technology innovation as a matter of national security, not just economic development, for the first time. This represents the increasing perception that technology is a battleground for competition with the West, following U.S. -

Radomir Tylecote
Ownership and Innovation in Chinese Solar Photovoltaic Firms: An Analysis of the Effects of State, Private, and Foreign Shareholding on Patenting Performance Radomir Tylecote Thesis submitted for the award of Doctor of Philosophy (Ph.D.) The copyright of this thesis rests with the author and is made available under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives licence. Researchers are free to copy, distribute or transmit the thesis on the condition that they attribute it, that they do not use it for commercial purposes and that they do not alter, transform or build upon it. For any reuse or redistribution, researchers must make clear to others the licence terms of this work. 1 Abstract This thesis is a quantitative study of the effect of ownership – by state, private and foreign shareholdings – on innovation by China’s solar photovoltaic (PV) firms. Using the country’s solar PV industry, I seek to explain the impact of proportions of these different types of shareholding (and within the state category shareholding by central, provincial, and municipal governments) on innovative capacity. This capacity is measured by firms’ rates and qualities of patenting. As Chinese economic growth falters, amid the “re-shoring” of certain manufacturing capabilities, the role of the state, and whether it is helping or hindering its economy’s – and Chinese firms’ – technological upgrading, is a vital question. This is particularly true in high-tech sectors, including solar PV, which the Chinese government deems essential for the country’s continuing economic growth. Through the solar PV industry, we investigate the role of the state, and how it is helping or hindering Chinese companies’ innovation. -

The Makers Are Coming! China's Long Tail Revolution
The Makers Are Coming! China’s Long Tail Revolution The MIT Faculty has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation Wang, Jing. "The Makers Are Coming! China’s Long Tail Revolution." Handbook of Cultural and Creative Industries in China. Ed. Michael Keane. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2016. As Published http://dx.doi.org/10.4337/9781782549864 Publisher Edward Elgar Publishing Version Author's final manuscript Citable link http://hdl.handle.net/1721.1/108377 Terms of Use Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike Detailed Terms http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ The Makers Are Coming! China’s Long Tail Revolution Jing Wang, MIT In Handbook of Cultural and Creative Industries in China, ed., Michael Keane. Edward Elgar, 2016. 43-63. ABSTRACT This chapter situates the outbreak of the Maker Movement in contemporary China in the context of national innovation policy, the changing ethos of Chinese educators, and the revisionist take on copy culture (shanzhai). The author explores ‘change-maker’ as an alternative proposal to the ruling paradigm of ‘maker as entrepreneur’ and investigates several maker projects that have emerged from below as well as the implications of the spread of makerspaces to the national pursuit of creative China. KEYWORDS: maker, makerspace, changemaker, social innovation, creative industries, Chinese national innovation policy, mass entrepreneurship and innovation, Li Keqiang, shanzhai, Chaihuo Makerspace, MyIdol, NGO2.0, Enactus, Tiger Mom Introduction In February 2014, the US-based Tea Leaf Nation, a news site dedicated to Chinese citizen and social media, published an editorial ‘It’s official: China is becoming a new innovation powerhouse.’ The title should surprise no one well informed of the scale and strategy of China’s national innovation policies. -

China's Drive for 'Indigenous Innovation'
China’s Drive for ‘Indigenous Innovation’ A Web of Industrial Policies By James McGregor Senior Counselor APCO Worldwide Table of Contents Overview and Executive Summary………………………………………..…...……3 China’s indigenous innovation campaign is supported by an intricate web of industrial policies that are shaped by the country’s tempestuous history with the West and reflect a deep-seated desire to be self-sufficient. Playing Science and Technology Catch-up ………………………………………………8 China has made great strides in scientific development since 1949, but the road has not always been smooth. The Elixir of “Scientific Development” …………………………………………………9 The Hu-Wen Administration heralds science as the way forward but faces serious hurdles. “Innovation With Chinese Characteristics” ...............................................................10 Innovation becomes a buzzword in the late 1990s and a full-fledged policy priority in the mid 2000s. The Bureaucrats Beat the Scientists..........................................................................11 A top-down approach to innovation backed by officials wary of ceding bureaucratic control wins out over the peer-review system advocated by scientists. “Indigenous Innovation” Becomes Act II of “Reform and Opening” …...…………….13 Indigenous innovation becomes the new core of China’s development strategy. A Rambling Plan of Breathless Ambition …...……………………………………….….14 China’s indigenous innovation policy blueprint reflects lofty goals but lacks consensus as to implementation. Megaprojects For “Assimilating and Absorbing” …….……………............................15 The policy’s most ambitious element is a push to “co-innovate” and “re-innovate” foreign imported technology and focus on 16 key areas. “Acting as the Bones to Support the Rise of a Nation”………….………………..…....16 The Party sets the drive in motion with a series of laws, a financing plan and an implementation strategy. -

Innovation for Sustainability in a Changing China: Exploring Narratives and Pathways
Innovation for Sustainability in a Changing China: Exploring Narratives and Pathways Sam Geall and Adrian Ely Ecological Civilisation Innovation for Sustainability About the STEPS Centre in a Changing China: Today’s world is experiencing rapid social, technological and environmental change, yet poverty and inequality are growing. Exploring Narratives and Pathways Linking environmental sustainability with poverty reduction and social justice, and making science and technology work for the Given the environmental impacts of China’s current development poor, have become central challenges of our times. The STEPS trajectory and the country’s increasing economic and strategic Centre (Social, Technological and Environmental Pathways to focus on innovation, China’s progress on sustainable and low- Sustainability) is an interdisciplinary global research and policy carbon innovation is of crucial global importance. In order to better engagement hub that unites development studies with science understand how the government is accelerating progress in these and technology studies. We are developing a new approach to areas, this working paper explores some of the key political slogans understanding and action on sustainability and development that have underpinned China’s policies around sustainable in an era of unprecedented dynamic change. Our pathways development (可持续发展 kechixu fazhan) and innovation (创新 approach aims to link new theory with practical solutions that chuangxin) within the context of broader narratives and changes. create better livelihoods, health and social justice for poor and Drawing on theoretical insights from work that investigates the marginalised people. The STEPS Centre is based at the Institute role of power in shaping narratives, knowledge and action around of Development Studies and SPRU (Science Policy Research specific pathways to sustainability (Leach et al 2010a), this paper Unit) at the University of Sussex, with partners in Africa, Asia begins to explore the ways in which dominant policy narratives in and Latin America. -
China's Absorptive State
CHINA’S ABSORPTIVE STATE Research, innovation and the prospects for China-UK collaboration Kirsten Bound, Tom Saunders, James Wilsdon and Jonathan Adams October 2013 About Nesta Nesta is the UK’s innovation foundation. An independent charity, we help people and organisations bring great ideas to life. We do this by providing investments and grants and mobilising research, networks and skills. Nesta is a registered charity in England and Wales with company number 7706036 and charity number 1144091. Registered as a charity in Scotland number SCO42833. Registered office: 1 Plough Place, London, EC4A 1DE. www.nesta.org.uk © Nesta 2013. CHINA’S ABSORPTIVE STATE Research, innovation and the prospects for China–UK collaboration CONTENTS FOREWORD BY GEOFF MULGAN 4 ACKNOWLEDGEMENTS 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 1. CHINA’S ABSORPTIVE STATE 11 2. INDIGENOUS INNOVATION AND THE ‘CHINESE DREAM’ 19 3. SPOTLIGHT ON RESEARCH 31 4. MANY CHINAS, MANY INNOVATION SYSTEMS 39 5. THE ENTERPRISE OF INNOVATION 48 6. REBALANCING GROWTH 55 7. INNOVATION DIPLOMACY AND COLLABORATION 61 8. THE REAL RISK EQUATION 79 9. CHINA–UK: PARTNERS IN THE GLOBAL INNOVATION RACE 87 ABOUT THE AUTHORS 95 GLOSSARY 96 INTERVIEWEES AND EXPERT WORKSHOP PARTICIPANTS 97 ENDNOTES 99 4 CHINA’S ABSORPTIVE STATE: RESEARCH, INNOVATION AND THE PROSPECTS FOR CHINA–UK COLLABORATION FORWORD FOREWORD Will China lead? Or will it follow? For much of human history China led the world in science and technology. Western stereotypes of a backward and unchanging China obscured much more of that history than they illuminated. Indeed as the historian Joseph Needham showed in his extraordinary accounts, Chinese scientific civilisation was rich, and dynamic in many fields. -
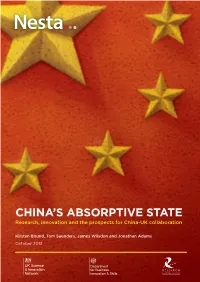
China's Absorptive State
CHINA’S ABSORPTIVE STATE Research, innovation and the prospects for China-UK collaboration Kirsten Bound, Tom Saunders, James Wilsdon and Jonathan Adams October 2013 About Nesta Nesta is the UK’s innovation foundation. An independent charity, we help people and organisations bring great ideas to life. We do this by providing investments and grants and mobilising research, networks and skills. Nesta is a registered charity in England and Wales with company number 7706036 and charity number 1144091. Registered as a charity in Scotland number SCO42833. Registered office: 1 Plough Place, London, EC4A 1DE. www.nesta.org.uk © Nesta 2013. CHINA’S ABSORPTIVE STATE Research, innovation and the prospects for China–UK collaboration CONTENTS FOREWORD BY GEOFF MULGAN 4 ACKNOWLEDGEMENTS 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 1. CHINA’S ABSORPTIVE STATE 11 2. INDIGENOUS INNOVATION AND THE ‘CHINESE DREAM’ 19 3. SPOTLIGHT ON RESEARCH 31 4. MANY CHINAS, MANY INNOVATION SYSTEMS 39 5. THE ENTERPRISE OF INNOVATION 48 6. REBALANCING GROWTH 55 7. INNOVATION DIPLOMACY AND COLLABORATION 61 8. THE REAL RISK EQUATION 79 9. CHINA–UK: PARTNERS IN THE GLOBAL INNOVATION RACE 87 ABOUT THE AUTHORS 95 GLOSSARY 96 INTERVIEWEES AND EXPERT WORKSHOP PARTICIPANTS 97 ENDNOTES 99 4 CHINA’S ABSORPTIVE STATE: RESEARCH, INNOVATION AND THE PROSPECTS FOR CHINA–UK COLLABORATION FORWORD FOREWORD Will China lead? Or will it follow? For much of human history China led the world in science and technology. Western stereotypes of a backward and unchanging China obscured much more of that history than they illuminated. Indeed as the historian Joseph Needham showed in his extraordinary accounts, Chinese scientific civilisation was rich, and dynamic in many fields. -

China's Military-Civil Fusion Strategy
CHINA’S MILITARY-CIVIL FUSION STRATEGY A VIEW FROM CHINESE STRATEGISTS A BluePath Labs Report by Alex Stone and Peter Wood for the China Aerospace Studies Institute Printed in the United States of America by the China Aerospace Studies Institute ISBN 9798652603717 To request additional copies, please direct inquiries to Director, China Aerospace Studies Institute, Air University, 55 Lemay Plaza, Montgomery, AL 36112 Design by Heisey-Grove Design All photos licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, or under the Fair Use Doctrine under Section 107 of the Copyright Act for nonprofit educational and noncommercial use. All other graphics created by or for China Aerospace Studies Institute E-mail: [email protected] Web: http://www.airuniversity.af.mil/CASI Twitter: https://twitter.com/CASI_Research | @CASI_Research Facebook: https://www.facebook.com/CASI.Research.Org LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11049011 Disclaimer The views expressed in this academic research paper are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the U.S. Government or the Department of Defense. In accordance with Air Force Instruction 51-303, Intellectual Property, Patents, Patent Related Matters, Trademarks and Copyrights; this work is the property of the U.S. Government. Limited Print and Electronic Distribution Rights Reproduction and printing is subject to the Copyright Act of 1976 and applicable treaties of the United States. This document and trademark(s) contained herein are protected by law. This publication is provided for noncommercial use only. Unauthorized posting of this publication online is prohibited. Permission is given to duplicate this document for personal, academic, or governmental use only, as long as it is unaltered and complete however, it is requested that reproductions credit the author and China Aerospace Studies Institute (CASI). -

The Evolution of Representative Claim-Making by the Chinese Communist Party: from Mao to Xi (1949–2019)
Politics and Governance (ISSN: 2183–2463) 2019, Volume 7, Issue 3, Pages 208–219 DOI: 10.17645/pag.v7i3.2151 Article The Evolution of Representative Claim-Making by the Chinese Communist Party: From Mao to Xi (1949–2019) Emilie Frenkiel 1,* and Anna Shpakovskaya 2 1 School of Public Administration and International Exchanges, Université Paris-Est Créteil, 94000 Créteil, France; E-Mail: [email protected] 2 Institute of East Asian Studies, University of Duisburg-Essen, 47057 Duisburg, Germany; E-Mail: [email protected] * Corresponding author Submitted: 30 March 2019 | Accepted: 26 July 2019 | Published: 24 September 2019 Abstract This article traces the evolution of representative claim-making by the Chinese Communist Party (CCP) since the proclama- tion of the People’s Republic of China in 1949 up to the present day. Based on the analysis of official political discourses on the mass line, the Three Represents and more recent ongoing discourses on digitalization, we demonstrate the change and continuity of claim-making by the CCP. We show that while representative claim-making has undergone a significant trans- formation from the CCP as the representative of the working class to the sole representative of the Chinese people and nation, the CCP has been consistent throughout decades in maintaining its hegemony over representative claim-making. Keywords China; digitalization; discourse; mass line; political representation; representative claim-making; responsiveness Issue This article is part of the issue “Rethinking Representation: Representative Claims in Global Perspective”, edited by Petra Guasti (Goethe University Frankfurt, Germany) and Brigitte Geissel (Goethe University Frankfurt, Germany). © 2019 by the authors; licensee Cogitatio (Lisbon, Portugal). -

1 Findings • the Chinese Communist Party's Efforts to Extend Control Over
INSTITUTIONS OF DEMOCRATIC GOVERNANCE Findings • The Chinese Communist Party’s efforts to extend control over all sectors of society violate citizens’ right to fully partici- pate in public affairs. As the Party’s dominance permeates so- ciety, the space for institutions of democratic governance di- minishes, thereby weakening citizens’ ability to hold authori- ties accountable for human rights violations such as the mass internment of Uyghurs and other ethnic minorities. • The Party used evaluation mechanisms to reinforce its prior- ities in the academic and business realms. In the academic realm, the Ministry of Education launched a program in which it assigned certain courses a ‘‘first rate’’ designation, giving it the power to withhold or revoke such designation for ideolog- ical misalignment. In the business realm, the Party handed down ratings of 33 million companies and directed local gov- ernments and agencies to use them as the basis for credit rat- ing. The criteria and methodology used, however, were not dis- closed. • In contrast, the Commission did not observe development of evaluation mechanisms for monitoring government agencies and Party organizations. The Party retained exclusive control over the disciplinary process for Party members and public servants. Moreover, disciplinary measures for actual mis- conduct and political missteps are carried out by the same state apparatus, which recently detained a prominent busi- nessman for his political speech and a high-ranking official for ‘‘not showing respect.’’ • The PRC Encryption Law took effect this past year. When applied with other regulations and new technologies such as blockchain, the new law potentially allows authorities to access a vast amount of information and directly monitor online ac- tivities in real time.