Innsbrucker Quartalsblätter 2/2010
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Taxi Information Willkommen in Tirol Die Taxilenker Haben Beförderungspflicht
Taxi Information Willkommen in Tirol Die Taxilenker haben Beförderungspflicht. Die Nichteinhaltung ist strafbar. Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Informationsschalter (Check-in Halle), für Anzeigen direkt an die Polizei (beim Tower). Welcome to Tyrol Taxi drivers are required to accept all fares; failure to do so is punishable by law. If you have any complaints, please contact the information desk (check-in hall). To file a report, please contact the police (station near control tower). Richtpreise* für Taxifahrten ab dem Flughafen Innsbruck Standard fares* for taxi journeys from Innsbruck Airport Achenkirch/Achensee € 125 Interalpen Hotel € 75 Nauders € 210 Stubaier Gletscher € 110 Meransen/Meranze € 170 Alpbach im Alpachtal € 120 Ischgl im Paznauntal € 190 Neustift im Stubaital € 65 Telfs € 60 Obereggen € 270 Auffach € 150 Jenbach € 85 Oberau/Wildschönau € 140 Uderns im Zillertal € 105 Predazzo € 290 Axamer Lizum € 50 Jerzens im Pitztal € 130 Obergurgl/Ötztal € 180 Vent im Ventertal € 180 Seis/Siusi-Alpe di Siusi € 210 Berwang € 150 Kaltenbach im Zillertal € 115 Obermieming € 75 Vomp € 70 Sexten/Sesto € 260 Brixen im Thale € 160 Kappl im Paznauntal € 180 Ötz im Ötztal € 100 Vomperberg € 80 St. Christina/Grödnertal € 220 Brixlegg € 100 Kirchberg in Tirol € 160 Pertisau/Achensee € 115 Wattens € 55 St.Ulrich/Ortisei - Val Gardena € 210 Davos über Engadin € 330 Kitzbühel € 180 Pettneu am Arlberg € 175 Westendorf € 160 Sterzing/Vipiteno € 130 Telefonnummern Ehrwald im Außerfern € 140 Klosters € 310 Pfunds/Ob. Gericht € 200 Wörgl -
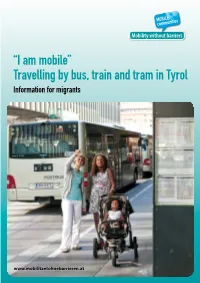
Travelling by Bus, Train and Tram in Tyrol Information for Migrants
MOBILE communities Mobility without barriers “I am mobile” Travelling by bus, train and tram in Tyrol Information for migrants www.mobilitaetohnebarrieren.at MOBILE communities Mobility without barriers Contents 4 Information points and the internet – get the information you need 8 Tickets and prices – know the cost even before you travel 15 Reductions and discounts – enjoy cheaper travel 17 Timetable and route map – find the right bus and train 19 Tips for using the bus and train – everything else you need to know 20 Cycling – the healthy option, supported by IVB, VVT and ÖBB Easy navigation – with these symbols Visit and ask It’s easier with A helpful A way to modern technology tip save money More information is also available at www.vvt.at/konkret or in Turkish at www.vvt.at/tuerkisch. This information folder is also available in German, Turkish, Arabic, Pashto and Persian. i regioni u Se n o b ie tti vo • S ech g s R eg ‘Mobility without barriers’ is a joint project run by Klimabündnis Tirol, io EUROPÄISCHE UNION n e Europäischer Fonds für regionale Entwicklun n e UNIONE EUROPEA i n Ökoinstitut Alto Adige, the Province of Tyrol and the Autonomous Fondo europeo per lo sviluppo regionale Z i e l Province of Alto Adige. It is co-financed by the European Fund for Regional Development ‘Interreg IV A Italy - Austria’ and as part Austria Italia • of the 2007-2013 ‘Strength through diversity’ programme Italien • Österreich for increasing the regional competitiveness of Tyrol. Co-financed by the European Regional Development Fund. Cofinanziato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale. -

Gemeinde Neustift Im Stubaital Teil 1 Gemeindeverwaltung
Gemeinde Neustift im Stubaital Teil 1 Gemeindeverwaltung Anschrift Landesrechnungshof 6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3 Telefon: 0512/508-3030 Fax: 0512/508-743035 E-mail: [email protected] Internet: www.tirol.gv.at/lrh Impressum Erstellt: November 2016 - März 2017 Herstellung: Landesrechnungshof Redaktion: Landesrechnungshof Herausgegeben: GE-2001/1, 7.8.2017 Fotos/Titelblatt: Gemeinde Neustift im Stubaital, TIRIS Abkürzungsverzeichnis ao. außerordentlich BGBl. Nr. Bundesgesetzblatt Nummer id(g)F in der (geltenden) Fassung KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung LGBl. Nr. Landesgesetzblatt Nummer LRH Landesrechnungshof TGO Tiroler Gemeindeordnung TLO Tiroler Landesordnung Z. Ziffer Zl. Zahl Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ................................................................................................................. 1 2. Allgemeines .............................................................................................................. 5 3. Aufbauorganisation ................................................................................................. 8 4. Personalangelegenheiten .......................................................................................11 4.1. Dienstposten- und Stellenplan .......................................................................11 4.2. Dienstverhältnisse .........................................................................................14 4.3. Personalaktenführung und Personalverrechnung ..........................................15 4.4. Arbeitszeitaufzeichnungen -

Absolventinnen & Absolventen
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK – DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE® absolventinnen & absolventen. Bachelor Diplom Master Executive Master Zertifikats-Lehrgänge wir gratulieren motivierten menschen. 1 wir begleiten motivierte menschen. Mit 3.000 Studierenden, 800 Lehrenden, 200 Partneruniversitäten, tausenden Absolventen/-innen und Arbeitgebern in aller Welt sowie laufenden Spitzenplätzen in Umfragen und Rankings hat sich die Unternehmerische Hochschule® zu einer internationalen Benchmark und zum begehrten Partner für Forschung, Lehre und Weiterbildung entwickelt. • Universum Student Survey Die Studierenden des MCI zählen zu den zufriedensten Hörern/-innen an Österreichs Hochschulen. Mit einem Zufriedenheits- wert von 4,4 (von 5 möglichen Punkten) liegt das MCI seit Jahren an der Spitze. Quelle: Universum Student Surveys 2009-2013 • Beurteilung durch Absolventen/-innen Beeindruckende 98% der Absolventen/-innen würden das MCI „auf jeden Fall“ oder „weitestgehend“ weiterempfehlen. 97% haben sich „auf jeden Fall“ oder „weitestgehend“ für das richtige Studium entschieden. Quelle: Absolventen/-innenbefragung 2012/13; Executive Master Studiengänge, Erhebung anonym, Rücklauf 52% • CHE Hochschulranking Das aktuelle Ranking des renommierten Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bescheinigt den MCI-Studiengängen gleich 23 (!) Plätze in der Spitzengruppe und bestätigt damit die hervorragenden Rankings der früheren Jahre. Quelle: CHE Hochschulranking 2013 • FIBAA Premiumsiegel Die Executive Master-Studiengänge General Management Executive MBA und Master of Science in Management MSc zählen zu den nur 11 von weltweit 1.400 Studiengängen, die mit dem exklusiven Premiumsiegel der internationalen Akkreditierungs- agentur FIBAA ausgezeichnet wurden. Quelle: www.fibaa.org • Akademischer Grad mit Marke MCI Das BMWF gestattet die Führung der Marke MCI in Verbindung mit den verliehenen akademischen Graden, zum Beispiel BSc MCI, MA MCI oder MBA MCI. Der Markenzusatz schafft Vertrauen und Orientierung in einem zunehmend von Wildwuchs geprägten Bildungs- und Wissenschaftsmarkt. -

Landesgesetzblatt Für Tirol
Landesgesetzblatt für Tirol Jahrgang 1996 Herausgegeben und versendet am 20. Juni 1996 9. Stück 36. Kundmachung der Landesregierung vom 14. Mai 1996 über die Genehmigung einer Änderung der Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Fügen und Fügenberg 37. Verordnung der Landesregierung vom 16. April 1996, mit der ein Gebiet der Stadtgemeinde Hall in Tirol zur Schutzzone erklärt wird 38. Verordnung der Landesregierung vom 7. Mai 1996, mit der das Entwicklungsprogramm für die Klein- region Wipptal geändert wird 39. Verordnung des Landeshauptmannes vom 3. Juni 1996 über die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen in Tourismusorten (Tourismusorte-Öffnungszeitenverordnung Sommer 1996) 36. Kundmachung der Landesregierung vom 14. Mai 1996 über die Genehmigung einer Änderung der Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Fügen und Fügenberg § 1 ge Verbindung der Grenzpunkte 171, 176, 175, Die Tiroler Landesregierung genehmigt ge- 2659 FB und 2662 FB entsprechend der Ver- mäß § 2 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung messungsurkunde des Dipl.-Ing. Zehentner, 1966, LGBl. Nr. 4, zuletzt geändert durch das staatlich befugter und beeideter Ingenieurkon- Gesetz LGBl. Nr. 98/1991, die übereinstim- sulent für Vermessungswesen, Kitzbühel, Joch- menden Beschlüsse des Gemeinderates der Ge- bergstraße 110, vom 7. April 1995, GZl. 3624/ meinde Fügen vom 2. Februar 1996 und des 94B, gebildet. Gemeinderates der Gemeinde Fügenberg vom § 2 4. Dezember 1995, mit denen folgende Ände- Eine vermögensrechtliche Auseinanderset- rung der Gemeindegrenze zwischen der Ge- zung zwischen den Gemeinden Fügen und meinde Fügen und der Gemeinde Fügenberg Fügenberg aus dieser Grenzänderung findet vereinbart wurde: nicht statt. Der neue Grenzverlauf in einem Teilabschnitt § 3 der Gemeindegrenze zwischen den Gemeinden Diese Grenzänderung tritt mit 1. Jänner 1997 Fügen und Fügenberg wird durch die geradlini- in Wirksamkeit. -

Mayrhofen Mayrhofen – Pertisau Pertisau – Steinberg Am Rofan Steinberg Am Rofan – Alpbach
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Nauders – Pfunds Pfunds – Landeck Landeck – Imst Imst – Lermoos Lermoos – Seefeld in Tirol Seefeld in Tirol – Fulpmes hm hm hm hm hm hm 2.000 2.000 1.200 2.000 2.000 2.000 01 02 1.500 1.500 1.000 1.500 1.500 1.500 04 03 05 1.000 1.000 800 1.000 1.000 1.000 06 10 20 30 40 km 10 20 30 40 50 60km 10 20 10 20 30 40 50km 10 20 30 40 50 km 10 20 30 40 50 60 70km 30km Close to the Italy/Switzerland/Austria border, Stage 1 serves up This stage takes you to the highest point along the entire route. This section is one of two stages that does not utilise the Ride Imster Bergbahnen Chair Lift to the top and embark This ride across lovely Gaistal Valley, which is encircled by This stage leads for a short distance through the Inn Valley, a brilliant expert route. Trail users wanting to travel Segment 1 Sweat it out on two uphill climbs that require a good level of mountain lifts, but is a leisurely mountain bike route. Offering on a mellow descent back down to the valley. The climb spectacular, rugged mountain walls, is a true gem. The route before the climb begins towards the Brenner Pass. After an but minimize their singletrack have an alternative to ride along fitness and take you from Inntal Valley to the sunny upland wonderful views of the mountains of the northern Inn Valley, atop Marienbergjoch Col into Außerfern Area will test your climbs towards Seefeld in sweeping hairpins. -

Seefejd in Tirol- Innsbruck
Seefeld in Tirol STAGE 46 SEEFELD IN TIROL—INNSBRUCK Km 25 +276 -871 Land Tirolo Race E District Innsbruck- Land Seefeld - The village is located on a S plateau north of the Inn River. It's on the watershed between the Inn and the Isar. The plateau (where Leutasch and Mosern are also located) is bordered by a steep downhill to the south. To the north the valley continues through the towns of Reith bei Seefeld Scharnitz and Mittenwald in Land Tirolo Germany. Seefeld was mentioned for District Innsbruck- the first time in 1022 and there was a Land monastery whose church is the parish church. In 1384 the church of St. Oswald was a place of pilgrimage. The Reith resort is located at the foot of the Reither Spitze (2,374 m) top on the southern edge of the Seefeld plateau. The name of the village, Reith, means in German "defaced place". The settlements Auland, Gschwand, Krinz, Leithen, Mühlberg and Reith form together the municipality of Reith bei Seefeld, which, as its name already reveals, is located in the Seefeld Olympic region. 1 2 Seefeld in Tirol—Innsbruck 3 We enter Seefeld as we come out of the wood and walking along the Leutascher Strasse (L14), at the crossroad we turn right on the Munchnerstrasse and continue on the lane parallel to the Innsbruckerstrasse (L36) then Auland Gstoag which takes us along the railway 4 we continue for over 2 km and turn right then sharp le ft on the Bunsteig; we are on a gentle downhill course and for a short distance we return on the Auland Gstoag; if we don’t need to enter in the locality of Auland , turning right we take the Muhlbergweg which turns into a cycling lane taking us directly to Reith bei Seefeld , after having crossed the 177 and the railway ; we arrive on the Romerstrasse. -
Mit Öffentlicher Anreise Kartenlegende
mit öffentlicher Anreise KARTENLEGENDE Schutzhütte, Berggasthof Hotel, Gasthof, Restaurant Jausenstation, Almwirtschaft Hütte/Biwak (unbewirtschaftet) Berggipfel Bergkette Kirche, Kloster Denkmal Weg Fußweg Steig Weg (Variante) Fußweg (Variante) Steig (Variante) Gehrichtung Gehrichtung (Variante) 201/201 Wegnummern Eisenbahn, S-Bahn Hauptstraße Nebenstraße Bach, Fluss Brücke Seilbahn/Gondel/Materialseilbahn Bedeutender Punkt Bahnhof, S-Bahn-Haltestelle Parkplatz Bushaltestelle Krankenhaus Touristeninformation 112 140 Euro-Notruf Österr. Bergrettung ÜBERSICHT DER WANDERTOUREN Sylvenstein-Stausee Fall Juifen 17 1988 Isar 10 11 Schafreiter Achenkirch 2101 4 Krün 18 Mondscheinspitze 2106 7 12 Hinterriß Achensee Mittenwald Rißbach 17 12 Mahnkopf Pertisau 2094 16 Eng Pleisenspitze 2569 Birkkar- spitze 9 Scharnitz 3 6 2 2749 16 Jenbach Stans Großer Bettelwurf Schwaz 13 2726 Seefeld Erlspitze 2405 18 14 Großer Solstein 5 1 2541 Absam Reith bei 15 8 Seefeld Rum Hall in Tirol Hochzirl Innsbruck Zirl Kranebitten 3 INHALTSVERZEICHNIS Kartenlegende und Notrufnummern (Umschlagklappe vorne) Übersicht der Wandertouren 2 Vorwort 4 Einleitung 5 Tourenplanung 8 Tipps für Ihre Sicherheit 9 Verhaltenstipps 12 EINTAGESTOUREN 1 Durch die Schlossbachklamm (Sanfte Tour) 14 2 Vom Großen Ahornboden zur Binsalm (Sanfte Tour) 16 3 Rund um die Karwendelschlucht (Sanfte Tour) 18 4 Zur Moosenalm am Achensee (Sanfte Tour) 20 5 Geschichte und Natur im wilden Halltal 22 6 Auf den Gipfel der Pleisenspitze 24 7 Zur Seekarspitze hoch überm Achensee 26 8 Grandiose Tiefblicke -

Tiroler Apotheken, Die Gratis-Antigentests Anbieten
Tiroler Apotheken, die Gratis-Antigentests anbieten - Liste der Apothekerkammer Tirol Name Straße PLZ Ort Tel Fax Gratistest Burggrafen-Apotheke Gumppstraße 45 6020 Innsbruck (0512) 34 15 17 (0512) 34 15 17-4 Apotheke "Zur Triumphpforte" Müllerstraße 1 a 6020 Innsbruck (0512) 72 71-20 (0512) 72 71-18 Saggen-Apotheke Claudiastraße 4 6020 Innsbruck (0512) 58 80 92 (0512) 58 80 92-20 x Linden-Apotheke Amraser Straße 106 a6020 Innsbruck (0512) 34 14 91 (0512) 34 14 91-15 x Apotheke Mühlau Anton-Rauch-Straße 60206 Innsbruck (0512) 26 77 15 (0512) 26 77 15-15 x Dreifaltigkeits-Apotheke Defreggerstraße 28 6020 Innsbruck (0512) 34 15 02 (0512) 39 87 90 x Apotheke Boznerplatz Bozner Platz 7 6020 Innsbruck (0512) 58 58 17 (0512) 58 58 17-3 x Apotheke "Zur Universität" Innrain 47 6020 Innsbruck (0512) 57 35 85 (0512) 57 35 85-2 Apotheke "Zum Andreas Hofer"Andreas-Hofer-Straße6020 30 Innsbruck (0512) 58 48 61 (0512) 58 48 61-9 x Zentral-Apotheke Anichstraße 2 a 6020 Innsbruck (0512) 58 23 87 (0512) 56 71 39 x St. Anna-Apotheke Maria-Theresien-Straße6020 4 Innsbruck (0512) 58 58 47 (0512) 58 15 67 x Stadt-Apotheke Herzog-Friedrich-Straße6020 25 Innsbruck (0512) 58 93 88 (0512) 58 93 88-30 x Nova-Park-Apotheke Arzler Straße 43 b 6020 Innsbruck-Arzl (0512) 26 70 58 (0512) 26 26 23 x Stamser-Apotheke Höttinger Gasse 45 6020 Innsbruck (0512) 28 35 21 (0512) 28 11 53 Bahnhof-Apotheke Südtiroler Platz 5 - 7 6020 Innsbruck (0512) 58 64 20 (0512) 56 51 03 Prinz-Eugen-Apotheke Prinz-Eugen-Straße 706020 Innsbruck (0512) 34 41 80 (0512) 36 42 59 Löwen-Apotheke -

Follow-Up Study in the Ski-Resort Ischgl
medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.19.21252089; this version posted February 23, 2021. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuity. All rights reserved. No reuse allowed without permission. Follow-up study in the ski-resort Ischgl: Antibody and T cell responses to SARS-CoV-2 persisted for up to 8 months after infection and transmission of virus was low even during the second infection wave in Austria Wegene Borena1*, Zoltán Bánki1*, Katie Bates2*, Hannes Winner3*, Lydia Riepler1, Annika Rössler1, Lisa Pipperger1, Igor Theurl4, Barbara Falkensammer1, Hanno Ulmer2, Andreas Walser5, Daniel Pichler6, Matthias Baumgartner6, Sebastian Schönherr7, Lukas Forer7, Ludwig Knabl1, Reinhard Würzner6, Dorothee von Laer1*, Jörg Paetzold3*#, Janine Kimpel1*# Affiliation 1 Institute of Virology, Department of Hygiene, Microbiology and Public Health, Medical University of Innsbruck, Peter-Mayr-Str. 4b, 6020 Innsbruck, Austria 2 Department of Medical Statistics, Informatics and Health Economics, Medical University of Innsbruck, Austria 3 University of Salzburg, Department of Economics, Residenzplatz 9, A-5010 Salzburg, Austria 4 Labor Dr. Theurl, Franz-Fischerstr.7b, Innsbruck, Austria 5 Dr. Walser’s surgery, Ischgl, Austria 6 Department of Hygiene, Microbiology and Public Health, Medical University of Innsbruck, 6020 Innsbruck, Austria 7 Institute of Genetic Epidemiology, Medical University of Innsbruck, Austria * contributed equally # corresponding authors: Jörg Paetzold University of Salzburg, Department of Economics, Residenzplatz 9, A-5010 Salzburg, Austria Email: [email protected] Janine Kimpel Institute of Virology, Department of Hygiene, Microbiology and Public Health, Medical University of Innsbruck, Peter-Mayr-Str. -

410 Innsbruck
Innsbruck Ehrwald Zugspitzbahn Reutte in Tirol Pfronten-Steinach Karwendelbahn 410 410 Schienenersatzverkehr zwischen Vils Stadt und Pfronten-Steinach Weitere Züge Innsbruck Hbf - Innsbruck Westbf siehe Fahrplanbild 400 ¾ Zustieg im Nahverkehr (REX, R, S-Bahn) im Abschnitt Innsbruck Hbf - Scharnitz nur mit gültigem Ticket, ausgenommen in Stationen ohne Möglichkeit zum Ticketkauf. Im Streckenabschnitt Scharnitz - Pfronten-Steinach gelten die Tarife des VVT (Verkehrsverbund Tirol) und der DB (Deutsche Bahn). Wien Hbf 100 « 5 30 Linz Hbf 101 6 46 Salzburg Hbf 300 5 56 7 56 Innsbruck Hbf an 7 44 9 44 Æ Æ Æ Æ S6 Æ Æ Æ S6 S6 S6 Æ Æ S6 Ã S6 Å RB 60 S6 Æ 5500 5502 5504 5506 5404 5508 5536 5510 5440 5442 5408 5512 5538 5444 5410 5446 1206 5544 5412 5514 ¿ / DB Regio AG 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. zusätzliche Hinweise 1 3 4 5 X KV KV KV KV KV KV ÏK» KV von Garmisch- Garmisch- Garmisch- Garmisch- Garmisch- anr Garmisch- Garmisch- Garmisch- Parten- Parten- Parten- Parten- Parten- Garmisch- Parten- Parten- Parten- kirchen kirchen kirchen kirchen kirchen Parten- kirchen kirchen kirchen gültig ab Innsbruck Hbf 6 38 kirchen 7 08 8 08 8 38 9 08 10 08 610 23 10 38 Innsbruck Westbf 6 42 7 12 8 12 8 42 9 12 10 12 x | 10 42 Innsbruck Hötting ¸ 6 45 7 15 8 15 8 45 9 15 10 15 x | 10 45 Allerheiligenhöfe ¸ ~6 48 ~7 18 ~8 18 ~ 8 48 ~9 18 ~10 18 x | ~10 48 Kranebitten ¸ ~6 51 ~7 21 ~8 21 ~ 8 51 ~9 21 ~10 21 x | ~10 51 Hochzirl ¸ 7 01 7 31 8 31 9 01 9 31 10 31 x | 11 01 Leithen ¸ ~7 05 ~7 35 ~8 35 ~ 9 05 ~9 35 ~10 35 x | ~11 05 13.Dezember 2020 Reith ¸ 7 10 7 40 8 40 9 10 9 40 10 40 x | 11 10 Seefeld in Tirol an 7 14 7 44 8 44 9 14 9 44 10 44 x 10 56 11 14 Seefeld in Tirol ab 7 15 7 45 8 45 9 15 10 04 s10 45 x 11 04 11 15 Gießenbach ¸ ~7 22 ~7 52 ~8 52 ~ 9 22 10 11 x~10 52 x | ~11 22 Scharnitz ¸ an 7 27 7 57 8 57 9 27 10 15 s10 57 x | 11 27 Scharnitz ¸ . -

Polizei Tirol 2/2017 Editorial
Österreichische Post AG - Info.Mail Entgelt bezahlt 2/2017 POLIZEI TIR OL DAS INFO-MAGAZIN DER LANDESPOLIZEIDIRE KTION INHALT IMPRESSUM Editorial Polizei bei der Tiroler Herbstmesse 2017......48 Österreichische Post AG - Info.Mail Entgelt bezahlt 2/2012 Vorwort des Landespolizeidirektors ...........2 Polizeilicher Sicherheitstag Inntalcenter Telfs ............................49 Vorwort des Chefredakteurs .................... Konzertsaison der Polizeimusik Tirol .........50 Rechtliches Fachexpertisen ....................6 POLIZEI Benefiz-Kirchenkonzert der TIROL Wohl eines der ältesten Gewerbe der Welt... ....8 Polizeimusik Tirol............................52 DAS INFO-MAGAZIN DER LANDESPOLIZEIDIREKTION Illegales Glücksspiel – Vorgehensweise Kapellmeisterwechsel bei der LPD Tirol ......................................9 Polizeimusik Tirol............................53 HERAUSGEBER: Alternatives Bewährungssystem - Alkolock...11 Ehrung couragierter Zivilpersonen 2017......53 Landespolizeidirektion Tirol Leitstelle Neu mit Einsatzleit- und „CyberKids Bezirkstour 2017“ ................55 Büro Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationssystem .....................13 6010 Innsbruck, Innrain 34 Landespolizeidirektion News Kriminalprävention Tel.: 059133-701111 - Bischof MMag. Hermann Glettler [email protected] ...............................56 E-Mail: [email protected] zu Besuch bei der Polizei ....................15 „BLEIB SAUBER - Jugend OK!“ ................57 REDAKTION: Auszeichnung für Tiroler Polizisten...........19 Verkehrprävention Ehrung verdienter