German Modern Talking Vs. Iranian Modern Talking
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Video Disco Klip Lista 10Cc
VIDEO DISCO KLIP LISTA 10CC - Dreadlock Holiday 2 Brothers On The 4th Floor - Dreams (Will Come Alive) 2 Brothers On The 4th Floor - Fly 2 in a room - Wiggle It 2 Unlimited - Get Ready For This k 2 Unlimited - No Limit 2 unlimited - Twilight Zone 20 Fingers - Lick It 20 Fingers Feat. Gillette - Short Short Man 4 Non Blondes - What's Up 50 cent feat. Justin timberlake - Ayo technology A Flock Of Seagulls - Wishing A flock of seagullsa - I Ran A1 - Take On Me Abba - Chiquitita ABBA - Dancing Queen Abba - Dancing Queen2 Abba - Does Your Mother Know Abba - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) Abba - Knowing Me Knowing You Abba - Mamma Mia Abba - Money Money Money Abba - S.O.S. Abba - Super Trouper Abba - Take A Chance On Me Abba - Thank You For The Music Abba - The Winner Takes It All Abba - Waterloo ABC - Poison Arrow ABC - When Smokey Sings ACDC-Highway To Hell (Live Version) Ace Of Base - All That She Wants Ace Of Base - Beautiful Life (Vission Lorimer Club Mix) Ace Of Base - Cruel Summer Ace Of Base - Don't Turn Around Ace Of Base - Happy Nation Ace Of Base - Living In Danger Ace Of Base - The Sign Adam Ant - Puss 'n' Boots Adele - Rolling In The Deep Afric Simone - Haffananah Afrojack Feat. Eva Simons - Take Over Control A-Ha - Stay On These Roads A-Ha - Take On Me A-Ha - The Sun Always Shines On TV Air Suooly - All Out of Love Akcent - Love Stoned Akcent - That's My Name Alanis Morissette - You Oughta Know Alannah Myles - Black Velvet Alb Negru - Charisma Alex Velea-Don't say It's Over Alexandra Stan - Get Back Alexandra Stan - Lollipop Alexandra Stan - Mr Saxobeat Alexunderbase - Privacy Alice Cooper-Poison Alice Deejay - Back In MY Life Alice Deejay - Better Of Alone Alphaville - Big In Japan Alphaville - Forever Young Amanda Lear - Queen Of Chinatown Amber - This Is Your Night Amii Stewart - Knock On Wood Andre Rieu - Kalinka Andre Rieu - Poliushko Polie Andre Rieu - Sirtaki Animotion - Obsession Ann Lee - 2 Times Aqua – Barbie Girl Arcadia - Election Day Arman Van Helden - My My My Armin van Buuren feat. -

John Lennon from ‘Imagine’ to Martyrdom Paul Mccartney Wings – Band on the Run George Harrison All Things Must Pass Ringo Starr the Boogaloo Beatle
THE YEARS 1970 -19 8 0 John Lennon From ‘Imagine’ to martyrdom Paul McCartney Wings – band on the run George Harrison All things must pass Ringo Starr The boogaloo Beatle The genuine article VOLUME 2 ISSUE 3 UK £5.99 Packed with classic interviews, reviews and photos from the archives of NME and Melody Maker www.jackdaniels.com ©2005 Jack Daniel’s. All Rights Reserved. JACK DANIEL’S and OLD NO. 7 are registered trademarks. A fine sippin’ whiskey is best enjoyed responsibly. by Billy Preston t’s hard to believe it’s been over sent word for me to come by, we got to – all I remember was we had a groove going and 40 years since I fi rst met The jamming and one thing led to another and someone said “take a solo”, then when the album Beatles in Hamburg in 1962. I ended up recording in the studio with came out my name was there on the song. Plenty I arrived to do a two-week them. The press called me the Fifth Beatle of other musicians worked with them at that time, residency at the Star Club with but I was just really happy to be there. people like Eric Clapton, but they chose to give me Little Richard. He was a hero of theirs Things were hard for them then, Brian a credit for which I’m very grateful. so they were in awe and I think they had died and there was a lot of politics I ended up signing to Apple and making were impressed with me too because and money hassles with Apple, but we a couple of albums with them and in turn had I was only 16 and holding down a job got on personality-wise and they grew to the opportunity to work on their solo albums. -

DVD Home Theatre System
4-165-483-11(1) DVD Home Theatre System Operating Instructions DAV-DZ170/DZ171/DZ175 ©2010 Sony Corporation Owner’s Record CAUTION WARNING The model and serial numbers are You are cautioned that any changes located on the rear exterior of the or modifications not expressly Caution – The use of unit. Record the serial number in approved in this manual could void optical instruments with the space provided below. Refer to your authority to operate this this product will increase them whenever you call upon your equipment. Sony dealer regarding this product. eye hazard. Model No. DAV-DZ170/ DAV- Important Safety DZ171/DAV-DZ175 Do not install the appliance in a Instructions Serial No.______________ confined space, such as a bookcase 1) Read these instructions. or built-in cabinet. 2) Keep these instructions. To reduce the risk of fire, do not The following FCC statement 3) Heed all warnings. applies only to the version of this cover the ventilation opening of the 4) Follow all instructions. model manufactured for sale in the apparatus with newspapers, 5) Do not use this apparatus near U.S.A. Other versions may not tablecloths, curtains, etc. Do not water. comply with FCC technical place the naked flame sources such 6) Clean only with dry cloth. as lighted candles on the apparatus. regulations. 7) Do not block any ventilation Do not expose batteries or openings. Install in accordance NOTE: apparatus with battery-installed to with the manufacturer’s This equipment has been tested and excessive heat such as sunshine, instructions. fire or the like. found to comply with the limits for 8) Do not install near any heat a Class B digital device, pursuant to To prevent injury, this apparatus sources such as radiators, heat Part 15 of the FCC Rules. -

Warriors As the Feminised Other
Warriors as the Feminised Other The study of male heroes in Chinese action cinema from 2000 to 2009 A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Chinese Studies at the University of Canterbury by Yunxiang Chen University of Canterbury 2011 i Abstract ―Flowery boys‖ (花样少年) – when this phrase is applied to attractive young men it is now often considered as a compliment. This research sets out to study the feminisation phenomena in the representation of warriors in Chinese language films from Hong Kong, Taiwan and Mainland China made in the first decade of the new millennium (2000-2009), as these three regions are now often packaged together as a pan-unity of the Chinese cultural realm. The foci of this study are on the investigations of the warriors as the feminised Other from two aspects: their bodies as spectacles and the manifestation of feminine characteristics in the male warriors. This study aims to detect what lies underneath the beautiful masquerade of the warriors as the Other through comprehensive analyses of the representations of feminised warriors and comparison with their female counterparts. It aims to test the hypothesis that gender identities are inventory categories transformed by and with changing historical context. Simultaneously, it is a project to study how Chinese traditional values and postmodern metrosexual culture interacted to formulate Chinese contemporary masculinity. It is also a project to search for a cultural nationalism presented in these films with the examination of gender politics hidden in these feminisation phenomena. With Laura Mulvey‘s theory of the gaze as a starting point, this research reconsiders the power relationship between the viewing subject and the spectacle to study the possibility of multiple gaze as well as the power of spectacle. -

Register of Entertainers, Actors and Others Who Have Performed in Apartheid South Africa
Register of Entertainers, Actors And Others Who Have Performed in Apartheid South Africa http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.nuun1988_10 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Register of Entertainers, Actors And Others Who Have Performed in Apartheid South Africa Alternative title Notes and Documents - United Nations Centre Against ApartheidNo. 11/88 Author/Creator United Nations Centre against Apartheid Publisher United Nations, New York Date 1988-08-00 Resource type Reports Language English Subject Coverage (spatial) South Africa Coverage (temporal) 1981 - 1988 Source Northwestern University Libraries Description INTRODUCTION. REGISTER OF ENTERTAINERS, ACTORS AND OTHERS WHO HAVE PERFORMED IN APARTHEID SOUTH AFRICA SINCE JANUARY 1981. -
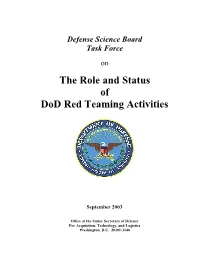
The Role and Status of Dod Red Teaming Activities
Defense Science Board Task Force on The Role and Status of DoD Red Teaming Activities September 2003 Office of the Under Secretary of Defense For Acquisition, Technology, and Logistics Washington, D.C. 20301-3140 This report is a product of the Defense Science Board (DSB). The DSB is a Federal Advisory Committee established to provide independent advice to the Secretary of Defense. Statements, opinions, conclusions and recommendations in this report do not necessarily represent the official position of the Department of Defense. This report is UNCLASSIFIED TABLE OF CONTENTS I. Introduction........................................................................................1 II. What Are Red Teams And Red Teaming?.....................................2 III. What Makes an Effective Red Team?.............................................5 IV. Observations About Current Red Team Activities.......................7 V. Red Teams At The Strategic Level ................................................13 VI. Conclusions ......................................................................................15 VII. Recommendations...........................................................................16 Appendix 1. Terms of Reference..............................................................19 Appendix 2. Task Force Members ...........................................................21 Appendix 3. Contrasts Between Product/Project and Enterprise Red Teams.....................................................................................23 -

ANSAMBL ( [email protected] ) Umelec
ANSAMBL (http://ansambl1.szm.sk; [email protected] ) Umelec Názov veľkosť v MB Kód Por.č. BETTER THAN EZRA Greatest Hits (2005) 42 OGG 841 CURTIS MAYFIELD Move On Up_The Gentleman Of Soul (2005) 32 OGG 841 DISHWALLA Dishwalla (2005) 32 OGG 841 K YOUNG Learn How To Love (2005) 36 WMA 841 VARIOUS ARTISTS Dance Charts 3 (2005) 38 OGG 841 VARIOUS ARTISTS Das Beste Aus 25 Jahren Popmusik (2CD 2005) 121 VBR 841 VARIOUS ARTISTS For DJs Only 2005 (2CD 2005) 178 CBR 841 VARIOUS ARTISTS Grammy Nominees 2005 (2005) 38 WMA 841 VARIOUS ARTISTS Playboy - The Mansion (2005) 74 CBR 841 VANILLA NINJA Blue Tattoo (2005) 76 VBR 841 WILL PRESTON It's My Will (2005) 29 OGG 841 BECK Guero (2005) 36 OGG 840 FELIX DA HOUSECAT Ft Devin Drazzle-The Neon Fever (2005) 46 CBR 840 LIFEHOUSE Lifehouse (2005) 31 OGG 840 VARIOUS ARTISTS 80s Collection Vol. 3 (2005) 36 OGG 840 VARIOUS ARTISTS Ice Princess OST (2005) 57 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Lollihits_Fruhlings Spass! (2005) 45 OGG 840 VARIOUS ARTISTS Nordkraft OST (2005) 94 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Play House Vol. 8 (2CD 2005) 186 VBR 840 VARIOUS ARTISTS RTL2 Pres. Party Power Charts Vol.1 (2CD 2005) 163 VBR 840 VARIOUS ARTISTS Essential R&B Spring 2005 (2CD 2005) 158 VBR 839 VARIOUS ARTISTS Remixland 2005 (2CD 2005) 205 CBR 839 VARIOUS ARTISTS RTL2 Praesentiert X-Trance Vol.1 (2CD 2005) 189 VBR 839 VARIOUS ARTISTS Trance 2005 Vol. 2 (2CD 2005) 159 VBR 839 HAGGARD Eppur Si Muove (2004) 46 CBR 838 MOONSORROW Kivenkantaja (2003) 74 CBR 838 OST John Ottman - Hide And Seek (2005) 23 OGG 838 TEMNOJAR Echo of Hyperborea (2003) 29 CBR 838 THE BRAVERY The Bravery (2005) 45 VBR 838 THRUDVANGAR Ahnenthron (2004) 62 VBR 838 VARIOUS ARTISTS 70's-80's Dance Collection (2005) 49 OGG 838 VARIOUS ARTISTS Future Trance Vol. -

Interart Studies from the Middle Ages to the Early Modern Era: Stylistic Parallels Between English Poetry and the Visual Arts Roberta Aronson
Duquesne University Duquesne Scholarship Collection Electronic Theses and Dissertations Fall 1-1-2003 Interart Studies from the Middle Ages to the Early Modern Era: Stylistic Parallels between English Poetry and the Visual Arts Roberta Aronson Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/etd Recommended Citation Aronson, R. (2003). Interart Studies from the Middle Ages to the Early Modern Era: Stylistic Parallels between English Poetry and the Visual Arts (Doctoral dissertation, Duquesne University). Retrieved from https://dsc.duq.edu/etd/11 This Worldwide Access is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of Duquesne Scholarship Collection. For more information, please contact [email protected]. Interart Studies from the Middle Ages to the Early Modern Era: Stylistic Parallels between English Poetry and the Visual Arts A Dissertation Presented to the Faculty of the McAnulty College and Graduate School of Liberal Arts Duquesne University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy by Roberta Chivers Aronson October 1, 2003 @Copyright by Roberta Chivers Aronson, 2003 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to extend my appreciation to my many colleagues and family members whose collective support and inspiration underlie all that I do: • To my Provost, Dr. Ralph Pearson, for his kind professional encouragement, • To my Dean, Dr. Connie Ramirez, who creates a truly collegial and supportive academic environment, • To my Director, Dr. Albert C. Labriola, for his intellectual generosity and guidance; to Dr. Bernard Beranek for his enthusiasm and thoughtful conversation; and to Dr. -

October 23, 1993 . 2.95, US 5, ECU 4
Volume 10 . Issue 43 . October 23, 1993 . 2.95, US 5, ECU 4 AmericanRadioHistory.Com START SPREADING THE NEWS. CHARLES AZNAVOUR you make me feel so young ANITA BAKER witchcraft TONY BENNETT "new york, new york" BONO i've got you under my skin NATALIE COLE they can't take that away from me Frank Sinatra returns to the recording studio for the -first time in fifteen years. And he's GLORIA ESTEFAN come rain or come shine come home to the label and studio that are synonymous with the most prolific years of ARETHA FRANKLIN his extraordinary career. what now my love KENNY G Capitol Records proudly releases DUETS. all the way/one for my baby Thirteen new recordings of timeless Sinatra (and one more for the road) classics featuring the master of popular song JULIO IGLESIAS in vocal harmony with some of the world's summer wind greatest artists. LIZA MINNELLI. i've got the world on a string Once again, Sinatra re -invents his legend, and unites the generation gap, with a year's CARLY SIMON guess i'll hang my tears out to dry/ end collection of songs that make the perfect in the wee small hours of the morning holiday gift for any music fan. BARBRA STREISAND i've got a crush on you It's the recording event of the decade. LUTHER VANDROSS So start spreading the news. the lady is a tramp Produced by Phil Ramone and Hank Kattaneo Executive Producer: Don Rubin Released on October 25th Management: Premier Artists Services Recorded July -August 1993 CD MC LP EMI ) AmericanRadioHistory.Com . -

Gefangenenlager, Psychiatrie Und Nun DSDS
P - Publizisten P - Publizisten Medienspektrum ABENTEUER JOURNALISMUS Martin Blach: Gefangenenlager, Psychiatrie und nun DSDS Martin Blach, 1975 in Frankfurt a. M. geboren, studierte nach Abitur und Wehrdienst kath. Theologie an Jesuiten- Hochschulen in Frankfurt a. M. und Boston/USA. Parallel eignete er sich studienbegleitend Expertise in Betriebs- wirtschaft und Marketing/PR an. Nach verschiedenen Stationen im Journalis- mus, in der Hessischen Staatskanzlei sowie der Hess. Landesvertretung in Berlin wurde er 2008 vom Kuratorium der Stiftung Kloster Eberbach zu deren Geschäftsführendem Vorstand berufen. Martin Blach „vermarktet“ Kloster Eberbach mithilfe einer Fernsehshow s ist besonderes Glück, an die- Ort. Es war bereits Gefangenlager, Psy- In meiner Zeit als Vorstand ha- sem 900 Jahre alten Ort arbeiten chiatrie und Waffenlager. Durch die ben wir noch nie eine solche mediale zu dürfen. Seit acht Jahren helfe Basilika führte zeitweise eine Straße. Aufmerksamkeit erfahren. Im No- Eich als Geschäftsführender Vorstand, Warum diesen Ort also nicht für ein vember 2015 sind wir vom Bundes- Kloster Eberbach zu erhalten und der Format öffnen, das dem Kloster einen verband Deutscher Stiftungen mit Öffentlichkeit zugänglich zu machen. so nie dagewesenen Werbeeffekt bieten dessen „Oscar“ für gutes Stiftungs- Ein Traumjob und zugleich ein Kampf, könnte? management ausgezeichnet worden. ohne in Betreib und Unterhalt staat- Legt man eine Werbeminute bei RTL Meist war dies nur eine kurze Notiz lich subventioniert zu sein täglich fast am Samstagabend in Höhe eines sechs- wert. Über Jahre haben wir Kloster 10.000 Euro an Kosten zu stemmen. stelligen Betrags zugrunde und verge- Eberbach zu einem erfolgreichen Ohne kreative Vermarkung geht da genwärtigt sich die Präsenz des Klosters Wirtschaftsunternehmen aufgebaut nichts. -

Debate on Anti-Semitism Lacks Substance
SOCIETY: ANTI-SEMITISM Debate on anti-Semitism lacks substance Long-term media analysis of coverage on anti-Semitism, Israel and religious communities 1999-2003 s there another topic that national media in Germany treat quite as Short-term sensationalism… I carelessly as real or purported anti- Presence of the topic anti-Semitism 01/02-11/03 Semitism? After ten years of continuous 100 media analysis, and against the backdrop number of stories of the debate on the speech by CDU par- liamentarian Hohmann, the observer is 80 hard pressed to see anything reassuring in media reporting. 60 Whether in the ARD or ZDF, BILD or SÜD- 40 DEUTSCHE ZEITUNG, SPIEGEL or STERN, journalists continue to exploit and sen- 20 sationalize their coverage on the historic responsibilities of Germans, on religious 0 communities in general and the Jewish 1234567891011121234567891011 community and Israel, in particular. Cli- 2002 2003 chés seem to play a far more important Source: MEDIA TENOR Basis: 328 stories abaut anti-Semitism; role in news selection and evaluation than 01/01/2002 - 11/15/2003 in 21 media a journalistic predilection for research, reporting the news and putting events into a clear context. The victims are once …leads at best to saturation again the very same people for whom the Assessment of selected religious communities 01-11/03 media hype was purportedly intended: Shares of negative and positive coverage the Jewish religious community. Catholic church negative Anti-Semitism as a pretext positive The above graph shows how shallow Protestant curch this debate really is: Journalists who paid such great attention to the topic in Jewish community May/June 2002 and in November 2003 should also put up with the question why they basically ignored it for the entire Muslim community time in between? Jewish graveyards are desecrated every week. -

HITS of the WORLD C O N I N Lj E 1=>
HITS OF THE WORLD C O N I N lJ E 1=> MUSIC EUROCHART 04/10/99 & MEDIA SPAIN (AFYVE/ALEF MB) 03/24/99 THIS LAST TIS LAST WEB( MIED( SINGLES WEEK WED( SINGLES 1 1 . BABY ONE MORE TIME BRITNEY SPEARS JIVE 1 1 NOTHING REALLY MATTERS MADONNA WEA 2 2 PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) THE OFFSPRING 2 3 MARIA BLONDIE ARIOLA COLUMBIA 3 2 IT'S NOT RIGHT BUT IT'S OKAY WHITNEY HOUS- MUSIC , 3 4 CHANGES 2PAC AMARU /JIVE TON ARIOLA 4 3 BIG BIG WORLD EMILIA RODEY/UNIVERSAL 4 NEW SALOME CHAYANNE COLUMBIA THE LATEST MUSIC NEWS FROM AROUND THE PLANET 5 7 MARIA BLONDIE BEYOND /RCA 5 4 YOU GOTTA BE DES'REE EPIC 6 NEW FLAT BEAT MR. OZIO F COMMUNICATIONS 6 8 STRONG ENOUGH CHER WEA 7 5 STRONG ENOUGH CHER WEA 7 5 YOU ARE NOT ALONE MODERN TALKING ARIOLA 8 6 BELIEVE CHER WEA EDITED BY DOMINIC PRIDE 8 6 AS GEORGE MICHAEL FEATURING MARY J. BLIGE 9 8 TU M'OUBLIERAS LARUSSO ODEON/EMI EPIC 10 10 BOOM, BOOM, BOOM, BOOM! VENGABOYS VIO 9 RE BUSINDRE REEL (ASAP REMIXES) HEVIA HISPAVOX MARK DEZZANI LENT /JIVE DANISH ACT Cartoons has scored a U.K. No. Ricordi), for Italian video. 10 RE IF YOU COULD READ MY MIND STARS ON 54 2 with their debut there, "Witch Doctor," ALBUMS BLANCO Y NEGRO 1 FOOD/PARLOPHONE and its release has realized a dream for the MILA MARCIL was born in Ontario and is now 2 BLUR 13 ALBUMS 2 1 CHER BELIEVE WEA band, appearing on the U.K.'s flagship TV based in Dallas, but the Indian -American 1 HEVIA TIERRA DE NADIE HISPAVOX 3 3 BRITNEY SPEARS ..