Die Goldwespen Der Peloponnes (Hymenoptera: Chrysididae) 1. Teil
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Greece I.H.T
Greece I.H.T. Heliports: 2 (1999 est.) GREECE Visa: Greece is a signatory of the 1995 Schengen Agreement Duty Free: goods permitted: 800 cigarettes or 50 cigars or 100 cigarillos or 250g of tobacco, 1 litre of alcoholic beverage over 22% or 2 litres of wine and liquers, 50g of perfume and 250ml of eau de toilet. Health: a yellow ever vaccination certificate is required from all travellers over 6 months of age coming from infected areas. HOTELS●MOTELS●INNS ACHARAVI KERKYRA BEIS BEACH HOTEL 491 00 Acharavi Kerkyra ACHARAVI KERKYRA GREECE TEL: (0663) 63913 (0663) 63991 CENTURY RESORT 491 00 Acharavi Kerkyra ACHARAVI KERKYRA GREECE TEL: (0663) 63401-4 (0663) 63405 GELINA VILLAGE 491 00 Acharavi Kerkyra ACHARAVI KERKYRA GREECE TEL: (0663) 64000-7 (0663) 63893 [email protected] IONIAN PRINCESS CLUB-HOTEL 491 00 Acharavi Kerkyra ACHARAVI KERKYRA GREECE TEL: (0663) 63110 (0663) 63111 ADAMAS MILOS CHRONIS HOTEL BUNGALOWS 848 00 Adamas Milos ADAMAS MILOS GREECE TEL: (0287) 22226, 23123 (0287) 22900 POPI'S HOTEL 848 01 Adamas, on the beach Milos ADAMAS MILOS GREECE TEL: (0287) 22286-7, 22397 (0287) 22396 SANTA MARIA VILLAGE 848 01 Adamas Milos ADAMAS MILOS GREECE TEL: (0287) 22015 (0287) 22880 Country Dialling Code (Tel/Fax): ++30 VAMVOUNIS APARTMENTS 848 01 Adamas Milos ADAMAS MILOS GREECE Greek National Tourism Organisation: Odos Amerikis 2b, 105 64 Athens Tel: TEL: (0287) 23195 (0287) 23398 (1)-322-3111 Fax: (1)-322-2841 E-mail: [email protected] Website: AEGIALI www.araianet.gr LAKKI PENSION 840 08 Aegiali, on the beach Amorgos AEGIALI AMORGOS Capital: Athens Time GMT + 2 GREECE TEL: (0285) 73244 (0285) 73244 Background: Greece achieved its independence from the Ottoman Empire in 1829. -
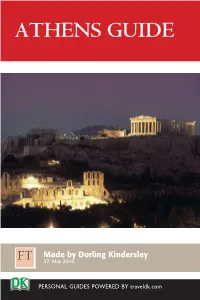
Athens Guide
ATHENS GUIDE Made by Dorling Kindersley 27. May 2010 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Athens guide Top 10 Acropolis The temples on the “Sacred Rock” of Athens are considered the most important monuments in the Western world, for they have exerted more influence on our architecture than anything since. The great marble masterpieces were constructed during the late 5th-century BC reign of Perikles, the Golden Age of Athens. Most were temples built to honour Athena, the city’s patron goddess. Still breathtaking for their proportion and scale, both human and majestic, the temples were adorned with magnificent, dramatic sculptures of the gods. Herodes Atticus Theatre Top 10 Sights 9 A much later addition, built in 161 by its namesake. Acropolis Rock In summer it hosts the Athens Festival (see Festivals 1 As the highest part of the city, the rock is an ideal and Events). place for refuge, religion and royalty. The Acropolis Rock has been used continuously for these purposes since Dionysus Theatre Neolithic times. 10 This mosaic-tiled theatre was the site of Classical Greece’s drama competitions, where the tragedies and Propylaia comedies by the great playwrights (Aeschylus, 2 At the top of the rock, you are greeted by the Sophocles, Euripides) were first performed. The theatre Propylaia, the grand entrance through which all visitors seated 15,000, and you can still see engraved front-row passed to reach the summit temples. marble seats, reserved for priests of Dionysus. Temple of Athena Nike (“Victory”) 3 There has been a temple to a goddess of victory at New Acropolis Museum this location since prehistoric times, as it protects and stands over the part of the rock most vulnerable to The Glass Floor enemy attack. -

Annual Reports 2008–2009 2009–2010
THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS Annual Reports 2008–2009 through 2009–2010 VISION The American School of Classical Studies at Athens strives to maintain and enhance its position as the preeminent center for the study of the Greek world from antiquity to the present day. MISSION The American School of Classical Studies at Athens (ASCSA) advances knowledge of Greece in all periods, as well as other areas of the classical world, by training young scholars, sponsoring and promoting archaeological fieldwork, providing resources for scholarly work, and disseminating research. The ASCSA is also charged by the Hellenic Ministry of Culture and Tourism with primary responsibility for all American archaeological research, and seeks to support the investigation, preservation, and presentation of Greece’s cultural heritage. PHILOSOPHY The study of Greece from antiquity to the present day is critical for understanding the civilizations, history and culture of the Mediterranean, Europe, and Western Asia. The ASCSA supports a multidisciplinary approach to Hellenic studies, encompassing the fields of archaeology, anthropology, the archaeological sciences, topography, architecture, epigraphy, numismatics, history, art, language, literature, philosophy, religion, and cultural studies. As an institution in Greece sponsored by a consortium of institutions of higher education in North America, the ASCSA makes its resources available to qualified scholars, promotes the highest standards of research and archaeological fieldwork, and shares the results of its work. Front cover: 2008–09 Members ascend the akropolis of Orchomenos on Trip III and stand atop its tower (October 2008). Back cover: Visits to the sites and monuments of Athens and Attica are a central part of the School’s academic program in the winter months. -

Midi's Meanderings Part Three
Midi’s Meanderings Part Three 25 May 2012 Yasas everyone Since the last time we wrote we have visited a few more Greek islands that we have not seen before. So many islands end in –os that they all start to merge in to one. We visited Ios then it was off to Kimolos where we walked up to the chora (old village). I don’t know about these Greeks. They built their villages on the highest point possible. I know it was to keep the marauding invaders away but in 2012 if the punters have to sweat their way up the hill, you would think they would ensure that the shops were open when they got there! Did notice this interesting way of getting around the nuisance of having a tree growing right where you want to build a wall – no problem – don’t cut it down, just build the wall with the tree growing through it! On the way back to the boat, we spotted this little owl who forgot that it was supposed to come out at nightl Next island was Milos, where the Venus de Milo was found in the 1800’s. Our anchorage there was in an extinct volcano that had the side blown out of it. We saw there a good reason not to tie up at the town wall. As we were going in to shore in the dinghy, we spotted a local fishing boat heading into the harbour. Something must have happened to its throttle as it nearly smashed into the jetty until the fisherman managed to get it into reverse, where upon it roared backwards and smashed into a charter yacht. -

Administrative Records
AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS ADMINISTRATIVE RECORDS ATHENS 2014 Series 100 Convey Knowledge – Teaching 1 Subseries 101 Curriculum Planning 1 Subseries 102 The Academic Program-Fall and Winter Program and trips 1 Subseries 103 The Academic Program-Summer Session program and trips 6 Subseries 104 The Academic Program-Committee on Summer Sessions 15 Subseries 105 The Academic Program-The notebooks from the ASCSA trips 18 Subseries 106 Students and Members-Committee on Admissions/Fellowships 23 Subseries 107 Students and Members-Sample of entrance exams 25 Subseries 108 Students and Members-Correspondence 26 Subseries 109 Students and Members-Member’s Files 32 Subseries 110 The ASCSA Professor’s Papers 32 Subseries 111 Extra Curriculum Activities: Optional trips, Seminars, Summer Sessions other than ASCSA’s 33 Subseries 112 Professors 34 Series 200 Convey Knowledge – Research 35 Subseries 201 Field Projects sponsored by ASCSA/General 35 Subseries 202 Field Projects sponsored by ASCSA/The Agora of Athens 37 Subseries 203 Field Projects sponsored by ASCSA/Corinth 60 Subseries 204 Field Projects sponsored by ASCSA/Other 67 Subseries 205 Field Projects sponsored by ASCSA/Annual Reports 86 Subseries 206 Excavation and Survey Committee 87 Subseries 207 Projects of scholars, fellowships, exchange programs 92 Subseries 208 Committee on Publications 101 Subseries 209 Wiener Laboratory 104 Subseries 210 Wiener Laboratory/Director’s Correspondence 105 Subseries 211 Committee on the Wiener Laboratory 106 Subseries 212 Computer Resources as a Research Facility 106 Subseries 213 System supervisor’s correspondance 106 Subseries 214 Research Facilities – Varia 107 Series 300 Governance 107 Subseries 301 The founding of ASCSA 107 Subseries 302 Legal Environment 108 Subseries 303 Lists of members of the Board of Trustees, of various committees 110 Subseries 304 The Board of Trustees – The U.S. -

HOTELS | PROGRAMS | ISLAND HOPPING | TOURS | CRUISES | CAR RENTAL | YACHT CHARTER | TURKEY EXTENSIONS Meteora
GREECE 2020 HOTELS | PROGRAMS | ISLAND HOPPING | TOURS | CRUISES | CAR RENTAL | YACHT CHARTER | TURKEY EXTENSIONS Meteora 2 GREECE 2020 • GREECE AND MEDITERRANEAN TRAVEL CENTRE Welcome to Greece As my second home and where Greece and Mediterranean Travel Centre began, Greece holds a special place in my heart. Its hidden gems are still exciting for me to share and I love being able to offer the Halina Kubica traditional Greece, known only to locals, Owner & Managing Director as well as the popular ancient treasures Greece is renowned for. It always surprises travellers when they discover there are 227 idyllic inhabited islands, stunning ruins, and mountainous mainland to explore of unique beauty and rare customs. Sampling freshly cooked local food at the small taverna with the stunning backdrop of the Aegean Sea is the highlight of each of my trips and I hope will be yours too. Let us show you Greece like you’ve never imagined, so you can experience a little piece of our home. GREECE 2020 • GREECE AND MEDITERRANEAN TRAVEL CENTRE 3 Let us take you on the Trip of a Lifetime Greece and Mediterranean Travel Centre is your local boutique Australian owned and operated company. We have been designing holidays with the Australian traveller in mind for over 17 years. With personal, hands-on service, you can rest assured that your holiday will be impeccable from start to finish. Travel with us and experience the difference... Athens Zakynthos 4 GREECE 2020 • GREECE AND MEDITERRANEAN TRAVEL CENTRE Santorini Expert Knowledge Trusted Security We are destination experts of Greece and the Mediterranean. -

Salamat Pagi from Indoensia
October 1, 2012. Hello from Los Angeles! Final update from Greece! At the time of our last update on July 16th, we had just checked out of Fethiye, Turkey, in search of cooler cruising grounds. The temperature was 100 degrees and rising, so the Greek islands beckoned us with their cooler breezes. On July 17th we sailed across the Aegean Sea to Rhodes Town (six hours) and anchored in front of the wind mills by the marina. We checked into Greece with the harbor police (15 Euros), customs (35 Euros), and passport police (no fee). We also got all of our communications for Greece sorted out (modem, Ipad, and mobile phone). The next morning we motored around the point and sailed down the southwest coast of Rhodes for 23 miles to Lindos, one of our favorite spots in Greece. We swam in the crystal clear water, enjoyed lunches at the seaside tavernas (restaurants), and hiked up to the charming village above and had some lovely dinners on the rooftop restaurant terraces with great bay views and cool breezes. After five days in Lindos we decided to work our way west on somewhat of a fast track. We had already visited 31 islands last year, so we thought we would revisit a few of them on our way to the islands we missed last season, namely Serifos, Sifnos and Milos, before heading to Kalamata on the Peloponnese, where we thought we would leave Lazy Bones for the winter. So we headed for Istros, a small bay near the southern tip of Rhodes en route to the island of Halki. -
Annual Reports
The american school of classical sTudies aT Athens Annual Reports ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH THROUGH ONE HUNDRED AND TWENTY-SEVENTH 2006–2007 through 2007–2008 Corinth Architect James Herbst in the pot sheds. Photo: M.J. Gavenda Member Nathaniel Andrade and Carpenter Fellow William Caraher in front of the Arch of Galerius, Thessaloniki. Photo C. Person Trench supervisor Anne McCabe documenting a well discovered at the Agora Excavations (Section BH), 2007. Photo: C. Mauzy 2007–08 Kress Athens/Jerusa- lem Fellow Linda Meiberg at the Clemoutsi Castle on the trip to the Peloponnese. Photo: L. Meiberg Surveying at the Corinth Exca- vations. Photo: M.J. Gavenda 2007–08 Members Jenny Sears, Anne Feltovich, Matt Sears, and Alexis Belis form a human pedi- ment at the sanctuary of Pan on Thasos. Photo: K. Ormand front cover: The Athenian Agora. Photo: C. Mauzy back cover: Nezi Field excavation at Ancient Corinth. Photo: J. Herbst THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH THROUGH ONE HUNDRED AND TWENTY-SEVENTH ANNUAL REPORTS, 2006–2007 through 2007–2008 Foreword 2 Introduction and Overview 4 The Academic Program 7 The Formal Academic Program 8 Lectures and Informal Presentations 9 Conferences and Exhibitions 9 Summer Sessions 10 Archaeological Fieldwork 11 Excavations at the Athenian Agora 12 Excavations at Ancient Corinth 12 Affiliated Excavations, Surveys, and Synergasias 13 Research Facilities 15 Blegen Library 16 Gennadius Library 16 Archives 17 Malcolm H Wiener Laboratory 18 Publications 19 -

CORINTH in the OTTOMAN PERIOD.Pdf
Fayoum University Faculty of Archaeology SHEDET Issue No. 3 (2016) Annual Journal issued by The Faculty of Archaeology, Fayoum University ISSN: 2356-8704 Shedet Fayoum, 2016 Fayoum University Faculty of Archaeology JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHAEOLOGY – FAYOUM UNIVERSITY (SHEDET) FOUNDED BY THE FACULTY OF ARCHAEOLOGY – FAYOUM UNIVERSITY The guidelines, the publications and the news of the journal is available online at http://www.fayoum.edu.eg/Archaeology/Magazine/ © 2016 Faculty of Archaeology – Fayoum University 2016, Faculty of Archaeology - Fayoum University. All rights reserved. NON-COMMERCIAL REPRODUCTION Information in this journal has been produced with the intent that it be readily available for personal and public non-commercial use and may be reproduced, in part or in whole and any means, without charge or further permission from the Faculty of Archaeology-Fayoum University. We ask that: - Users exercise due diligence in ensuring the accuracy of the materials reproduced; - Faculty of Archaeology – Fayoum University be identified as the source; and - The reproduction is not represented as an official version of the materials reproduced, nor as having been made in affiliation with or with the endorsement of the Faculty of Archaeology – Fayoum University. COMMERCIAL REPRODUCTION Reproduction of multiple copies of materials in this journal, in whole or in part, for the purposes of commercial redistribution is prohibited except with written permission from The Faculty of Archaeology – Fayoum University. To obtain permission to reproduce materials in this journal for commercial purposes, please contact the Faculty of Archaeology – Fayoum University, Postal code 63514. Al-Fayoum city. Egypt. E-mail: [email protected] I SHEDET (3) 2016 Fayoum University Faculty of Archaeology SHEDET, Issue No. -
Bulletin De L’Institut Canadien En Grèce Spring 2009, No
The Canadian Institute in Greece Bulletin de l’Institut canadien en Grèce Spring 2009, No. 23 printemps 2009, n o 23 President’s Message Room 1 – CIG House, Athens - April 29, for me, though certainly within one or two of 2009. Day 2 of my 40 th trip to Greece. it, but I still remember my first visit very clearly in 1972, after digging for two months Athens is remarkably green and cool (15-20 in Italy, getting off the ferry in Patras, taking a degrees) this time of year. The dark red cheap bus to Athens and sleeping on a roof top poppies and several varieties of yellow wild at a hostel for $2.00 a night at the foot of the flowers carpet the fields and orchards coming Acropolis. I knew no one, spoke no Greek, had in from the new airport. Clouds blanket large no idea where to go, or how to get there, but areas of the sky, giving promise of rain. People had a maple leaf on my duffle bag just in case I wear sweaters or light jackets in the streets. passed another Canadian along the way. I saw The academic schedule is chock full of events. the Parthenon, got kicked out of the Agora At an American School lecture last night, Jack excavation area, found the bus to Marathon, Davis, the Director, thanked the audience for took a stormy ferry to Crete, slept on the beach attending, noting that there were 10 scholarly at Mallia never realizing till later there was a functions the night before, and hardly any Minoan palace nearby, had many adventures fewer this evening to attract people’s interest. -

The Eastern Korinthia Archaeological Survey
hesperia 75 (2006) The Eastern Pages 435–505 Korinthia Archaeological Survey Integrated Methods for a Dynamic Landscape ABSTRACT From 1997 to 2002, the Eastern Korinthia Archaeological Survey (EKAS) investigated a 350-km2 region east of the ancient city of Corinth, focusing primarily on the northern Corinthian plain. EKAS developed an interdis- ciplinary methodology that emphasizes novel applications of geological sci- ence, computer-based knowledge systems, and strategies for fieldwork and collaboration among experts. In this article, the research philosophies and methods are presented and their application illustrated with results from the survey. The historical development of one settlement, Kromna in the north- ern Corinthian plain, is examined in detail to demonstrate the interpretive potential of data collected by these methods. INTRODUCTION Corinth was one of the great cities of the ancient world, in large measure because of its location near strategic crossroads to the east.1 The Isthmus of Corinth provided overland passage from southern to central Greece, and linked the Corinthian Gulf, leading to Italy and the west, with the Saronic Gulf, giving access to the Aegean Sea, Anatolia, and the Levant to the east (Fig. 1). The site of ancient Corinth has been excavated for more than 100 years by the American School of Classical Studies at Athens.2 Much archaeological and topographic work has been undertaken in the city’s eastern hinterland, including excavations at the Panhellenic sanctuary 1. The Eastern Korinthia Archaeo- and Frederick Hemans; and in 2000– Tartaron, with advice from his co- logical Survey (EKAS) began with two 2003 by Gregory and Daniel Pullen. -

3 March 2011 * in Case C-161/09, REFERENCE for a Preliminary
JUDGMENT OF 3. 3. 2011 — CASE C-161/09 JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) 3 March 2011 * In Case C-161/09, REFERENCE for a preliminary ruling under Article 234 EC from the Simvoulio tis Epikratias (Greece), made by decision of 29 May 2008, received at the Court on 8 May 2009, in the proceedings Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, formerly K. Fragkopoulos kai SIA OE, v Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias, intervening parties: Ypourgos Georgias, * Language of the case: Greek. I - 946 KAKAVETSOS-FRAGKOPOULOS v NOMARCHIAKI AFTODIOIKISI KORINTHIAS Enosis Agrotikon Synaiterismon Aigialeias tou Nomou Achaïas, THE COURT (First Chamber), composed of A. Tizzano, President of the Chamber, J.-J. Kasel (Rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič and M. Berger, Judges, Advocate General: P. Mengozzi, Registrar: R. Şereş, Administrator, having regard to the written procedure and further to the hearing on 8 July 2010, after considering the observations submitted on behalf of: — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, formerly K. Fragkopoulos kai SIA OE, by I. Ktenidis, dikigoros, — the Greek Government, by E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou and V. Kontilaimos, acting as Agents, I - 947 JUDGMENT OF 3. 3. 2011 — CASE C-161/09 — the Netherlands Government, by C. Wissels and J. Langer, acting as Agents, — the European Commission, by M. Patakia, acting as Agent, after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 16 September 2010, gives the following Judgment 1 This reference for a preliminary