Berichtedernaturforsc Henden Gesellschaft Der Oberlausitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

XVIII. KONFERENCE České Limnologické Společnosti a Slovenskej Limnologickej Spoločnosti
XVIII. KONFERENCE České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 25. – 29. června 2018, Kořenov Veronika Sacherová (ed.) Organizační výbor RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. – předsedkyně doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. Tadeáš Rulík RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Vědecký výbor RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. – předsedkyně Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. Sponzoři XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti byla podpořena následujícími institucemi: CHKO Jizerské hory Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Vydala Česká limnologická společnost 2018 Tisk: http://www.tiskdo1000.cz/ 2 Milé kolegyně, kolegové, účastníci 18. konference ČLS a SLS, mám tu čest, že jako předseda výboru ČLS vás mohu v tomto úvodníku podruhé za sebou přivítat na společné konferenci ČLS a SLS a popřát vám příjemný pobyt v Jizerských horách. Je velmi potěšující, že ani po padesáti letech, které uplynuly od založení Limnospolu, se nám neomrzelo se pravidelně v tříletých intervalech scházet společně se slovenskými kolegy a sdělovat si, co se za tu dobu v našich společnostech událo, co kdo vybádal a publikoval. Co mne ale těší nejvíce, jsou desítky nových tváří, nových jmen účastníků, které naznačují, že česko-slovenská limnologie z pohledu populační dynamiky nevymírá, ale naopak se jedná o mladou, rostoucí populaci. A to je dobře. Za těch uplynulých 50 let, kterými si Limnospol úspěšně prošel, se můžeme pochlubit celou řadou úspěchů na poli základního výzkumu i užití limnologických poznatků v praxi, ale bez nové krve a elánu mladších kolegyň a kolegů to dále nepůjde. -
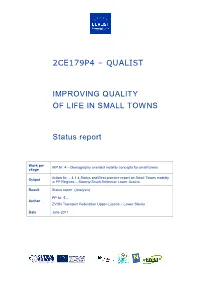
2Ce179p4 – Qualist Improving Quality of Life in Small
2CE179P4 – QUALIST IMPROVING QUALITY OF LIFE IN SMALL TOWNS Status report Work pa- WP Nr. 4 – Demography oriented mobility concepts for small towns ckage Action Nr. – 4.1.4 Status and Best practice report on Small Towns mobility Output in PP Regions – Saxony/South Bohemia/ Lower Austria Result Status report (Analysis) PP Nr. 5 – Author ZVON Transport Federation Upper-Lusatia – Lower Silesia Date June 2011 Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Preliminary remarks This “Small Towns Mobility Status Report in the PP-regions” grew out of two sub-reports: - Small towns mobility status Report (data collection, analysis of regional small towns mobility status reports, development of report for all RR regions incl. Best best practices) Responsible: Saxony Ministry of Economic Affairs, Labour and Transport - Mobility Report (Status and Best practice report on Small towns in the PP regions) Responsible: Transport Federation Upper-Lusatia – Lower- Silesia (ZVON) The editorial process was carried out by the consulting engineers - LUB Consulting GmbH, Dresden - ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden 2CE179P4 - QUALIST Status and best practice report on Small Towns mobility in PP regions- Saxony/ South Bohemia/Lower Austria Index 1 Introduction................................................................................ 1 2 Brief description of study area.................................................... 2 2.1 Saxon Vogtland .................................................................. -

SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace Restaurant with Gourmet Kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR in NEW GLORY
Savor with all your senses Our family-led four star hotel offers culinary richness and attractive arrangements for your discovery tour along Sa- xony’s Wine Route. Only a few minutes walking distance away from the hotel you can find the vineyard of Saxon master vintner Klaus Zimmerling – his expertise and our GLORY. NEW IN SPLENDOR OLD SACHSEN. SCHLOESSERLAND cuisine merge in one of Saxony’s most beautiful castle Dresden-Pillnitz Castle Hotel complexes into a unique experience. Schloss Hotel Dresden-Pillnitz August-Böckstiegel-Straße 10 SCHLOESSERLAND SACHSEN. Fireplace restaurant with gourmet kitchen 01326 Dresden OLD SPLENDOR IN NEW GLORY. Bistro with regional specialties Phone +49(0)351 2614-0 Hotel-owned confectioner’s shop [email protected] Bus service – Elbe River Steamboat jetty www.schlosshotel-pillnitz.de Old Splendor in New Glory. Herzberg Żary Saxony-Anhalt Finsterwalde Hartenfels Castle Spremberg Fascination Semperoper Delitzsch Torgau Brandenburg Senftenberg Baroque Castle Delitzsch 87 2 Halle 184 Elsterwerda A 9 115 CHRISTIAN THIELEMANN (Saale) 182 156 96 Poland 6 PRINCIPAL CONDUCTOR OF STAATSKAPELLE DRESDEN 107 Saxony 97 101 A13 6 Riesa 87 Leipzig 2 A38 A14 Moritzburg Castle, Moritzburg Little Buch A 4 Pheasant Castle Rammenau Görlitz A72 Monastery Meissen Baroque Castle Bautzen Ortenburg Colditz Albrechtsburg Castle Castle Castle Mildenstein Radebeul 6 6 Castle Meissen Radeberg 98 Naumburg 101 175 Döbeln Wackerbarth Dresden Castle (Saale) 95 178 Altzella Monastery Park A 4 Stolpen Gnandstein Nossen Castle -

B-Solutions FINAL REPORT by the EXPERT
Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. b-solutions FINAL REPORT BY THE EXPERT Advice Case: Cross-border healthcare Advised Entity: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, regional association, CZ-DE-PL Expert: Hynek Böhm Table of content: I. Description of the Obstacle II. Indication of the Legal/Administrative Dispositions causing the Obstacle III. Description of a Possible Solution IV. Pre-Assessment of whether the Case could be solved with the ECBM V. Other Relevant Aspects to this Case VI. References and Appendix/Appendices if any Managed by the Association of European Border Regions by an Action Grant (CCI2017CE160AT082) agreed with the Directorate General of Regional and Urban Policy, European Commission. Financed by the European Union. Conetxt The Šluknov tip (further also ´Šluknov area´) is the most northern edge of the Czech Republic which, is separated from the rest of the Czech Republic by mountains (Lusatian mountains and Labské pískovce). It is surrounded by Germany from 3 sides. In this area, covering 50,000 inhabitants, there is only one general hospital which currently faces insolvency and a very real threat of a shut down. Another hospital in Varnsdorf focuses on the healthcare provision for the long-term patients and the outpatient care. Accessibility of other Czech hospitals (Děčín, Česká Lípa, Liberec) from most of the municipalities of the Šluknov area is at the border of the legislative limit of 50 minutes when the weather is good. In winter and under bad weather, the accessibility time extends significantly or may be limited fully due to blizzard and slippery roads when crossing the mountains. -

Download the Detailed Introduction of the VON Area
Regional fact sheets – VON - area Deliverable D4.2 Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH Hans Jürgen Pfeiffer • Ilka Hunger (with the assistence of ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden Peter Franz • Ernst Winkler) November 2014 Contract N°: IEE/12/970/S12.670555 Table of contents 1 Spatial Analysis 3 1.1 Short overview of the area characteristics 3 1.2 Settlement structure in the VON-region 5 1.3 Transport and mobility infrastructure offered 6 2 Socioeconomic and demographic structure 6 2.1 Population`s development in the VON-area (Upper-Lusatia – Lower Silesia) 6 2.2 Summary and conclusions for public transport according to the demographic development in the region 10 3 Regional public transport systems 12 3.1 General information 12 3.2 Public rail transport 13 3.3 Public transport (road) 16 3.4 Transport and mobility prognosis 17 3.4 Area in the VON region, which is provided for the AMC campaign 18 4 References 19 D4.2: Regional fact sheets – Area of the Transport Association Upper Lusatia – Lower Silesia (VON) 2 1 Spatial Analysis 1.1 Short overview of the area characteristics The region of VON in the Federal German State Saxony is the area in responsibility of the Transport Association Upper Lusatia - Lower Silesia (ZVON). The region includes the districts of Görlitz and Bautzen, but the district of Bautzen only partially. Focus of industrial development in the district of Bautzen is the construction of railway vehicles and the production of photovoltaic systems. The economic power of the district of Görlitz is ensured by steel production, production of railway vehicles and turbines. -

Archeologické Rozhledy 2015
Archeologické rozhledy LXVII–2015 1 OBSAH Petr Květina – Jiří Unger – Petr Vavrečka, Presenting the invisible and unfat- 3–22 homable: Virtual museum and augmented reality of the Neolithic site in Bylany, Czech Republic – Jak představit, co je neviditelné a neuchopitelné? Virtuální museum a rozšířená realita neolitické lokality v Bylanech Martin Oliva, Kotázce redistribučních center štípané industrie kultury 23–44 s lineární keramikou. Litický inventář stupně IIb z Pustějova v Oderské bráně – On the issue of chipped industry redistribution centres with the Linear Pottery Culture. Lithic inventory of the IIb stage from Pustějov in the “Oderská brána” Gate Martin Trefný – Miloslav Slabina, K nejdůležitějším aspektům architektury, 45–78 hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník) – The key aspects of the architecture, material culture and significance of the Hallstatt period hillfort in Minice (Kralupy nad Vltavou, central Bohemia) Eva Černá – Kateřina Tomková – Václav Hulínský, Proměny skel od 11. do kon- 79–108 ce 13. století v Čechách – The glass transformation in Bohemia between the eleventh century and the end of the thirteenth century DISKUSE Dagmar Dreslerová, Pravěká transhumance a salašnické pastevectví na úze- 109–130 mí České republiky: možnosti a pochybnosti – Prehistoric transhumance and summer farming in the Czech Republic: possibilities and doubts Milan Holub, Poznámka k úloze grafitu ve středověké keramice Moravy 131–140 a Slezska – Observations on the role of graphite in medieval pottery from Moravia and Silesia AKTUALITY L. Jiráň, XVII. kongres UISPP v Burgosu a ukončení činnosti Českého národního komi- 141 tétu archeologického David Vích, Seminář Detektory kovů v archeologii 2014 141–143 Milan Salaš, Úmrtí PhDr. -

Transeconet NEWS Issue 10, September 2011
TransEcoNet NEWS www.transeconet.eu Issue 10, September 2011 Editorial This summer work with people in the project re- gions stood in the focus of TransEcoNet. Excur- sions were carried out to inform local residents about ecological networks and the cultural history of their region. Interviews were made with local con- temporary witnesses addressing the way how they perceive landscape change. One main activity in this respect was also the preparation of documen- © M. Fiala tary films covering Central European border land- scapes. We talked to the director of the films, Lenka In this issue Ovčačková, about her experiences with the people Landscape and memory - documentary films 1 Interview with Lenka Ovčačková 3 in the regions. Additional information about activities Life in the back of beyond: Czech-German field trip 4 of other Euro-pean projects dealing with ecological Vital Landscapes and TransEcoNet 5 networks and cultural landscapes are also covered News from the Continuum Initiative 7 in this issue of TransEcoNet News. We wish you a Publications on ecological networks 7 Other European projects 8 pleasant reading! Event calendar 9 The Project Team of TransEcoNet Landscape and Memory Documentary films about people and landscapes in Central European border regions Some of the actions implemented within TransEcoNet people cope with this challenge and how they estab- aim at raising awareness for ecological networks and lish their way of life in the border landscapes. They for the general need to maintain and restore biological reflect on their daily routines and how they transfer diversity. Therefore, a series of documentary films is former traditions and experiences to the present being implemented covering the development of the landscape. -

SACO Participants' Manual
SACO Participants' Manual Adam L. Schiff University of Washington Libraries for the Program for Cooperative Cataloging Second Edition revised by the PCC Standing Committee on Training Task Group to Update the SACO Participants’ Manual (with minor revisions, February 28, 2019) Program for Cooperative Cataloging Washington, D.C. 2007 PCC Standing Committee on Training Task Group to Update the SACO Participants’ Manual Adam L. Schiff (Chair), University of Washington Karen Jensen, McGill University John N. Mitchell, Library of Congress Kay Teel, Stanford University Alex Thurman, Columbia University Melanie Wacker, Columbia University Table of Contents Acknowledgments for the Second Edition v Acknowledgments for the First Edition vi Introduction 1 Why Participate in SACO? 4 SACO Documentation 6 Practicalities 7 Subject Headings 13 When to Make a SACO Proposal 14 Authority Research for Subjects 16 Subject Authority Proposal Form 18 Guidelines for Formulating LC Subject Heading Proposals 20 Examples of Decisions Involved in Making New Subject Proposals 23 Examples A-D: Headings Supplying More Appropriate Level of Specificity 25 Log-periodic antennas 25 Systems librarians 26 Cataloging of cartographic materials 27 Chinese mitten crab 29 Examples E-J: Headings for Genres and Forms 31 Medical drama 31 Romantic comedy films 33 Reggaetón 35 Khim and Khim music 37 Banjo and double bass music 39 Cootie catchers 40 Examples K-L: Headings Based on an Existing Pattern 42 This (The English word) 42 Historical fiction, Chilean 43 Examples M-S: Headings for Geographic Places 44 Madhupur Jungle (Bangladesh) 44 Aleknagik, Lake (Alaska) 46 Auyuittuq National Park (Nunavut) 48 Fort Worden State Park (Port Townsend, Wash.) 50 Chiles Volcano (Colombia and Ecuador) 51 Lusatian Mountains 54 Spring Lake (Hays County, Tex.) 56 Bluewater Lake (Minn.) 59 Cavanaugh, Lake (Wash. -

MUSKAUER FALTENBOGEN ŁUK MUŻAKOWA Muskau Arch
MUSKAUER FALTENBOGEN ŁUK MUŻAKOWA MUSKAU ARCH UNESCO Global Geopark Organisation Muskauer Faltenbogen der Vereinten Nationen UNESCO Global für Bildung, Wissenschaft Geopark und Kultur Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO DÄNEMARK SCHWEDEN LITAUEN RUSSLAND GdanskGdańsk RostockRostock Szczecin HamburgHamburg Szczecin LALANDND BRANDENBRANDENBURGBURG PoznanPoznań NIEDERLANDE Warszawa WEISS- BerlinBerlin Warszawa RUSSLAND Zielona Góra BUNDESREPUBLIK Cottbus POLSKA LeipzigLeipzig DEUDEUTTSCHLANDSCHLAND Dresden POLSKA Dresden Wrocław BELGIEN Frankfurt POLSKA TSCHECHIEN KrakowKraków LUXEMBURG UKRAINE FRANKREICH SlowakEI München UNGARN Oder SCHWEIZ ÖSTERREICH Poznań Berlin Frankfurt/O. A 2 Impressum: A 10 A 12 Swiecko Krosno Herausgeber.: Odrańskie Eisenhüttenstadt Förderverein Odra Zielona Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. LAND BRANDENBURG Guben POLSKA c/o D-03159 Döbern · Muskauer Str. 14 Cottbus Gubin Góra 3. erweiterte Auflage, 12/2018, Forst(L.) Leszno A 15 Auflage 20.000 Olszyna Nowa Sól redaktionell bearbeitet durch Kupetz, A. und Żary Głogów Kupetz, M. A 13 S 5 Bad Muskau Łęknica Titel der Originalausgabe: DEUTSCHLAND A 18 Spremberg Bóbr S 3 Kupetz, A. Kupetz, M. & Rascher, J. (2004): Weißwasser/O.L. Der Muskauer Faltenbogen – ein geologisches Spree Neiße WOJEWODSTWO Phänomen, Grundlage einer 130jährigen stand- Freistaat SACHSEN LUBUSKIE ortgebundenen Wirtschaftsentwicklung und Bautzen Geopark in Brandenburg, Sachsen und der A 4 Ludwigsdorf Jędrzychowice Legnica A 4 Wojewodschaft Lebuser Land.– [Hrsg.] -
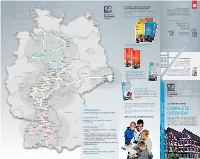
Complete Overview
LAST UPDATED: APRIL 2017 APRIL UPDATED: LAST INFORMATION ON THE GERMAN cities. member associated and Road HALF-TIMBERED HOUSE ROAD House Half-Timbered German the by reserved rights All violations and copyright infringements will be punished. punished. be will infringements copyright and violations Choose from the extensive selection of brochures that we have put law competition Any permitted. not is purposes mercial - together for you: com for excerpts of use the or part) in (even publication es to third parties is not permitted. Reproduction of this this of Reproduction permitted. not is parties third to es - address of sale commercial the for brochure this of Use • Road maps of the seven regional routes – some with cycle routes Cover image: Mosbach image: Cover www.facebook.com/Deutsche.Fachwerkstrasse www.deutsche-fachwerkstrasse.de STRASSENKARTE [email protected] 94250366 661 (0) +49 VOM Fax STRASSENKARTE 43680 661 (0) +49 RHEIN ZUM Phone VOM UND MAIN ODENWALDSTRASSENKARTE TREBUR · DREIEICH · HANAU-STEINHEIM · SELIGENSTADT ZUM BABENHAUSEN · DIEBURG · GROSS-UMSTADT · ERBACH STRASSENKARTERHEIN MAIN Germany · Fulda 36041 IM ODENWALDVON · WALLDÜRN DER · MILTENBERGSTRASSENKARTE · WERTHEIM UND VOM ODENWALD VOM Johannesberg Propstei TREBUR · DREIEICH · HANAU-STEINHEIM · SELIGENSTADTELBE HARZ BABENHAUSEN · DIEBURG · GROSS-UMSTADT · ERBACH ZUM IM ODENWALDZUM MAIN· WALLDÜRN · MILTENBERG · WERTHEIMSTADE · NIENBURG · BAD ESSEN · STADTHAGEN · ALFELD RHEIN BOCKENEM · EINBECKRHEIN · NORTHEIM · DUDERSTADT OSTERODE · HALBERSTADT · WERNIGERODE · OSTERWIECK OFFICE HEAD UND WIR SIND VOM FACHWERK HORNBURG · KÖNIGSLUTTERUND · CELLE · SALZWEDEL ZUM ODENWALD LÜCHOW · DANNENBERG · HITZACKER · BLECKEDE ODENWALD MAIN TREBUR · DREIEICH · HANAU-STEINHEIM · SELIGENSTADT TREBUR · DREIEICH · HANAU-STEINHEIM · SELIGENSTADT BABENHAUSEN · DIEBURG · GROSS-UMSTADT · ERBACH BABENHAUSEN · DIEBURG · GROSS-UMSTADT · ERBACH IM ODENWALD · WALLDÜRN · MILTENBERG · WERTHEIM IM ODENWALD · WALLDÜRN · MILTENBERG · WERTHEIM WIR SIND VOM FACHWERK VOM SIND WIR V. -

Transeconet – Transnational Ecological Networks in Central Europe
TransEcoNet – Transnational Ecological Networks in Central Europe Investigating landscapes without borders Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Project Director TransEcoNet TU Dresden, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing TransEcoNet Final Symposium, 29‐30 March 2012 History of the project •Project idea based on a couple of former Interreg projects focussing on the cross‐border harmonisation of spatial information systems for a better management of transboundary protected areas (e.g. SISTEMaPARC , Interreg IIIB CADSES 2004‐2006) Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Project Director TransEcoNet TU Dresden, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing 2 TransEcoNet Final Symposium, 29‐30 March 2012 • Questions which led to the development of TransEcoNet: Æ How strong are Central European protected areas connected among each other? Where are the gaps? Æ How did transboundary landscapes develop in the past centuries? Æ How are cross‐border landscapes constituted regarding their ecological functionality, biodiversity and ecosystem services? Æ How can awareness of transnational ecological networks be raised and contributions to their maintenance be achieved? Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Project Director TransEcoNet TU Dresden, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing 3 TransEcoNet Final Symposium, 29‐30 March 2012 Transdisciplinary approach Nature Geoinformatics conservation Remote Cultural sensing Ecological networks history Rural Landscape development ecology Environmental education Prof. Dr. Elmar Csaplovics, Project Director TransEcoNet TU -

The Suitability of Polish Ortho-Lignite Deposits for Clean Coal Technologies
GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMi – mINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2016 Volume 32 Issue 4 Pages 109–128 DOI 10.1515/gospo-2016-0034 BARBARA BIELOWICZ* The suitability of polish ortho-lignite deposits for clean coal technologies Introduction The share of hard coal and lignite in the world’s energy resources is 64%, while, the share of crude oil and natural gas is 18% each. Given that, coal is the world’s largest primary energy source. As of 2013, Poland is the fourth largest producer of lignite behind Germany, Russia and the United States (WCA 2015; IEA 2015). Polish lignite is almost exclusively processed in order to produce electricity and heat. Only small amounts on the market are addressed for municipal purposes and heating. The same applies to lignite used in agriculture as an organic fertilizer. Currently, the pro- duction of electricity and heat is the only large scale use for lignite in Poland. Any other possibilities of using this raw material, primarily for chemical processing and synthesis gas production, are ignored. The annual production capacity of polish lignite mines is around 66 million tons of coal, almost exclusively used for electricity and heat production. The installed capacity of lig- nite-fired power plants is around 9,000 MW, while the produced energy has 34% share in domestic production. The aforementioned energy is 30% cheaper than energy from hard coal (Kasztelewicz et al. 2013). Currently, lignite is mined in the following mines: Lignite Mine Adamów – 2 open pits, the annual production capacity of 5 million tons, * Ph.D. Eng., AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland; e-mail: [email protected] 110 Bielowicz 2016 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(4), 109–128 PGE GiEK, Lignite Mine Bełchatów and Lignite Mine Turów – 3 open pits, the an- nual production capacity of 51.3 million tons, Lignite Mine Konin – 3 open pits, the annual production capacity of 10.4 million tons.